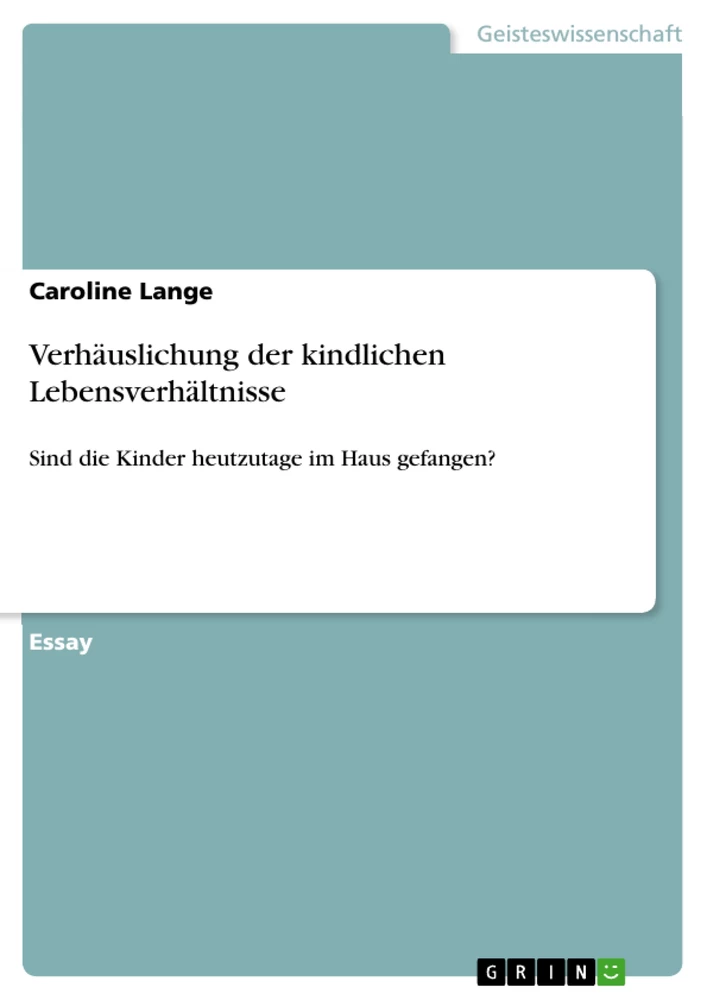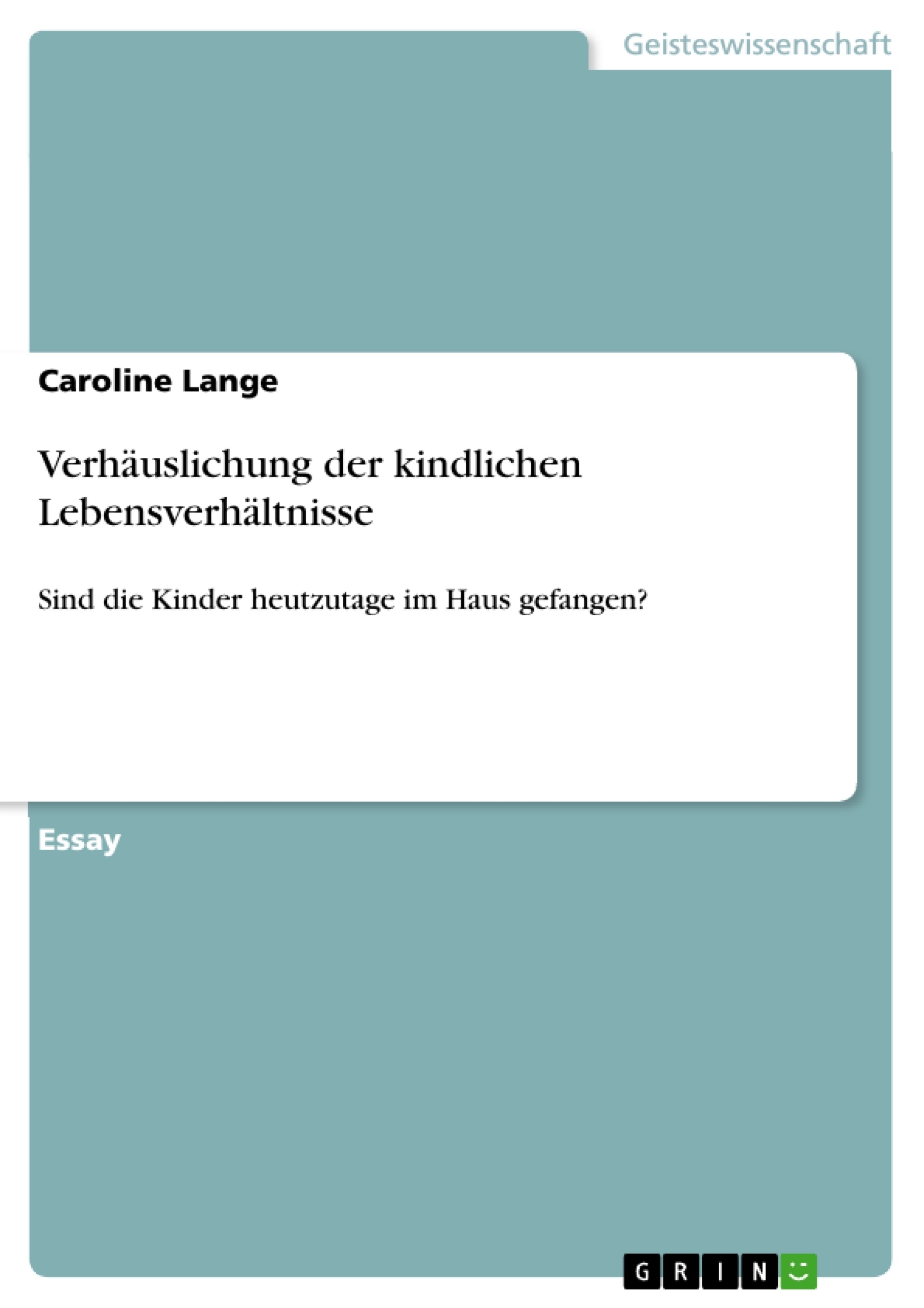Die Spielräume von Kindern werden immer enger, jedenfalls von denen, die in der Stadt wohnen. Grünflächen und freier Plätze sind begrenzt, es gibt kaum noch unberührte Flächen, alles wird optimal genutzt. Spielplätze sind von Erwachsenen entworfen und geprüft, so dass die Kinder kaum noch Eigeninitiative zeigen müssen/können oder kreativ sind und ihre Fantasie benutzen. Aber spielen Kinder deshalb heute wirklich fast nur noch im Haus? Kann man somit von einer Verhäuslichung von Kindern sprechen?
Kann man von einer Verhäuslichung der kindlichen Lebensverhältnisse sprechen?
„Hatten Kinder in Deutschland vor 20 Jahren einen Spielradius von 20 Kilometern, bewegen sie sich heute höchstens vier Kilometer von zu Hause fort; sie verbringen gerade mal zwölf Stunden in der Woche außer Haus. Und wenn sie draußen sind, dann fast ausschließlich in Gehegen wie Trainings- oder Spielplätzen mit DIN-gemäßen und TÜV-geprüften Gerätschaften.“ (Rühle, 2008, S. 2)
Die Spielräume von Kindern werden immer enger, jedenfalls von denen, die in der Stadt wohnen. Grünflächen und freier Plätze sind begrenzt, es gibt kaum noch unberührte Flächen, alles wird optimal genutzt. Spielplätze sind von Erwachsenen entworfen und geprüft, so dass die Kinder kaum noch Eigeninitiative zeigen müssen/können oder kreativ sind und ihre Fantasie benutzen. (vgl. Rühle, 2008) Aber spielen Kinder deshalb heute wirklich fast nur noch im Haus? Kann man somit von einer Verhäuslichung von Kindern sprechen?
Die Theorie der Verhäuslichung wird insbesondere von Zinnecker beschreiben und dieser sieht darin einen Entwicklungsprozess im Zuge der Modernisierung des 19. und 20. Jahrhunderts. „Die Lebenswelt der Kinder wird in geschützte Räume hineinverlagert; gegenüber der natürlichen Umwelt versiegelt; von den Handlungsorten anderer abgegrenzt.“ (Zinnecker, 2001, S.27) Er weist darauf hin, dass die Verhäuslichung ein allgemeiner Prozess sei und alle Altersgruppen davon betroffen sein, doch Kinder besonders, da sie stärker in strukturelle Gegebenheiten eingebunden sein. (vgl. Zinnecker, 2001, S.27)
Um eine Antwort auf die Frage der Verhäuslichung zu geben, werde ich versuchen repräsentative Studien von früher und heute miteinander zu vergleichen und mögliche Drittfaktoren und Verzerrungen zu erläutern.
Der Verglich von Studien stellt sich als relativ schwierig heraus, da es nur einige wenige Studien von früher gibt. Die ersten Studien zum Thema Kinder und deren Freizeit gab es Anfang der achtziger Jahre (vgl. Lang, 1985). Davor, z.B. über Kindheit in der Nachkriegszeit gibt es kaum bzw. keine relevanten Studien. Und dabei wird gerne gerade die Zeit nach 1945 mit idealisierten Trümmerlandschaften und Abenteuerspielplätzen für Kinder beschreiben. Die Kinder hatten angeblich nahezu unendliche Freiräume und Spielräume, aber das Ruinen nicht gerade ideale Spielplätze für Kinder sind, wird manchmal vergessen. Damals spielte man mit vielen anderen Kindern draußen in den Trümmern der zerbombten Städte. Aber dabei ist zu bedenken, dass die Kinder in der Nachkriegszeit kaum andere Möglichkeiten hatten, im „Haus“ hatten sie kaum bis gar kein Spielzeug und Platz zum Spielen war sowieso nicht vorhanden. Ihnen blieb keine andere Wahl als nach draußen zu gehen. Die meisten wären wahrscheinlich froh gewesen ein eigenes Zimmer zu haben, einen Rückzugort zu besitzen oder einfach die Tür schließen zu können um einen Moment alleine zu sein. Dies sind allerdings nur Vermutungen und Aussagen von einigen Zeitzeugen, somit erheben sie keinen Anspruch auf Repräsentativität. Auf der anderen Seite gab es aber auch viele Kinder die einen Elternteil ersetzten, auf ihre Geschwister aufpassen oder den Eltern helfen mussten und somit kaum Zeit zum Spielen hatten.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „Verhäuslichung“ der Kindheit?
Er beschreibt den Trend, dass sich das Leben und Spielen von Kindern zunehmend von draußen (Straßen, freie Natur) in geschützte, von Erwachsenen kontrollierte Innenräume verlagert.
Warum verringert sich der Spielradius von Kindern heute?
Gründe sind der zunehmende Verkehr, die dichte Bebauung in Städten, das Verschwinden unberührter Flächen und Sicherheitsbedenken der Eltern.
Wie kritisiert die Arbeit moderne Spielplätze?
Spielplätze werden oft als „Gehege“ mit TÜV-geprüften Geräten beschrieben, die wenig Raum für Eigeninitiative, Kreativität und echte Abenteuer bieten.
War früher wirklich alles besser für spielende Kinder?
Die Arbeit warnt vor Idealisierung. In der Nachkriegszeit spielten Kinder zwar draußen in Trümmern, hatten aber oft kein Spielzeug, keinen Rückzugsort im Haus und mussten oft früh bei der Arbeit helfen.
Welche Rolle spielt die Modernisierung bei der Verhäuslichung?
Zinnecker sieht Verhäuslichung als allgemeinen Prozess der Moderne, der alle Altersgruppen betrifft, Kinder jedoch besonders stark in strukturierte Räume einbindet.
- Citar trabajo
- Caroline Lange (Autor), 2012, Verhäuslichung der kindlichen Lebensverhältnisse, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209634