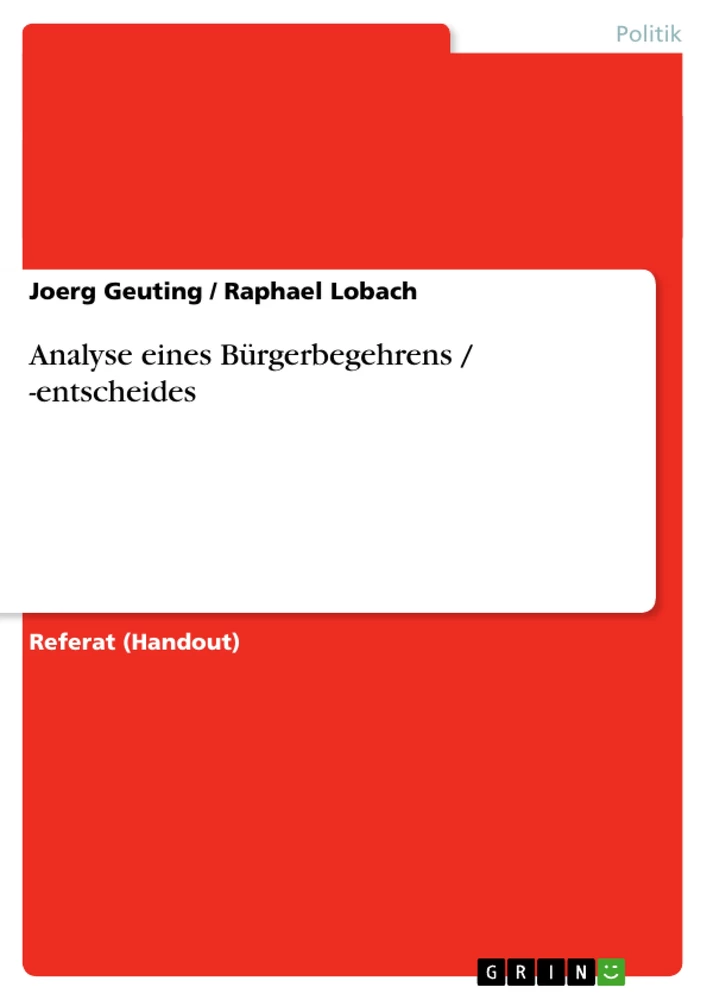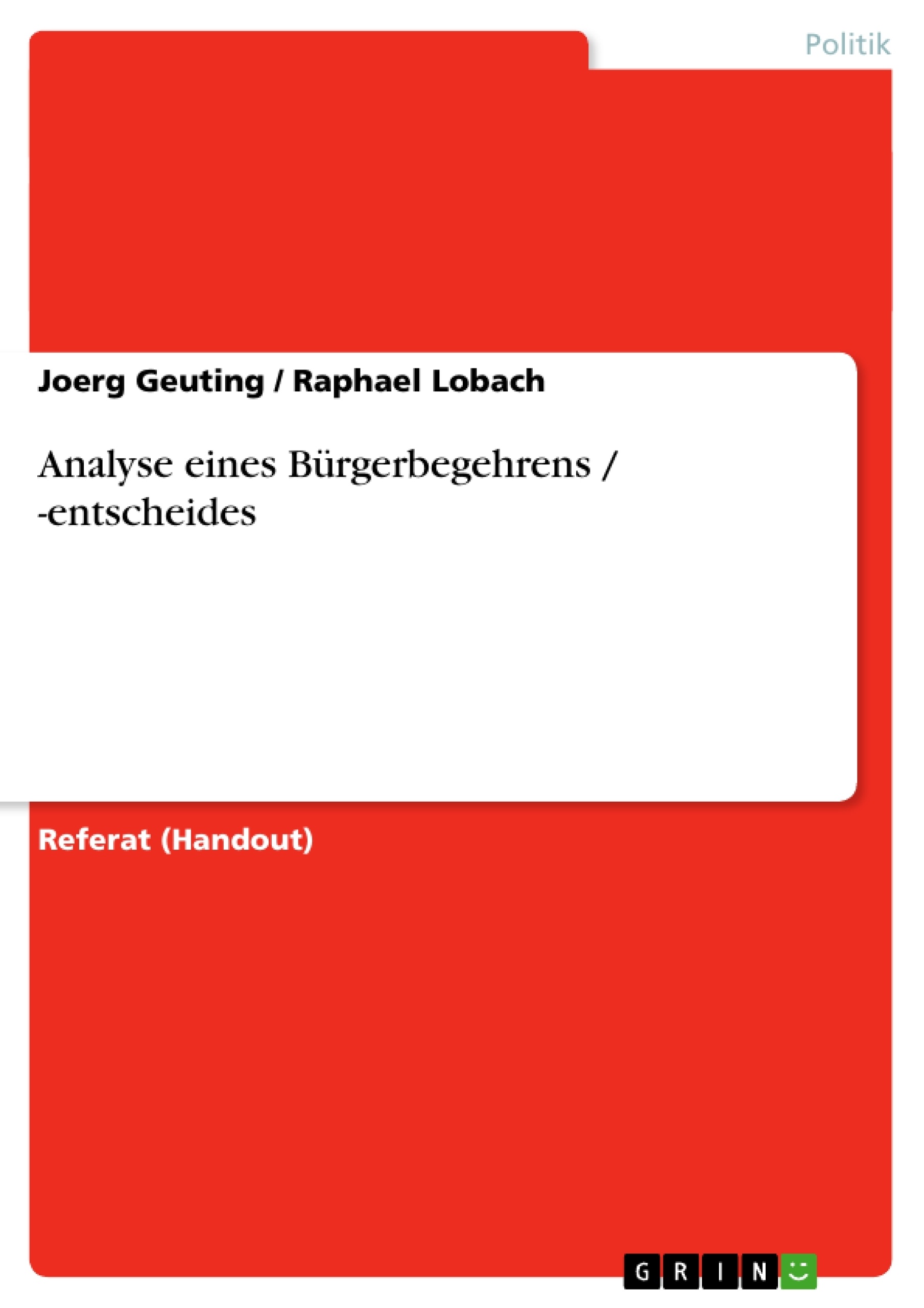Einleitung:
- es sind die mächtigsten Instrumente mit denen Bürger und Bürgerinnen die Politik in ihrer Gemeinde oder in ihrem Landkreis beeinflussen können
- sie können dadurch ihrem gewählten Repräsentanten eine Sachentscheidung aus der Hand nehmen, weil ein erfolgreicher Bürgerentscheid wie ein Ratsbeschluss umge-setzt werden muss
- die Gemeinde- und Kreisordnungen der Bundesländer schreiben detailliert vor welche Vorraussetzungen gegeben sein müssen, damit ein Bürgerbegehren zulässig ist
- die Themen die nicht zulässig sind, werden in dem sog. „Negativkatalog“ festgehalten (siehe Punkt 4.1)
- außerdem müssen bestimmte Fristen und formale Regeln eingehalten werden sowie bestimmte Quoren überwunden werden (siehe Punkt 11, 14)
- dies alles sind Faktoren, die die Durchführung eines Bürgerbegehrens erheblich er-schweren oder gar unmöglich machen
- man kann ein Bürgerbegehren einleiten, wenn man z.B. der Meinung ist, dass das Kommunalparlament Unsinn beschlossen hätte, oder wichtige lokale Themen vernach-lässigen würden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist ein Bürgerbegehren und ein Bürgerentscheid? Zu welchem Zweck werden sie durchgeführt?
- Wer kann ein Bürgerbegehren initiieren? Wer kann sich daran beteiligen?
- Themen und Gegenstände von Bürgerbegehren
- Negativkatalog
- Fristen
- initiierendes Bürgerbegehren
- kassierendes Bürgerbegehren
- Abstimmungsfrage und Begründung
- Kostendeckungsvorschlag
- Vertretungsberechtigte
- Unterschriftenliste
- Unterschriftensammlung
- Einleitungsquorum
- Zulässigkeitsprüfung
- unzulässige Bürgerbegehren und Rechtsweg
- Durchführung eines Bürgerentscheides
- Abstimmungsbekanntmachung und Frage
- Abstimmungstermin
- Zustimmungsquorum
- ein gescheiterter Bürgerentscheid
- ein erfolgreicher Bürgerentscheid
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Bürgerbegehren als Instrument der direkten Demokratie in Deutschland. Ziel ist es, die Funktionsweise des Bürgerbegehrens in den einzelnen Bundesländern zu erläutern und die verschiedenen Aspekte dieses Instruments zu beleuchten. Dabei werden sowohl die Vorteile als auch die Herausforderungen für die Durchführung eines Bürgerbegehrens aufgezeigt.
- Rechtliche Rahmenbedingungen des Bürgerbegehrens
- Voraussetzungen für die Initiierung und Durchführung
- Die Rolle des Negativkatalogs und der Fristen
- Das Einleitungsquorum und die Zulässigkeitsprüfung
- Die Durchführung eines Bürgerentscheides
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Bedeutung des Bürgerbegehrens als Instrument der direkten Demokratie dar und erläutert den Umfang der Arbeit. Kapitel 2 definiert das Bürgerbegehren und den Bürgerentscheid und beschreibt ihren Zweck. Kapitel 3 befasst sich mit den Personen, die ein Bürgerbegehren initiieren und sich daran beteiligen können. Kapitel 4 beleuchtet die Themen und Gegenstände, die Gegenstand eines Bürgerbegehrens sein können, und geht dabei auch auf den Negativkatalog ein. Die Kapitel 5 bis 8 befassen sich mit den Fristen, der Abstimmungsfrage und Begründung, dem Kostendeckungsvorschlag, sowie den Vertretungsberechtigten. Die Kapitel 9 bis 11 erläutern die Unterschriftenliste, die Unterschriftensammlung und das Einleitungsquorum. Kapitel 12 analysiert die Zulässigkeitsprüfung des Bürgerbegehrens und geht auf unzulässige Bürgerbegehren und den Rechtsweg ein. Das Kapitel 13 befasst sich mit der Durchführung eines Bürgerentscheides und erläutert die verschiedenen Aspekte der Organisation und Durchführung. Die Kapitel 14 bis 16 befassen sich mit dem Zustimmungsquorum und den Folgen eines gescheiterten bzw. erfolgreichen Bürgerentscheides.
Schlüsselwörter
Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, direkte Demokratie, Kommunalpolitik, Gemeindeordnungen, Negativkatalog, Fristen, Einleitungsquorum, Zulässigkeitsprüfung, Durchführung, Abstimmung, Zustimmungsquorum.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen einem Bürgerbegehren und einem Bürgerentscheid?
Ein Bürgerbegehren ist der Antrag der Bürger auf Durchführung eines Bürgerentscheids. Der Bürgerentscheid ist die eigentliche Abstimmung, die bei Erfolg die rechtliche Wirkung eines Gemeinderatsbeschlusses hat.
Was beinhaltet der sogenannte „Negativkatalog“?
Der Negativkatalog listet Themen auf, über die kein Bürgerentscheid stattfinden darf, wie zum Beispiel die Haushaltssatzung, Bauleitpläne oder die innere Organisation der Verwaltung.
Welche Quoren müssen für ein erfolgreiches Verfahren erreicht werden?
Zunächst muss ein Einleitungsquorum (eine bestimmte Anzahl an Unterschriften) erfüllt sein. Beim Bürgerentscheid selbst muss das Zustimmungsquorum (eine Mindestanzahl an Ja-Stimmen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stimmberechtigten) erreicht werden.
Was ist ein „kassierendes“ Bürgerbegehren?
Ein kassierendes Bürgerbegehren richtet sich gegen einen bereits gefassten Beschluss des Gemeinderats mit dem Ziel, diesen innerhalb einer bestimmten Frist wieder aufzuheben.
Warum ist ein Kostendeckungsvorschlag notwendig?
In vielen Bundesländern muss ein Bürgerbegehren einen Vorschlag enthalten, wie die durch die geforderte Maßnahme entstehenden Kosten gedeckt werden sollen, um die finanzielle Verantwortung zu wahren.
- Quote paper
- Joerg Geuting (Author), Raphael Lobach (Author), 2003, Analyse eines Bürgerbegehrens / -entscheides, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20970