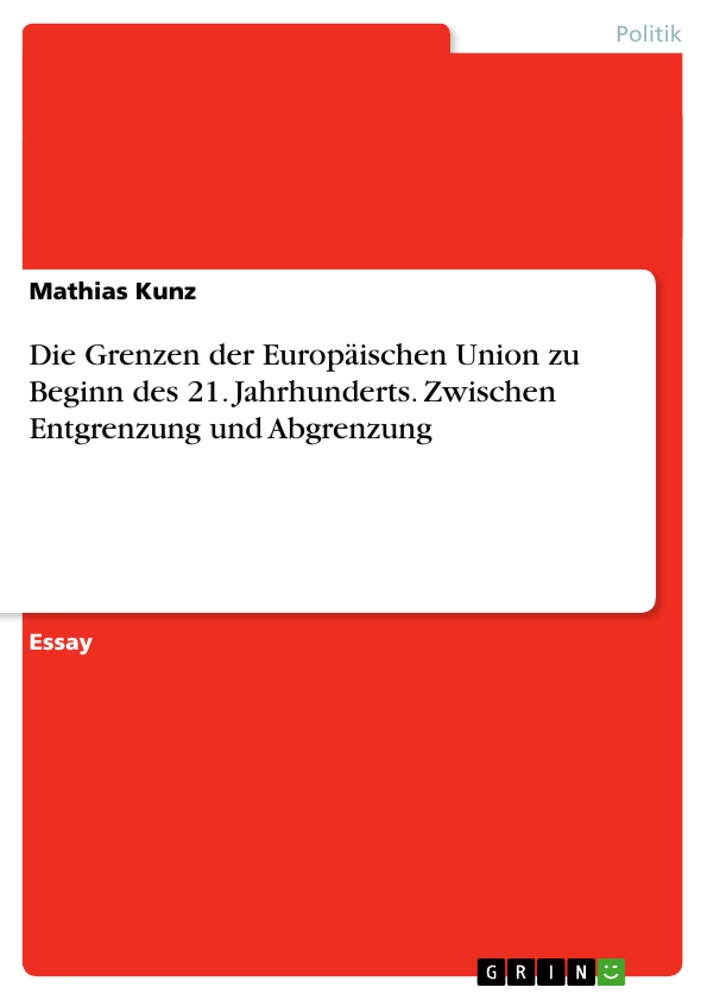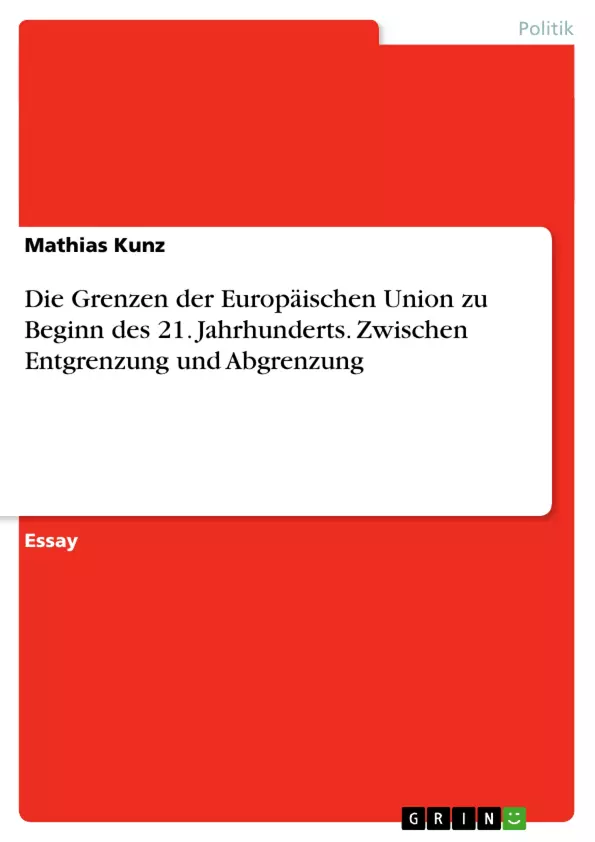Am 12. Februar 1992 trat der damalige Bundesminister des Innern Rudolf Seiters vor den Deutschen Bundestag, um eine von der Opposition angeregte Befragung der Bundesregierung bezüglich des Schengener Übereinkommens zu beantworten. In dieser Rede referiert Bundesminister Seiters, dass das Übereinkommen zur Durchführung des Schengener Abkommens von 1990 „die vollständige Aufhebung aller Personenkontrollen an den Binnengrenzen der Vertragsstaaten“ sowie Ausgleichsmaßnahmen vorsah, welche die Sicherheit der Bürger nicht gefährden würden. „Zu diesen Ausgleichsmaßnahmen gehören u. a. einheitliche Kontrollen an den Außengrenzen, ein gemeinsames Fahndungssystem, Erleichterungen und Vereinfachungen im Bereich der internationalen Rechtshilfe und der Auslieferung sowie die Harmonisierung der Sichtvermerkspolitik und der Einreisebedingungen für Drittausländer.“ Darüber hinaus plädierte Seiters im Namen der Bundesregierung dafür, dass möglichst bald sämtliche EG-Mitgliedsländer diesem Schengener Abkommen beitreten sollten. Mit diesen wenigen Punkten seiner Rede verdeutlichte Seiters bereits, dass zu Beginn der 1990er Jahre ein binneneuropäischer Entgrenzungsprozess einsetzen würde, einhergehend mit Abgrenzungstendenzen an den Außengrenzen der Europäischen Gemeinschaft. Doch wo stehen wir heute? Mithilfe dieses Essays soll versucht werden, Ent- bzw. Abgrenzungstendenzen in Europa zu Beginn des 21. Jahrhunderts zu analysieren. Hierfür wird zunächst der zentrale Begriff Grenze definiert. Im Anschluss daran wird anhand von drei unterschiedlichen Grenztypen – Land-, See- und Luftraumgrenzen – die Frage beantwortet, ob im Europa des 21. Jahrhunderts eher von Ent- oder von Abgrenzung die Rede sein kann.
Am 12. Februar 1992 trat der damalige Bundesminister des Innern Rudolf Seiters vor den Deutschen Bundestag, um eine von der Opposition angeregte Befragung der Bundesregierung bezüglich des Schengener Übereinkommens zu beantworten. In dieser Rede referiert Bundesminister Seiters, dass das Übereinkommen zur Durchführung des Schengener Abkommens von 1990 „die vollständige Aufhebung aller Personenkontrollen an den Binnengrenzen der Vertragsstaaten“[1] sowie Ausgleichsmaßnahmen vorsah, welche die Sicherheit der Bürger nicht gefährden würden. „Zu diesen Ausgleichsmaßnahmen gehören u. a. einheitliche Kontrollen an den Außengrenzen, ein gemeinsames Fahndungssystem, Erleichterungen und Vereinfachungen im Bereich der internationalen Rechtshilfe und der Auslieferung sowie die Harmonisierung der Sichtvermerkspolitik und der Einreisebedingungen für Drittausländer.“[2] Darüber hinaus plädierte Seiters im Namen der Bundesregierung dafür, dass möglichst bald sämtliche EG-Mitgliedsländer diesem Schengener Abkommen beitreten sollten.[3] Mit diesen wenigen Punkten seiner Rede verdeutlichte Seiters bereits, dass zu Beginn der 1990er Jahre ein binneneuropäischer Entgrenzungsprozess einsetzen würde, einhergehend mit Abgrenzungstendenzen an den Außengrenzen der Europäischen Gemeinschaft. Doch wo stehen wir heute? Mithilfe dieses Essays soll versucht werden, Ent- bzw. Abgrenzungstendenzen in Europa zu Beginn des 21. Jahrhunderts zu analysieren. Hierfür wird zunächst der zentrale Begriff Grenze definiert. Im Anschluss daran wird anhand von drei unterschiedlichen Grenztypen – Land-, See- und Luftraumgrenzen – die Frage beantwortet, ob im Europa des 21. Jahrhunderts eher von Ent- oder von Abgrenzung die Rede sein kann.
Das deutsche „Wort Grenze gehört zu den wenigen Lehnwörtern […]“[4], welche einen slawischen Ursprung aufzeigen. Bereits gegen Ende des 12. bzw. zu Beginn des 13. Jahrhunderts tauchte der Begriff erstmals in Verträgen auf, welche zwischen dem Deutschen Orden und polnischen Fürsten bezüglich territorialer Besitzungen geschlossen wurden. Hierbei wurde das slawische Wort graniza, das vom indogermanischen ghrô („spitz sein“, „hervorragen“) abstammt, in den Vertragstexten zur Absteckung der Besitzungen genutzt. Der Begriff graniza „wurde zunehmend latinisiert (cum graniciis) und [schließlich, Anm. des Autors] eingedeutscht (grentczen)“[5], sodass das ursprünglich slawische Wort Bestandteil der deutschen Sprache wurde. Interessanterweise legte der Deutsche Orden bei solchen Verhandlungen in Preußen und Pommern viel Wert darauf, dass exakte und lineare Abgrenzungen in den Verträgen vorgenommen wurden. Zurückzuführen ist dieses Verhalten wohl darauf, dass aufgrund der Negativerfahrungen des Deutschen Ordens in Ungarn, wo kein Ordensstaat etabliert werden konnte, ein Umdenken innerhalb des Ordens einsetzte.[6] Genaue Grenzbestimmungen sollten in Preußen und Pommern „jene fehlenden feudalen Bindungen ersetzen, auf denen die anderen politischen Gebilde jener Zeit basierten.“[7] Bis zu diesen Grenzverträgen des Deutschen Ordens war „das persönliche Verhältnis des Vasallen zu einem Lehnsherrn und nicht eine bestimmte Räumlichkeit oder gar linear fixierte Grenze entscheidend für die Zugehörigkeit“[8] und Loyalität von Herrschenden und Beherrschten. Dieses Loyalitätsverhältnis zwischen Vasallen und Lehnsherrn fehlte jedoch im Ordensstaat, weshalb lineare und konstruierte Grenzen Zugehörigkeitsbeziehungen auf neue Art und Weise regelten.
[...]
[1] Deutscher Bundestag (1992): Protokoll der 75. Sitzung der 12. Wahlperiode, Bonn, S.
6231.
[2] Ebd.
[3] Vgl. Ebd.
[4] Krämer, Raimund (2009): Staatsgrenzen im Wandel – eine theoretisch-historische Reflexion,
in: Krämer, Raimund (Hrsg.): Grenzen in den internationalen Beziehungen, Potsdam, Welt-
trends Lehrtexte, S. 13.
[5] Krämer (2009): Staatsgrenzen im Wandel, S. 14.
[6] Vgl. Ebd., S. 13 f.
[7] Ebd., S. 14.
[8] Ebd.
- Arbeit zitieren
- Mathias Kunz (Autor:in), 2012, Die Grenzen der Europäischen Union zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Zwischen Entgrenzung und Abgrenzung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209814