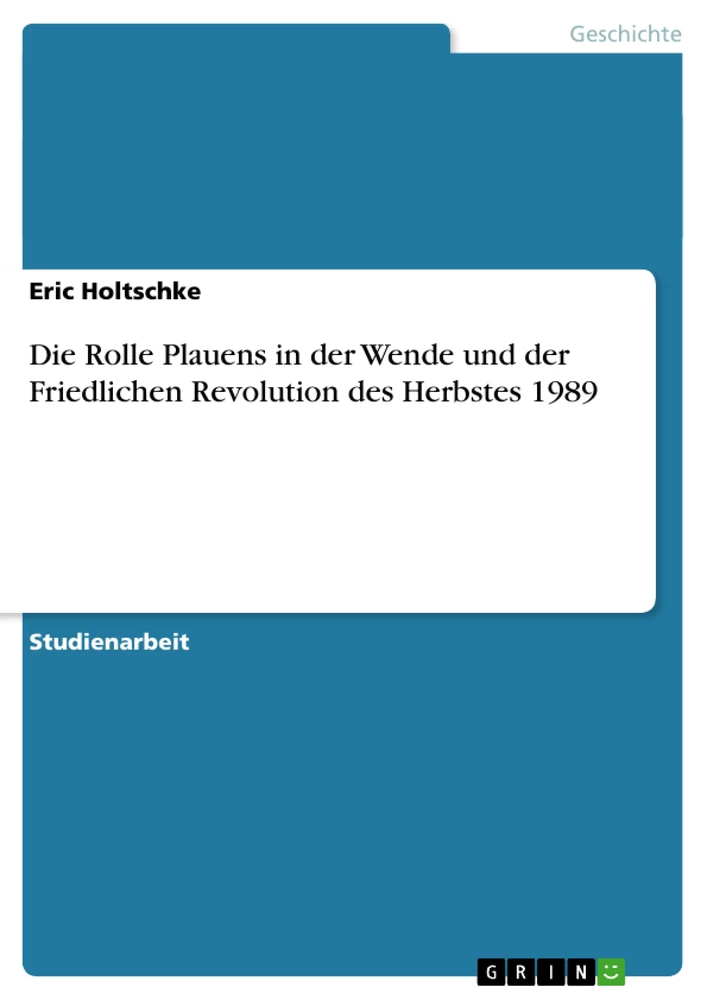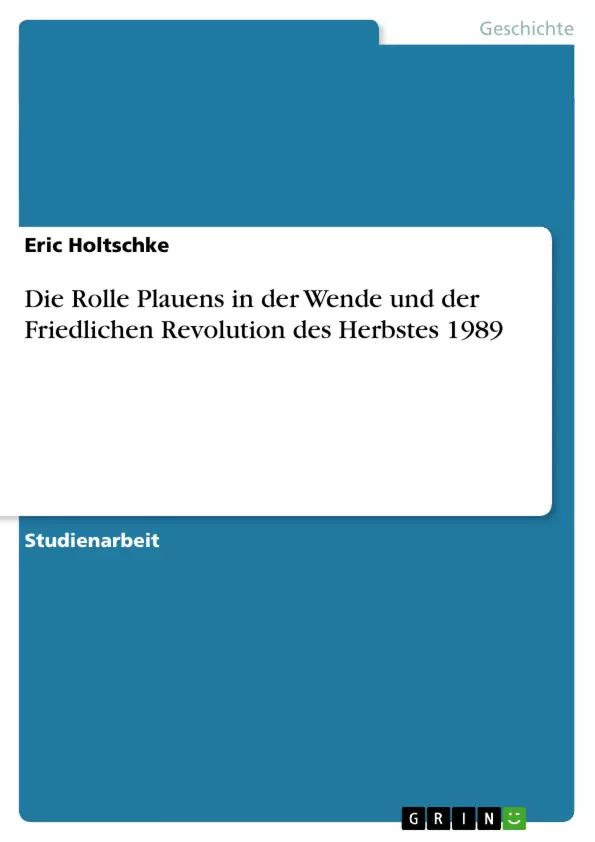21 Jahre liegt nunmehr das bedeutendste Ereignis der Vogtlandmetropole, wie die Menschen ihre Stadt am Rande Sachsens liebevoll bezeichnen, zurück: Es war der 7. Oktober 1989, als einige tausende mutige Bürger der Stadt Plauen ihren Protest gegen das SED-Regime in der ersten Großdemonstration auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik Ausdruck verliehen. In der Geschichtsschreibung seit jeher stets vernachlässigt, musste sich die Stadt in
der Aufarbeitung der "Wende"-Ereignisse häufig hinter den großen Metropolen Berlin, Dresden, Leipzig oder Karl-Marx-Stadt verstecken. Doch das positive politische Erbe der Stadt Plauen und des Vogtlandes jener Zeit wussten die Menschen der hiesigen Region stets nach außen hin zu repräsentieren. Umso erfreulicher nehmen die Bürger, vor allem jene, die damals "Kopf und Kragen" in den Auseinandersetzungen mit dem SED-Regime riskiert haben, die Wandlung in der Wissenschaft auf, die der Stadt Jahr für Jahr eine immer wichtigere Rolle zuteil werden lässt. "Die unbemerkten Helden" titelte "Der Spiegel" im Sommer 2009, als sich die Friedliche Revolution zum 20. Male jährte, und verdeutlichte den Konflikt kurz und bündig: "Im sächsischen Vogtland kämpft eine Stadt um ihren Platz im Geschichtsbuch. Denn im Herbst 1989 wurde die Staatsmacht zuerst in Plauen bezwungen – und nicht in Leipzig." Eine Gedenktafel auf dem Plauener Theaterplatz zeugt von genau jenem Ereignis in zwei Sätzen, die treffender und bedeutsamer nicht sein könnten: "An dieser Stelle begann am 7. Oktober 1989 die erste Großdemonstration auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Das war der Anfang der Veränderung unserer Welt."
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Aufbau
1.3 Forschungsstand
2. Plauen als Ausgangspunkt der Friedlichen Revolution 1989/1990 - Ursachen und Gründe
2.1 Aufstieg und Zerfall einer Stadt
2.2 Die besondere geographische Lage Plauens
3 Die Friedliche Revolution 1989 in Plauen
3.1 Zur Vorgeschichte: „Wir sind ein Volk!“
3.2 Plauen und der 7. Oktober 1989
3.3 Die Nachwirkungen des 7. Oktobers 1989
4. Evaluation der Ereignisse
5. Schlussbetrachtung
6. Bibliographie
1. Einleitung
21 Jahre liegt nunmehr das bedeutendste Ereignis der Vogtlandmetropole, wie die Menschen ihre Stadt am Rande Sachsens liebevoll bezeichnen, zurück: Es war der 7. Oktober 1989, als einige tausende mutige Bürger der Stadt Plauen ihren Protest gegen das SED-Regime in der ersten Großdemonstration auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik Ausdruck verliehen. In der Geschichtsschreibung seit jeher stets vernachlässigt, musste sich die Stadt in der Aufarbeitung der „Wende“-Ereignisse häufig hinter den großen Metropolen Berlin, Dresden, Leipzig oder Karl-Marx-Stadt verstecken. Doch das positive politische Erbe der Stadt Plauen und des Vogtlandes jener Zeit wussten die Menschen der hiesigen Region stets nach außen hin zu repräsentieren. Umso erfreulicher nehmen die Bürger, vor allem jene, die damals „Kopf und Kragen“ in den Auseinandersetzungen mit dem SED-Regime riskiert haben, die Wandlung in der Wissenschaft auf, die der Stadt Jahr für Jahr eine immer wichtigere Rolle zuteil werden lässt. „Die unbemerkten Helden“ titelte „Der Spiegel“ im Sommer des vergangenen Jahres, als sich die Friedliche Revolution zum 20. Male jährte, und verdeutlichte den Konflikt kurz und bündig: „Im sächsischen Vogtland kämpft eine Stadt um ihren Platz im Geschichtsbuch. Denn im Herbst 1989 wurde die Staatsmacht zuerst in Plauen bezwungen - und nicht in Leipzig.“[1] Eine Gedenktafel auf dem Plauener Theaterplatz zeugt von genau jenem Ereignis in zwei Sätzen, die treffender und bedeutsamer nicht sein könnten: „An dieser Stelle begann am 7. Oktober 1989 die erste Großdemonstration auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Das war der Anfang der Veränderung unserer Welt.“
Einer derer, der damals an vorderster Front für Reisefreiheit, Versammlungsfreiheit und für freie Wahlen einstand, war Thomas Küttler, der frühere Superintendent: „Es ist wohl nicht zuviel gesagt, daß diese Stadt [...] im Verhältnis zu ihrer Größe und sonstigen Bedeutung einen überdurchschnittlich großen Beitrag zur Wende gebracht hat.“[2] Küttler, der damals als politischer Außenseiter, als Sonderling, tituliert wurde und mittlerweile in Leipzig wohnhaft ist, ärgert sich noch heute über die verfälschte Geschichtsschreibung. Es muss „endlich etwas gerade gerückt werden [in der] Heldenstadt“[3], wird er im „Spiegel“ zitiert. Das Problem der Stadt Plauen: Die Demonstration am 7. Oktober 1989 war ein Aufruhr unter Ausschluss der Öffentlichkeit. „Es gab keine Fernsehbilder“[4], berichtete Thomas Küttler. Lediglich die lokalen Tageszeitungen nahmen von dieser Protestaktion Notiz. So stempelte die „Freie Presse“ zwei Tage später, am 9. Oktober 1989, in gewohnter sozialistischer Ideologie die erste Großdemonstration als „Gewissenlose Provokation“[5] ab, bei der „eine Zusammenrottung von mehreren hundert Personen“ (anderen Angaben zufolge beteiligten sich rund 15.000 Menschen an diesem friedlichen Protestmarsch) durch die Innenstadt zum Rathaus zog, dabei Fensterscheiben zerschlugen, Autos in Brand steckte und Löschfahrzeuge der Feuerwehr demolierte.[6] „Die Rädelsführer brüllten gegen die Staatsordnung der DDR gerichtete Drohungen und Parolen. [...] Dank der entschlossenen und besonnenen Haltung gesellschaftlicher Kräfte waren diese Provokationen zum Scheitern verurteilt.“[7]
Doch zurück zu den Wahrheiten des 7. Oktobers 1989. Im Vorwort des Buches „Es war das Volk. Die Wende in Plauen - Eine Dokumentation“ von Thomas Küttler und Jean Curt Röder kam Prof. Dr. Kurt Biedenkopf, von 1990 bis 2002 Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, auf den Punkt: „Plauen hat in der Wende eine herausragende Rolle gespielt. [...] Hier [sind] die Menschen besonders früh und mit großer Risikobereitschaft auf die Straße gegangen, um sich die elementaren Freiheitsrechte zu erstreiten, die ihnen jahrzehntelang vorenthalten waren. Plauen, die Stadt und das Vogtland insgesamt gehören zu den Zentren des Aufbruchs in Sachsen.“[8]
1.1 Problemstellung
Die vorliegende Hausarbeit möchte einen ausführlichen Einblick in eine spezifische Thematik der Friedlichen Revolution des Herbstes 1989 - entsprechend des zur Verfügung stehenden Umfangs - gewähren. Kernbestandteil dieser Arbeit bildet eine Untersuchung, Analyse und Bewertung der Rolle und der Bedeutung der Stadt Plauen im „Heißen Herbst“ 1989 für den weiteren Verlauf der Friedlichen Revolution auf dem Boden der Deutschen Demokratischen Republik sowie für die spätere Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten, das anhand zahlreicher Zitate, Äußerungen, Interviews, Zeitzeugen- und Augenzeugenberichte sowie Zeitungsartikel und entsprechender Literatur realisiert worden ist. Zentrale Fragestellungen dieser Hausarbeit lauten: Aus welchen Gründen waren es gerade die Stadt Plauen und das umliegende Vogtland, in denen ein solch starker Wille zum Umsturz des politischen Status quo allgegenwärtig war? Welche Rolle spielte die Stadt in der Friedlichen Revolution 1989/1990 und wie wird diese Rolle bewertet?
1.2 Aufbau
Um eine sinnvolle Hinführung zum eigentlichen Thema zu erhalten, ist eingangs ein kurzer historischer Abriss über die Geschichte der Stadt Plauen unumgänglich. Erst dies ermöglicht später eine objektive Wahrnehmung der Ereignisse in der Friedlichen Revolution und trägt zum Verständnis der Ursachen und Gründe, die Plauen zum Ausgangspunkt der Massenproteste auf dem Territorium der Deutschen Demokratischen Republik werden ließen, bei. Hierbei spielt insbesondere die geographische (Rand-)Lage der Vogtlandmetropole eine entscheidende Rolle, welche im ersten inhaltlichen Hauptteil dieser Hausarbeit - neben weiteren anderen Faktoren - umfangreich beleuchtet wird.
Der zweite inhaltliche Hauptteil beschäftigt sich eingehend mit dem Beginn der Friedlichen Revolution 1989. Hierbei wird sowohl auf die Vorgeschichte des 7. Oktobers 1989 eingegangen, als auch der Frage auf den Grund gegangen, ob und in welchem Unfang die deutsche Einheit in der Vogtlandmetropole noch vor dem Fall der Berliner Mauer gefordert worden ist. Der zweite Unterpunkt des Kapitels beschreibt in ausführlicher Art und Weise die erste Massendemonstration auf dem Gebiet des SED-Staates am 7. Oktober 1989, ehe im dritten Unterpunkt auf die damit verbundenen Auswirkungen eingegangen wird.
Im letzten Hauptteil werden die Ereignisse einer Bewertung unterzogen. Eine Schlussbetrachtung, in der einerseits die behandelte Thematik zusammengefasst und andererseits ein Ausblick über die Wahrung der Geschichte in Plauen gegeben wird, schließt sich dem an.
1.3 Forschungsstand
Der Forschungsstand zu diesem Thema kann als gut eingeschätzt werden. Insbesondere in den verschiedensten Printmedien ist eine Hülle und Fülle an Materialien über die „Wende“ vorzufinden. Besonders die Werke von Thomas Küttler, der in Plauen eine bedeutsame Position in den Wochen des Protestes inne hielt, sind an dieser Stelle hervorzuheben. Er hat sich verdientermaßen nicht nur mit seiner damaligen Rolle, sondern auch - im Nachhinein - mit der Dokumentation und mit der Einschätzung der Ereignisse im Vogtland einen Namen gemacht und ist aus der Historie des der Stadt nicht mehr weg zu denken. Insgesamt betrachtet existiert in Bezug auf die Friedliche Revolution in Plauen mittlerweile zahlreiche, gut recherchierte und qualitativ hochwertige Literatur. An dieser Stelle sind auch die zeitgeschichtlich äußerst wertvollen Zeitzeugenporträts in „Bürgermut macht Politik“, veröffentlicht u.a. von Pit Fiedler und Dietrich Kelterer, sowie das mehrbändige Werk Michael Richters unter dem Namen „Die Friedliche Revolution - Aufbruch zur Demokratie in Sachsen 1989/90“ zu nennen.
2. Plauen als Ausgangspunkt der Friedlichen Revolution 1989/1990 - Ursachen und Gründe
Die Ursachen und Gründe, die der Stadt Plauen ihre Rolle in der Friedlichen Revolution zuteil werden ließen, sind vielseitiger Natur und lassen sich nur schwer ohne einen kurzen Einblick in die Historie der Vogtlandmetropole nachvollziehen. Aus diesem Grund muss der Exkurs zur Jahrtausendwende um 1900 angesetzt werden, als der enorme Aufstieg des kleinen Provinzstädtchens begann.
2.1 Aufstieg und Zerfall einer Stadt
Den enormen Aufstieg Plauens mit einer rasant wachsenden Einwohnerzahl hat die Stadt der Textilproduktion zu verdanken. Insbesondere die „Plauener Spitze“, 1900 zur Weltausstellung in Paris mit dem „Grand Prix“ ausgezeichnet, prägte wie kein anderer Industriezweig das Leben der Bürgerinnen und Bürger in der Vogtlandmetropole. Mit der immer bedeutsamer werdenden Spitzenindustrie schnallte die Population allein zwischen 1904 und 1912 um rund 30.000 Einwohner auf insgesamt 130.000 in die Höhe, das den historischen Höchststand markierte. Der Industriestandort brachte der Stadt Weltruf ein. Noch heute ist die „Plauener Spitze“ als sächsisches Markenprodukt weltbekannt und gilt als Exportschlager Plauens. „Die Stadt Plauen hat [...] einen ungewöhnlichen Aufstieg zur Großstadt genommen und ist seitdem eine politisch bewußte Stadt“[9], schätzte auch Thomas Küttler ein.
Doch nach dem rasanten Aufstieg folgte der ebenso schnelle Abstieg in der Zeit des Nationalsozialismus, der nicht nur zu einer der dunkelsten Geschichten Deutschlands zählt, sondern auch eines der schwärzesten Kapitel der Stadt inmitten des Vogtlandes werden sollte: Rund ein Viertel aller deutschen Panzer wurden in der „VOMAG“, der „Vogtländischen Maschinenfabrik AG“, gefertigt, woraufhin die Stadt zu einem bedeutenden Angriffsziel amerikanischer Bomber geworden ist. 75 Prozent der Stadt wurden zerstört, die einstige industrielle Blüte der Stadt sprichwörtlich in Schutt und Asche gelegt. Auch die Einwohnerzahl der Stadt sank daraufhin dramatisch um ca. 30 Prozent auf rund 80.000 Einwohner ab.
Diese unerwartete Schnelligkeit in dem Prozess war es, die zu starken Spannungen innerhalb der Bevölkerung Plauens führte: Wohlstand, prächtige Gründerzeithäuser und eine aufstrebende Stadt im ersten Fünftel des 20. Jahrhunderts auf der einen Seite, hohe Arbeitslosigkeit, ein großer Anteil nationalsozialistischer Wählerschaften und die damit verbundene Gründung der Hitlerjugend (HJ) in Plauen im zweiten Fünftel des vergangenen Jahrhunderts auf der anderen Seiten zeugen von einer lebendigen Geschichte für eine Stadt dieser Größe. „Deshalb hat Plauen sowohl eine stark kommunistische als auch später nationalsozialistische Wählerschaft gehabt“[10], so Küttler.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Grafik 1[11]: Die historische Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Plauen (eigene Anfertigung) Jahr
2.2 Die besondere geographische Lage Plauens
Auch nach dem Zweiten Weltkrieg und der immensen Zerstörung der Stadt setzte sich der Niedergang der einstigen Metropole weiter unaufhörlich fort. Plötzlich rückte Plauen von der geographischen Mitte Deutschlands mit der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik vom 7. Oktober 1949 an den äußersten Rand eines neu geschaffenen Staates, welches sich durch den Bau der „Berliner Mauer“ 1961 weiter manifestierte. „Der Spiegel“, wenn auch etwas überspitzt, schrieb dazu: „Statt in der Mitte Deutschlands fand sich Plauen nach der Teilung im grenznahen Gebiet wieder. [...] Die elektrifizierte Eisenbahnverbindung endete in Reichenbach, die Autobahn war so kaputt, dass den hoppelnden Trabbis auf dem Weg nach Plauen die Auspuffrohre abfielen. Die Versorgung war schlechter als an vielen anderen Orten des neuen Staats, Bauarbeiter samt Material wurden abgezogen - in die Messestadt Leipzig oder in die ,Hauptstadt der DDR’, wo sächselnde Einkäufer, die nach Ketchup und Ananasdo- sen fragten, hämisch mit ‚ah, Besuch aus der DDR’ begrüßt wurden.“[12] „Dennoch“, so verdeutlichte Thomas Küttler, „behielt die Stadt ein geradezu großstädtisches Flair und ein gesundes Selbstbewusstsein“[13]. Doch die Menschen, die in der „Spitzenstadt“ beheimatet waren, fühlten sich in der DDR stark benachteiligt. Im Bezirk Karl-Marx-Stadt galt man hinter den beiden größeren Städten Karl-Marx-Stadt und Zwickau nur als dritte Kraft, aus der sich ein gewisses politisch-rebellisches Potential ergab.[14] Dies verdeutlichte sich einerseits an der sprunghaft ansteigenden Anzahl der Ausreiseanträge in den Monaten und Jahren vor der beginnenden Friedlichen Revolution.[15] Mehr als 2.000 Plauener stellten in der ersten Jahreshälfte 1989 einen solchen Antrag. Auf der anderen Seite glänzte die Stadt Plauen bei den Kommunalwahlen im Mai 1989 mit dem DDR-weit schlechtesten (und dennoch gefälschten) Wahlergebnis von 96,2 Prozent bei einer (offiziellen) Wahlbeteiligung von 98,1 Prozent.[16]
[...]
[1] Berg, Stefan: Gedenken. Die unbemerkten Helden, in: Der Spiegel, 30 (2009), S. 44.
[2] Küttler, Thomas: Die Wende in Plauen, in: Fischer, Alexander/Heydemann, Günther (Hrsg.): Die politische „Wende“ 1989/90 in Sachsen. Rückblick und Zwischenbilanz, Weimar u.a. 1995, S. 147.
[3] Berg, Stefan: S. 45.
[4] Ebd.
[5] Freie Presse vom 09. Oktober 1989, in: Küttler, Thomas/Röder, Jean Curt: Es war das Volk. Die Wende in Plauen - Eine Dokumentation, Plauen 1993, S. 39.
[6] Vgl. ebd.
[7] Ebd.
[8] Prof. Dr. Biedenkopf, Kurt: Geleitwort, in: Ebd., S. 3.
[9] Küttler, Thomas: Die Wende in Plauen , S. 147.
[10] Ebd.
[11] Eigene Grafik. Verwendete Werte als Auflistung der Stadt Plauen: Bevölkerungsentwicklung der Stadt Plauen, online einsehbar unter http://www.plauen.de/pitcms/.plauen/hauptordner1/e1_o1/e2_o2/e3_o6/nav.htm, zuletzt abgerufen am 15. September 2010.
[12] Berg, Stefan: S. 44.
[13] Küttler, Thomas: Die Wende in Plauen , S. 147.
[14] Vgl. ebd.
[15] Vgl. Berg, Stefan: S. 45.
[16] Vgl. Richter, Michael: Die friedliche Revolution. Aufbruch zur Demokratie in Sachsen 1989/90, 1. Auflage, Göttingen 2009, S. 111.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt Plauen als Ausgangspunkt der Friedlichen Revolution?
Am 7. Oktober 1989 fand in Plauen die erste Großdemonstration auf dem Gebiet der DDR statt, bei der die Staatsmacht zum ersten Mal dem friedlichen Protest der Bürger weichen musste.
Was geschah am 7. Oktober 1989 in Plauen?
Rund 15.000 Menschen demonstrierten mutig gegen das SED-Regime. Trotz des Einsatzes von Wasserwerfern und Drohungen blieb der Protest friedlich und zwang die Führung zum Dialog.
Warum ist Plauen weniger bekannt als Leipzig?
Die Demonstration in Plauen fand weitgehend unter Ausschluss der Weltöffentlichkeit statt; es gab kaum Fernsehbilder, weshalb Leipzig mit den Montagsdemonstrationen medial präsenter wurde.
Welche Rolle spielte die geographische Lage Plauens?
Die Randlage im Vogtland nahe der Grenze zur Bundesrepublik und die Erfahrungen mit den Zügen der Prager Botschaftsflüchtlinge verstärkten den Willen der Bürger zur Veränderung.
Wer war Thomas Küttler?
Thomas Küttler war der Superintendent in Plauen, der am 7. Oktober 1989 als Vermittler zwischen den Demonstranten und der Staatsmacht auftrat und maßgeblich zur Friedlichkeit beitrug.
- Quote paper
- B.A. Eric Holtschke (Author), 2010, Die Rolle Plauens in der Wende und der Friedlichen Revolution des Herbstes 1989, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209831