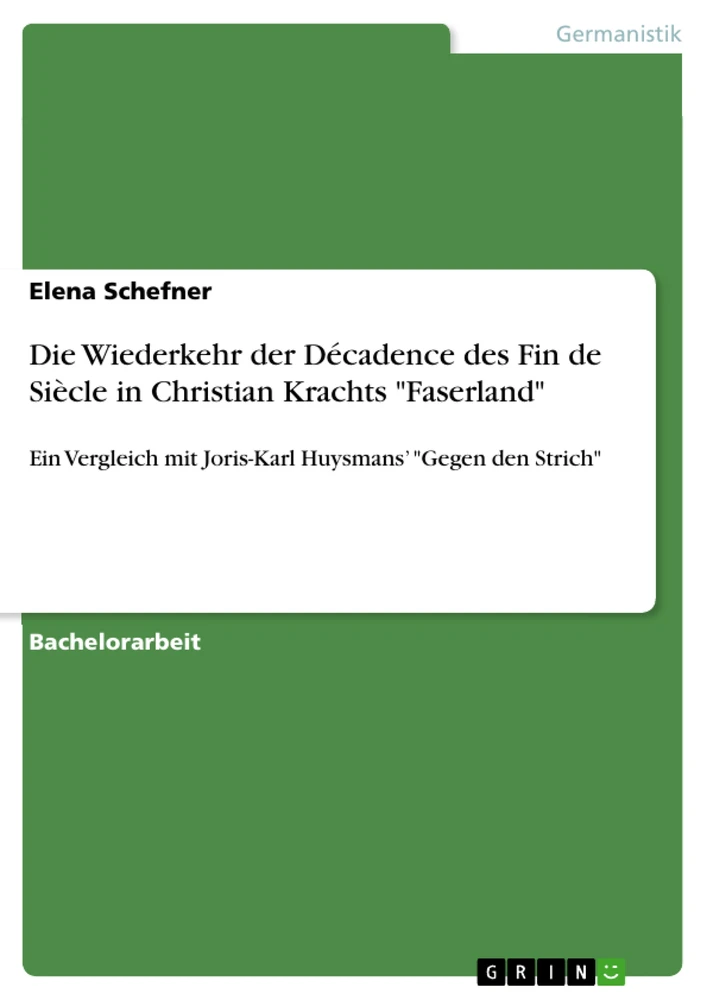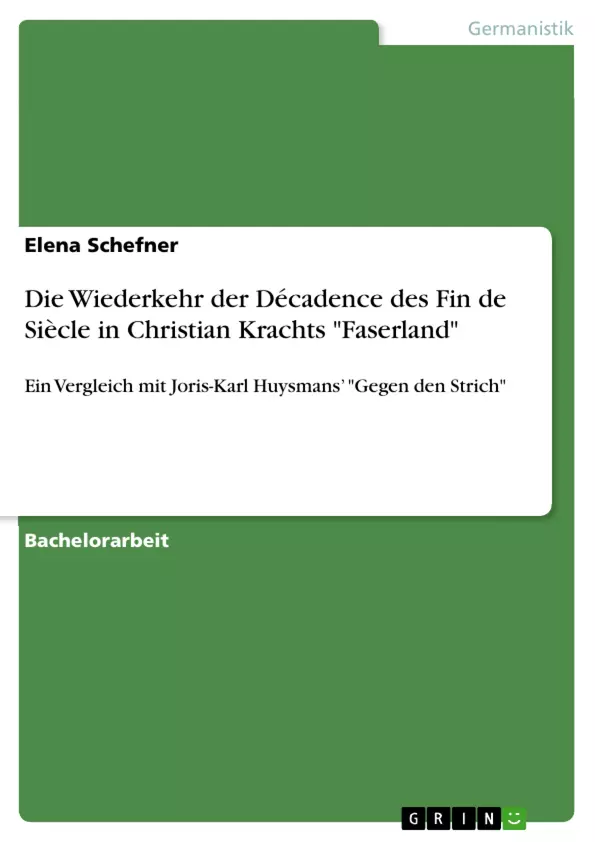„How to be a dandy in the age of mass culture?“ - Diese Frage stellte sich Susan Sontag bereits 1964 in ihrem Aufsatz "Notes on 'Camp'", in dem sie diskutiert, wie es im Zeitalter der sich zunehmend verbreitenden Popkultur noch den klassischen Dandy des Fin de Siècle geben kann. Die so genannten Pop-Autoren der 1990er Jahre, wie Christian Kracht, haben auf diese Frage scheinbar eine Antwort gefunden. Wie ist es sonst zu erklären, dass sie sowohl in den Feuilletons der deutschen Presse als auch von Literaturwissenschaftlern als dekadente Dandys betitelt wurden? So urteilte Iris Radisch 1999 in der ZEIT, die „jungen Herren“ seien „Dandys der Popmoderne“, die „Literatur und Lebensstil zur Deckung bringen wollen“. Und Johannes Ullmaier bezeichnet in seinem Abriss der Geschichte der deutschen Popliteratur "Von Acid nach Adlon und zurück" nicht nur Krachts "Faserland" als „Auftaktwerk und eigentliches Manifest der Markendandy-Literatur“, sondern auch den Text "Tristesse Royale", der auf einer Gesprächsrunde des „popkulturellen Quintetts“ im Berliner Luxushotel Adlon basiert, als „Ausgrabung noch weit älterer Fin-de-siècle-Erlebnissehnsüchte“. Die Verbindung zwischen Popliteratur und der Décadence um 1900 wurde also in erster Linie durch das dandyhafte Erscheinungsbild der Pop-Autoren hervorgerufen. Durch ihr dekadentes Auftreten und ihre ästhetizistischen Prinzipien schienen sie eine Assoziation mit der Décadence des Fin de Siècle geradezu zu provozieren. Doch vollzog sich die scheinbare Wiederkehr der Décadence auch in den Werken der Autoren?
Mit dieser Frage beschäftigt sich die vorliegende Arbeit. Anhand des Vergleiches von Christian Krachts "Faserland" (1995) mit Joris-Karl Huysmans’ "Gegen den Strich" (1884) wird untersucht, ob und auf welche Weise sich die Motive der Décadence in der Popliteratur wiederholen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die literarische Décadence um 1900
- Eine Literaturströmung des Fin de Siècle
- Kennzeichen und Motive
- Ennui
- Lebensferne und Isolierung
- Ästhetizismus
- Die Figur des Dandys
- Joris-Karl Huysmans: Gegen den Strich
- Die Bibel der Décadence
- Huysmans und Des Esseintes
- Popliteratur um 2000
- Entwicklung und Definition
- Kennzeichen und Motive des Pop-Romans
- Popliteratur – ein Phänomen der Spaßgesellschaft?
- Tristesse Royale
- Ennui
- Ästhetizismus
- Der Dandy – mediale Selbstinszenierung oder literarische Figur?
- Christian Kracht: Faserland
- Gründungsroman der Popliteratur
- Kracht und sein Ich-Erzähler
- Vergleich von Gegen den Strich und Faserland
- Inhaltliche Parallelen
- Gemeinsame Motive
- Ennui und Lebensferne
- Ästhetizismus als Weltflucht
- Das Dandy-Motiv
- Die Décadence: ein Jahrhundertwendephänomen?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Frage, ob und inwiefern sich die Motive der Décadence in der Popliteratur der 1990er Jahre wiederholen. Anhand des Vergleiches von Christian Krachts Faserland (1995) mit Joris-Karl Huysmans' Gegen den Strich (1884) wird analysiert, welche literarischen Motive die Thematik der Dekadenz in den beiden Romanen prägen. Die Arbeit beleuchtet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Werke und ergründet, wie es zu einer scheinbaren Wiederkehr der Décadence fast 100 Jahre nach dem Fin de Siècle kommen konnte.
- Die literarische Décadence um 1900
- Die Entwicklung und Definition der Popliteratur
- Die Dekadenzmotive in Gegen den Strich und Faserland
- Die Wiederkehr der Décadence in der Popliteratur
- Der Dandy als Figur der Dekadenz
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der literarischen Décadence um 1900. Es werden die Ursachen und Kennzeichen dieser Strömung sowie die zentralen Motive wie Ennui, Lebensferne und Ästhetizismus erläutert. Das Kapitel beleuchtet auch die Figur des Dandys als Prototyp der dekadenten Lebenshaltung.
Im zweiten Kapitel wird die Popliteratur um 2000 vorgestellt. Es wird auf die Entwicklung und Definition des Begriffs sowie auf die spezifischen Kennzeichen und Motive dieser Strömung eingegangen. Zudem werden die gesellschaftlichen Hintergründe der Popliteratur analysiert, wobei das Werk Tristesse Royale eine besondere Rolle spielt.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Vergleich von Gegen den Strich und Faserland. Es werden die inhaltlichen Parallelen und gemeinsamen Motive der beiden Romane herausgearbeitet und untersucht, inwiefern es sich um eine Wiederkehr der Décadence handelt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Décadence, Fin de Siècle, Popliteratur, Dandy, Ennui, Ästhetizismus, Lebensferne, Gegen den Strich, Faserland, Tristesse Royale.
Häufig gestellte Fragen
Was verbindet Christian Krachts "Faserland" mit der Décadence?
Zentrale Motive wie Ennui (Langeweile), Ästhetizismus als Weltflucht und die Figur des Dandys finden sich in beiden Strömungen wieder.
Wer ist der Prototyp des dekadenten Helden?
Des Esseintes aus Joris-Karl Huysmans' "Gegen den Strich" gilt als die "Bibel der Décadence" und Vorbild für spätere Dandy-Figuren.
Was charakterisiert einen "Pop-Dandy" der 1990er Jahre?
Er definiert sich über Marken, Oberflächlichkeit und eine mediale Selbstinszenierung, die Lebensstil und Literatur verschmelzen lässt.
Was bedeutet "Ennui" im Kontext der Popliteratur?
Es beschreibt eine existenzielle Langeweile und Überdruss an der Konsumgesellschaft, trotz (oder wegen) des materiellen Überflusses.
Ist Popliteratur nur ein Phänomen der Spaßgesellschaft?
Obwohl oft so betitelt, zeigt der Vergleich mit der Décadence eine tiefere Melancholie und eine Suche nach ästhetischer Distanz zur Realität.
- Quote paper
- Elena Schefner (Author), 2011, Die Wiederkehr der Décadence des Fin de Siècle in Christian Krachts "Faserland", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209879