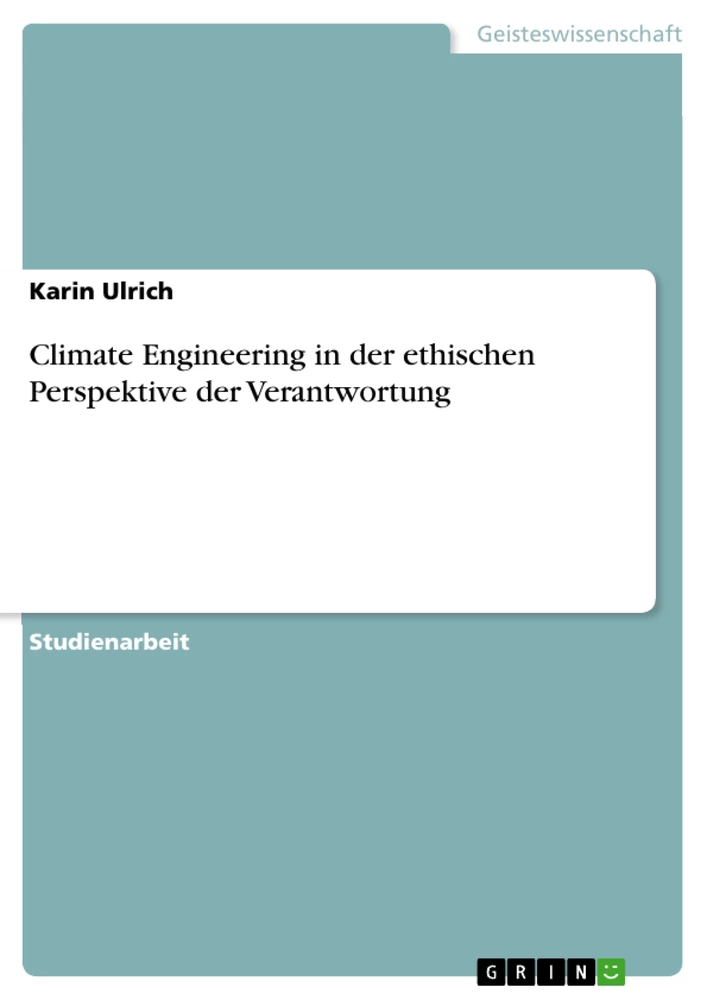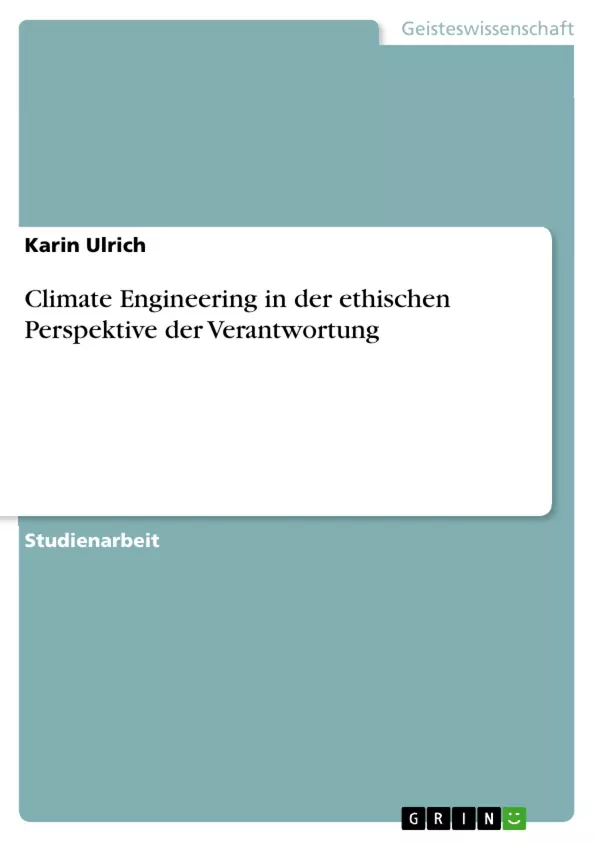Dass der Klimawandel ein globales Problem darstellt, welches durch menschliche Aktivitäten (Verbrennung fossiler Energieträger, Waldvernichtung, etc.) mitverursacht wird, wirft eine ganze Reihe moralischer Fragen auf. Wer heute über Klimawandel sprechen will, darf diese Fragen nicht ausblenden. Dazu äußerst sich vorrangig der deutsche Umweltethiker Konrad Ott folgendermaßen: „Grund genug, heißt es jetzt vor allem in den USA, das drängende Problem des Klimawandels allein mit Hilfe planvoll eingesetzter Technologie zu lösen“ , die allesamt unter dem Begriff des Geo-Engineering bzw. Climate Engineering (CE) gefasst werden. „Geo-Engineering wird gesellschaftsfähig“, so Konrad Ott, „aber welche Methoden wären auch ethisch zulässig?“ Diese Fragestellung gilt es nun u.a. zu klären.
Unter Geo-Engineering werden Techniken zusammengefasst, die den Kohlenstoffkreislauf beeinflussen oder die planetarische Strahlungsbilanz manipulieren. In Anlehnung an Konrad Ott, der das Solar Radiation Management (SRM) als die eigentliche ethische Herausforderung betrachtet, und dort im Besonderen mögliche Argumentationslinien zur Sulfatoption kartiert, möchte ich meine weiteren Ausführungen ebenso darauf richten.
Mit der vorliegenden Arbeit unternehme ich den Versuch die ethische Perspektive der Verantwortung, bezogen auf den Klimawandel und primär auf die oben genannte Strategie des Solar Radiation Managements, zu klären und zu begründen. Diese Art von globaler Problemstellung verlangt nach einer Zukunftsverantwortung und muss neue ethische Diskurse auslösen. Der Grund für die Entwicklung einer neuen Dimension ethischen Denkens ist wohl dem technischen Fortschritt des Menschen zuzuschreiben, sodass der Philosoph Hans Jonas erst einmal mit Recht feststellt, dass viele Probleme erst durch die Technik entstanden seien.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Sulfataerosole als Geo-Engineering-Option
2.1. Bedenken
3. Das „Prinzip Verantwortung“ – Ruf einer neuen Ethik
3.1. Anforderungen an die neue Ethik
3.1.1. Der neue Imperativ
3.2. Die Ethik der Verantwortung aus der Furcht
4. Anwendung der neuen Ethik
4.1. Verantwortungsethik, Moralbegründung und Zukunftsverantwortung
4.2. Kritische Auseinandersetzung mit dem ethischen Problem der Zukunftsverantwortung
5. Schlussbetrachtung
Quellenverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist Climate Engineering (Geo-Engineering)?
Es umfasst technologische Ansätze, die gezielt in das Klimasystem eingreifen, um die Erderwärmung zu bremsen, etwa durch Beeinflussung des Kohlenstoffkreislaufs oder der Sonnenstrahlung.
Was versteht man unter Solar Radiation Management (SRM)?
SRM ist eine Technik, bei der die Sonneneinstrahlung manipuliert wird, beispielsweise durch das Ausbringen von Sulfataerosolen in die Atmosphäre, um das Sonnenlicht zu reflektieren.
Wer ist Konrad Ott und was ist seine Position zu Geo-Engineering?
Konrad Ott ist ein deutscher Umweltethiker, der die ethische Zulässigkeit dieser Methoden hinterfragt und SRM als besondere Herausforderung kartiert.
Was besagt das „Prinzip Verantwortung“ von Hans Jonas?
Jonas fordert eine neue Ethik, die die langfristigen Folgen technischer Eingriffe für künftige Generationen berücksichtigt und zur Vorsicht mahnt.
Welche ethischen Bedenken gibt es bei Sulfataerosolen?
Bedenken betreffen unvorhersehbare Nebenwirkungen auf das Ökosystem, die politische Kontrolle solcher globalen Eingriffe und die moralische Verantwortung gegenüber der Zukunft.
- Quote paper
- Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtschaftsing. Karin Ulrich (Author), 2013, Climate Engineering in der ethischen Perspektive der Verantwortung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209948