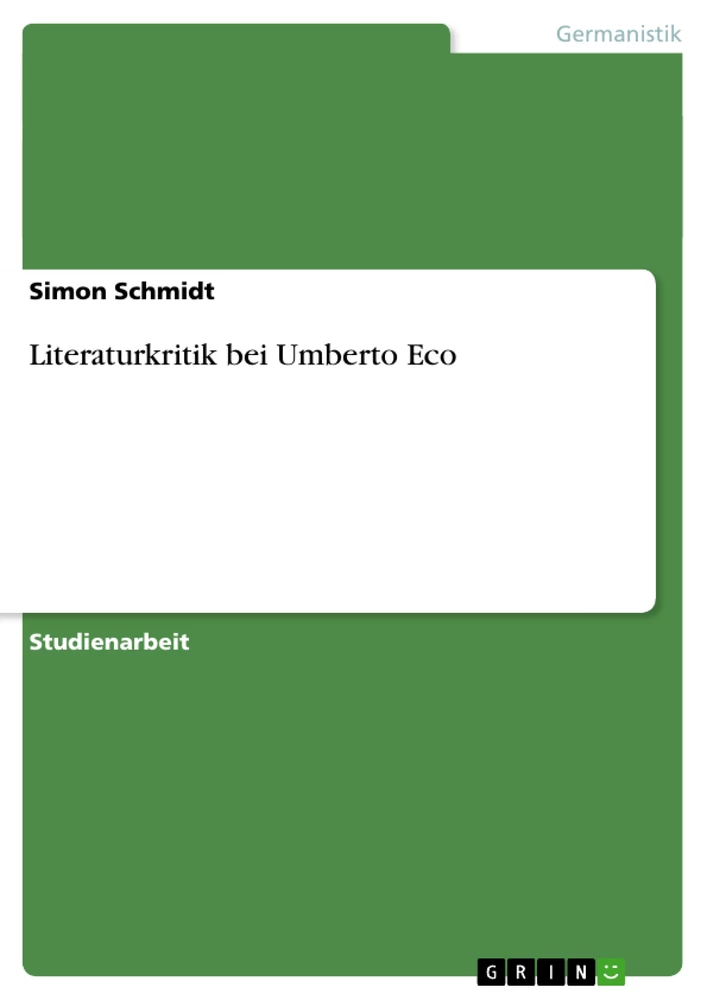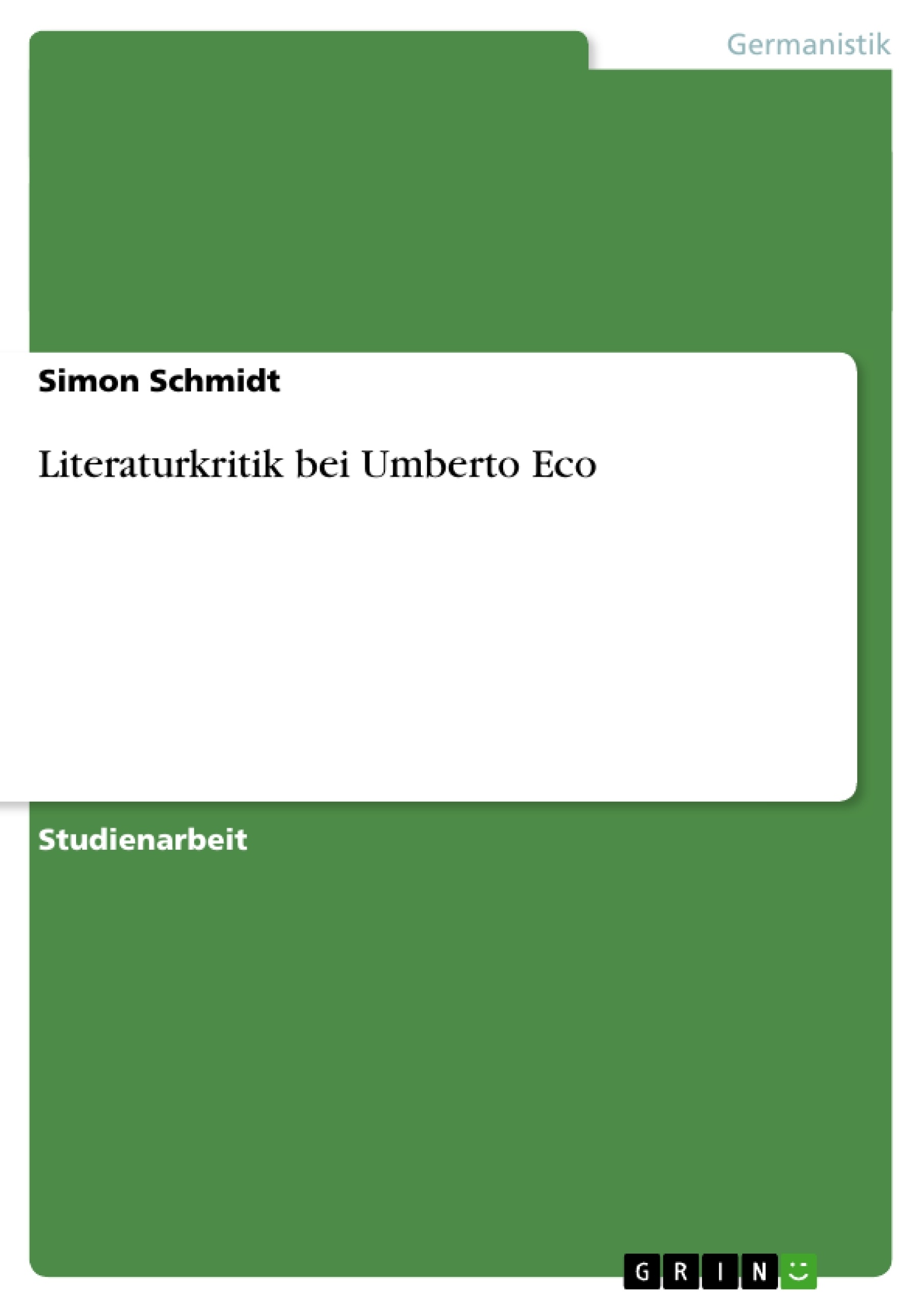Der deutsche Buchmarkt erfährt in den letzten Jahren eine stetige Expansion. Zwar ist die Zahl der „echten“ Buchpremieren gesunken, die Gesamtzahl der erschienenen Titel (Erst- und Neuauflagen) ist aber weiter gestiegen. 2011 konnten 96.273 Novitäten verzeichnet werden. Eine Folge davon ist, dass sich der deutsche Buchmarkt in einer Überproduktionskrise befindet, was zu einem hohen und immer schnelleren Umschlag der Literatur führt. Der Zielgruppe der zugeneigten Leserschaft werden in immer kürzeren Abständen immer mehr Bücher präsentiert, was im Umkehrschluss bedeutet, dass jedes Buch ein immer kleineres Zeitfenster zur Verfügung hat, um die Aufmerksamkeit des Lesers zu erhalten. Im Rahmen des Seminars „Neuerscheinungen der Frankfurter Buchmesse 2011“ beschäftige ich mich in dieser Hausarbeit mit der Frage, was unter zeitgenössischer Literaturkritik zu verstehen ist und wie diese dem Leser bzw. Rezipienten helfen kann, die für ihn passende Literatur auszuwählen.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Zeitgenössische Literaturkritik
3 Der Literaturkritiker
4 Umberto Eco
5 Fazit und Ausblick
I Anhang
II Quellenverzeichnis
a. Literaturverzeichnis
b. Rezensionen
1 Einleitung
Der deutsche Buchmarkt erfährt in den letzten Jahren eine stetige Expansion. Zwar ist die Zahl der „echten“ Buchpremieren gesunken, die Gesamtzahl der erschienenen Titel (Erstund Neuauflagen) ist aber weiter gestiegen. 2011 konnten 96.273 Novitäten verzeichnet werden.[1] Eine Folge davon ist, dass sich der deutsche Buchmarkt in einer Überproduktionskrise befindet, was zu einem hohen und immer schnelleren Umschlag der Literatur führt.[2] Der Zielgruppe der zugeneigten Leserschaft werden in immer kürzeren Abständen immer mehr Bücher präsentiert, was im Umkehrschluss bedeutet, dass jedes Buch ein immer kleineres Zeitfenster zur Verfügung hat, um die Aufmerksamkeit des Lesers zu erhalten.
Im Rahmen des Seminars „Neuerscheinungen der Frankfurter Buchmesse 2011“ beschäftige ich mich in dieser Hausarbeit mit der Frage, was unter zeitgenössischer Literaturkritik zu verstehen ist und wie diese dem Leser bzw. Rezipienten helfen kann, die für ihn passende Literatur auszuwählen.
Im ersten Teil wird zunächst betrachtet, welche Methoden und Vorgehensweisen von Literaturkritikern genutzt werden, um mit aktueller Literatur umzugehen. Sind Literaturkritiken für den Rezipienten hilfreich, um gute von schlechter Literatur zu unterscheiden oder manipulieren sie bloß das Kaufverhalten der Leser? Welchen Ansprüchen müssen Kritiken genügen und können sie Orientierungshilfen geben?
Im zweiten Teil werden Rezensionen von dem im Seminar behandelten Buch „Umberto Eco - Der Friedhof in Prag“[3] betrachtet und verschiedene Positionen von Kritikern herausgearbeitet, um auf der Grundlage des ersten Teils Rückschlüsse auf die Arbeitsweise der Literaturkritiker ziehen zu können. Welches Bild wird von Umberto Eco gezeichnet? Sind die Kritiken verkaufsfördernd oder unsachlich? Lassen sich Ziele oder Absichten in den Rezensionen erkennen?
Zur Vereinfachung wird im Folgenden generell das generische Maskulinum verwendet. Als Rezipient wird der potenzielle Konsument der Literatur verstanden.
2 Zeitgenössische Literaturkritik
„Unter die größten Entdeckungen, auf die der menschliche Verstand in der neuesten Zeit gefallen ist, gehört meiner Meinung nach wohl die Kunst, Bücher zu beurteilen, ohne sie gelesen zu haben. “ Georg Christoph Lichtenberg (*1742; f1799)
Bevor nun Literaturkritik und ihre Wirkung untersucht wird, bedarf es einer allgemeinen Begriffsdefinition. Schuhmann und Träger bestimmen 1986 Literaturkritik als einzelne Werk-Besprechung sowie als Institution der literarischen Öffentlichkeit und des literarischen Lebens, die die Literaturverhältnisse eines Landes mitgestaltet.[4] „Diese Definition verweist auf den Gegenstand der Literaturkritik, das einzelne Sprachkunstwerk, und auf die gesellschaftliche Funktion der Literaturkritik im öffentlichen Leben einer Gesellschaft, die ihre Spezifik gegenüber anderen literaturwissenschaftlichen Teildisziplinen (Literaturtheorie, Literatursoziologie, Poetologie, Literaturgeschichtsschreibung u.a.) deutlich werden lässt.“[5] Die Literaturkritik gilt allgemein als philologische Teildisziplin der Literaturwissenschaft und stellt im deutschen Sprachraum eine journalistische Rezensionstätigkeit dar, die sich - im Gegensatz zur akademischen, historisch orientierten Kritik - vorwiegend auf die Literatur der Gegenwart konzentriert.[6]
Die Literaturkritik greift als Institution der literarischen Öffentlichkeit in die vielgestaltigen und widerspruchsvollen Prozesse der Auseinandersetzung mit der literarischen Kunst ein. Der gesellschaftliche Stellenwert und der Aufgabenbereich der Literaturkritik sind historisch-konkret, das heißt durch die jeweilige Gesellschaftsformation und deren Entwicklungsstand begründet. Die Literaturkritik übernimmt auch einen Teil der Verantwortung für die Entfaltung des literarischen Lebens in der Gesellschaft, für die Rezeption des literarischen Erbes sowie für die Entwicklung und Ausprägung ästhetischer, moralischer Wertvorstellungen.[7]
Bereits 1966 differenziert Hough die Literaturkritik in zwei grundsätzliche Verfahrensweisen. Zum einen besteht die Aufgabe in der Aufhellung von Verständnisschwierigkeiten, das heißt in der Erklärung schwieriger Vokabeln, Redewendungen oder syntaktischen Formen, während das zweite Verfahren in jedem literarischen Text einen verborgenen Sinn sieht, der durch die Aufhellung sprachlicher Schwierigkeiten allein noch nicht zutage tritt, sondern vom Kritiker mit besonderen Methoden herauspräpartiert werden muss, wobei es notwendigerweise zu Werturteilen kommt.[8]
Abrams unterteilt 1971 die Kritik in vier Arten, wobei jeweils ein bestimmter Bezugspunkt auschlaggebend ist:
1. Realität: Mimetische Kritik, die den Text an seinem Wahrheitsgehalt in Relation zur Wirklichkeit misst.
2. Autor: Expressive Kritik, die sich auf die psychische Konstellation des Autors konzentriert.
3. Text: Objektive Kritik, die den Text als autonomes Gebilde betrachtet.
4. Rezipient: Pragmatische Kritik, die den Text von Wirkungsabsicht und Rezeption her untersucht.[9]
„Die Literaturkritik schafft dem Buch Öffentlichkeit.“[10]
Walter Hinck (*1922)
Literaturkritik ist öffentliche Kommunikation über Literatur. Ein Ziel der Literaturkritik ist es, dem Leser einen Zugang zu Belletristik und Sachbüchern zu vermitteln. Diese publizistische Verarbeitungsform von Literatur führt zu einer Differenzierung zwischen Literaturkritik und Literaturwissenschaft.[11] Literaturkritik tritt dabei in verschiedenen Formen auf, wobei die klassische Rezension die häufigste Form ist. Weitere übliche Textformen sind das Essay, das Porträt, das Interview, die Reportage, das Feature, der Kommentar, die Glosse und das Literaturgespräch. In den letzten Jahren hat sich eine weitere Form der Literaturkritik etabliert, die aufgrund des multimedialen Fortschritts in Form des Internets entstanden ist. Diese Internetkritiken, wie sie beispielsweise auf der Versandhandelsseite „Amazon“ zu finden sind, werden von Laien geschrieben, die interessierten und potenzi- ellen Lesern eines Buches ihre persönlichen Leseerfahrungen mitteilen.[12] Im zweiten Abschnitt werden einige Rezensionen über „Der Friedhof in Prag“ von dieser Seite exemplarisch dargestellt. Nachdem nun eine erste Definition von Literaturkritik Überblick über das Aufgabengebiet gegeben hat, soll nun der Hauptakteur dieses Fachgebietes betrachtet werden:
3 Der Literaturkritiker
Die Komplexität der Aufgabenstellung für die Literaturkritik und ihre damit verbundene gesellschaftliche Verantwortung, sowie dem Streben nach einer hohen Qualität literaturkritischer Aussagen veranlasst Literaturwissenschaftler, Kritiker und Schriftsteller immer wieder über Grundanforderungen an die Literaturkritik nachzudenken.
„Die Anforderungen an die Tätigkeit des Literaturkritikers resultieren aus den Aufgaben, die dem Literatur- und Kunstkritiker in einer bestimmten Gesellschaftsformation zukommen. Als eine angewandte gesellschaftswissenschaftliche Teildisziplin erfüllt die Literaturkritik eine wichtige kulturpolitische Funktion im geistig-kulturellen Leben einer Gesellschaft.“[13] Da der Beruf des „Literaturkritikers“ keine Ausbildung oder spezielles Studium voraussetzt und somit theoretisch von jeder Person ausgeübt werden kann, kommt die Frage auf, welche Maßstäbe zur Einordnung von Kritiken gesetzt werden, um gute von schlechten zu unterscheiden und welche Wirkung auf Rezipienten damit erzielt wird. Besteht ein Unterschied in der Akzeptanz von Kritiken, wenn der Autor bereits bekannt ist - wie bspw. Marcel Reich-Ranicki, Elke Heidenreich oder Hellmuth Karasek - oder der Verfasser einer Rezension dem Rezipienten völlig unbekannt ist?
Einen Kritiker kann man also nicht nach vorhandenen Kriterien definieren, da es keine fest definierten Voraussetzungen für einen Kritiker gibt. Nach Baumgart (2002) gibt es jedoch wichtigen Eigenschaften wie kritische Neugier, kritisches Temperament und Reaktionsbereitschaft, die einem Kritiker unterstellt werden können oder müssen. Hinzu kommen erlernbare theoretische Fähigkeiten wie Schreibtraining, Lektüre und Analyse fremder Kritiken und umfangreiche Kenntnisse über die Geschichte der Kritik.[14] Kritik bedeutet nach Hinck in erster Linie Wertung. Dabei ist eine Kritik niemals frei von dem Einfluss anderer Wertungen und beinhaltet selbst bei einer Rezension über ein neu
[...]
[1] Vgl.: http://www.boersenverein.de/de/182717. (letzter Zugriff: 30.12.2012)
[2] Vgl.: Löffler, 2003, S.13.
[3] Vgl.: Eco, 2011.
[4] Vgl.: Schumann/Träger, 1986, S.305.
[5] Klauser, 1992, S. 32.
[6] Vgl.: Winter, 1975, S. 13.
[7] Vgl.: Klauser, 1992, S. 32f.
[8] Vgl.: Winter, 1975, S. 13.
[9] Vgl.: Ebd.
[10] Hink, 1983, S.15.
[11] Rokosz, 2009, S.11.
[12] Rokosz, 2009, S.12.
[13] Klauser, 1992, S. 37.
[14] Vgl.: Baumgart, 2002, S.162f.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel zeitgenössischer Literaturkritik?
Sie dient als Orientierungshilfe für Leser, um aus der Überproduktion des Buchmarktes passende Literatur auszuwählen und Werke ästhetisch einzuordnen.
Wie bewerten Kritiker Umberto Ecos Werk „Der Friedhof in Prag“?
Die Arbeit analysiert verschiedene Rezensionen und untersucht, ob diese sachlich fundiert, verkaufsfördernd oder eher kritisch gegenüber Eco eingestellt sind.
Was unterscheidet professionelle Kritik von Internetrezensionen?
Professionelle Kritik nutzt philologische Methoden und journalistische Formen, während Internetkritiken (z. B. auf Amazon) oft subjektive Leseerfahrungen von Laien sind.
Welche Arten der Literaturkritik gibt es nach Abrams?
Abrams unterscheidet mimetische (Realität), expressive (Autor), objektive (Text) und pragmatische (Rezipient) Kritik.
Können Literaturkritiken das Kaufverhalten manipulieren?
Ja, Kritiken schaffen Öffentlichkeit für ein Buch und können durch positive oder negative Wertungen den kommerziellen Erfolg maßgeblich beeinflussen.
- Arbeit zitieren
- Simon Schmidt (Autor:in), 2013, Literaturkritik bei Umberto Eco, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209951