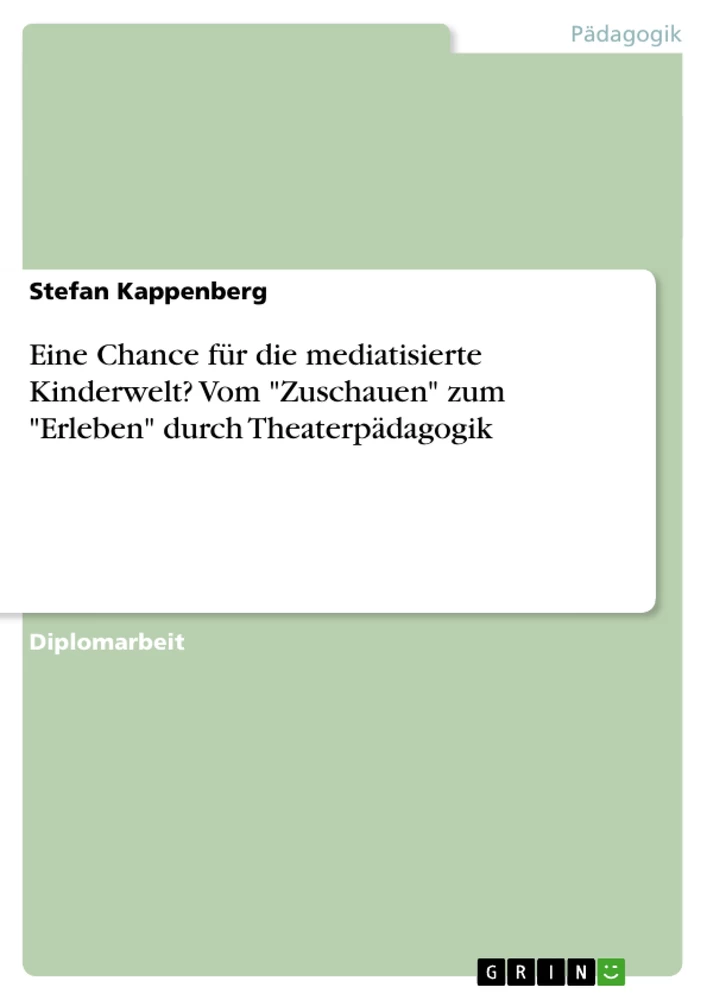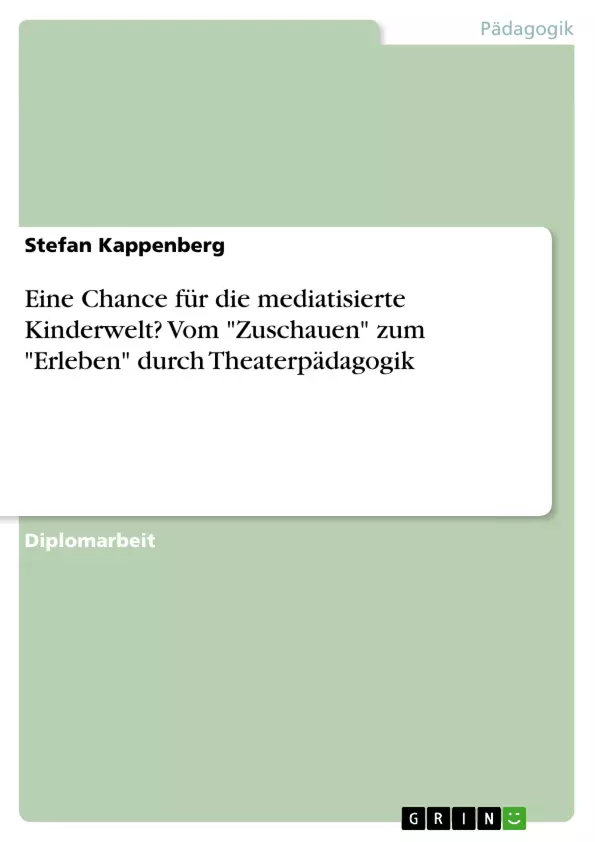Schon vor mehr als zehn Jahren wiesen amerikanische Pädagogen auf die bedrohlichen Auswirkungen des Fernsehkonsums auf das Familienleben und die Entwicklung von Kindern hin. In Deutschland wurde die Aufforderung dieser Wissenschaftler zum „sofortigen Abschalten“ zwar zur Kenntnis genommen, doch bestimmte sie nicht die fachliche Diskussion. Das lag einerseits daran, dass sich die Fernsehgewohnheiten amerikanischer Familien nicht auf deutsche Verhältnisse übertragen ließen; andererseits stand den extremen amerikanischen Positionen eine Vielzahl wissenschaftlicher Studien gegenüber, die von der Ungefährlichkeit und der eher förderlichen Wirkung des Fernsehens sprachen.
In den folgenden Jahren beschäftigte sich die Forschung vor allem mit der Fernsehdauer und der Wirkungsweise bestimmter Inhalte von Fernsehsendungen.
Seit geraumer Zeit jedoch haben sich Pädagogen, Soziologen und Medienwissenschaftler mehr und mehr der Frage zugewandt, welchen Einfluss das Fernsehen auf die Wirklichkeitskonstruktion von Kindern hat.
In dieser Arbeit möchte ich darstellen, in welcher Weise das Leitmedium Fernsehen die Entwicklung von Kindern beeinflusst und welche Möglichkeiten der Kompensation theaterpädagogische Arbeit in einem veränderten Sozialisationsprozess bieten kann.
Sicherlich ist es äußerst schwierig, eindeutige Kausalzusammenhänge herzustellen zwischen dem Fernsehen und seiner Wirkungsweise auf den Zuschauer, da es sich hierbei um sehr komplexe Wirkungszusammenhänge mit vielen unbekannten Variablen handelt. Nicht nur Alter, Fernsehdauer oder soziales Umfeld haben ihre Bedeutung, sondern auch die emotionale Disposition oder persönliche Erwartungshaltungen, die jedoch nie genau erfasst werden können. Wichtiger noch scheint die Frage, was Pädagogen den aufregenden und schnellen Bildern des Fernsehens noch entgegenzusetzen haben. Müssen sie überhaupt konkurieren oder geht es eher um die Vermittlung entgegengesetzte Werte? Welche kompensatorische Wirkung kann insbesondere die Theaterpädagogik in diesem Zusammenhang entfalten, um einer möglichen körperlichen und geistigen Entfremdung bei den Heranwachsenden entgegenzuwirken. Diesen Fragen widmet sich die Arbeit im zweiten Teil.
Inhaltsverzeichnis
- I Vom „Zuschauen“ zum „Erleben\" durch Theaterpädagogik
- 1 Einleitung
- 2 Sozialisierung im Medienzeitalter
- 2.1 Familie und Kindheit
- 2.2 Freizeitverhalten
- 2.3 Medien- und Konsumwelt
- 2.4 Stellenwert des Fernsehens
- 3 Auswirkungen der zunehmenden Mediatisierung
- 3.1 Erfahrungswelt
- 3.2 Verbale Kommunikation
- 3.3 Aggressionsbereitschaft
- 3.4 Realitätsverlust
- 3.5 Weitere Wirkungsbereiche
- 3.5.1 Reizüberflutung
- 3.5.2 Gesundheitliche Beeinträchtigungen
- 3.5.3 Verlust der Kindheit
- 3.5.4 An-Ästhetisierung
- 4 Theaterpädagogik und Schule
- 4.1 Grundziele der Theaterpädagogik
- 4.2 Theaterpädagogik im Darstellenden Spiel
- 4.3 Weitere Einsatzbereiche in der Schule
- 4.3.1 Der Wahlpflichtbereich
- 4.3.2 Die Theater AG
- 4.3.3 Die Tutorenstunde
- 4.3.4 Darstellendes Spiel in anderen Fächern
- 4.3.5 Darstellendes Spiel und Kooperation mit anderen Fächern
- 4.3.6 Zusammenarbeit mit professionellen Bühnen
- 4.4 Theaterpädagogik und ihre kompensatorische Wirkung
- 5 Die unfassbare Kraft der Ästhetik
- 5.1 Funktion der Ästhetik aus Sicht der Postmoderne
- 5.2 Ästhetik im Alltag
- 5.3 Ästhetische Bildung im Theaterspiel
- 6 Schlussbetrachtung
- II Theaterpädagogik in der Praxis
- 7 Reflexion der Eigeninszenierung
- 7.1 Einleitung
- 7.2 Die Gruppe
- 7.2.1 Anspruch
- 7.2.2 Wirklichkeit
- 7.3 Probenarbeit
- 7.3.1 Kurz-Übersicht
- 7.3.2 Konzentrationsprobleme
- 7.3.3 Spielleiterhaltung
- 7.3.4 Idee und Entwicklung des Stückes
- 7.3.5 Die Stückvorlage
- 7.3.6 Stationen der Inszenierungsarbeit
- 7.4 Auswertung
- 7.4.1 Bedingungen schulischer Theaterarbeit
- 7.4.2 Psychosoziale Aspekte des Projektes
- 8 Mediales Theater in der Schule
- 8.1 Einleitung
- 8.2 Gestaltung des Aktionsraumes
- 8.2.1 Einsatz des Fernsehers
- 8.2.2 Die Großbildprojektion
- 8.2.3 Die Computeranimation
- 8.3 Film oder Theater?
- 8.4 Eigeninszenierung und mediale Unterstützung
- 8.5 Vorraussetzungen
- 9 Schlussbetrachtung
- III Vom „,Zuschauen“ zum „Erleben\" durch Theaterpädagogik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit dem Einfluss des Fernsehens auf die Entwicklung von Kindern und untersucht die Möglichkeiten der Kompensation durch theaterpädagogische Arbeit in einem veränderten Sozialisationsprozess. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen, die die zunehmende Mediatisierung für die kindliche Entwicklung mit sich bringt, und zeigt auf, wie Theaterpädagogik als eine Chance für die Kompensation dieser Herausforderungen dienen kann.
- Auswirkungen der Mediatisierung auf die kindliche Entwicklung
- Theaterpädagogische Ansätze und ihre kompensatorische Wirkung
- Der Stellenwert der Ästhetik in der Theaterpädagogik
- Praxisbezogene Reflexion einer Eigeninszenierung
- Potenzial des medialen Theaters in der Schule
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Diplomarbeit ein und beleuchtet die zunehmende Bedeutung des Fernsehens und seiner Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern. Es wird der Forschungsstand und die Relevanz der Arbeit in Bezug auf den Einfluss des Fernsehens auf die Wirklichkeitskonstruktion von Kindern dargestellt.
Kapitel 2: Sozialisierung im Medienzeitalter
Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Familie und der Kindheit im Kontext der Mediatisierung, untersucht das Freizeitverhalten von Kindern und beleuchtet die Medien- und Konsumwelt, in der sie aufwachsen. Darüber hinaus wird der Stellenwert des Fernsehens in der Lebenswelt von Kindern beleuchtet.
Kapitel 3: Auswirkungen der zunehmenden Mediatisierung
In diesem Kapitel werden die Auswirkungen der Mediatisierung auf die Erfahrungswelt, die verbale Kommunikation, die Aggressionsbereitschaft, den Realitätsverlust und weitere Wirkungsbereiche von Kindern untersucht.
Kapitel 4: Theaterpädagogik und Schule
Dieses Kapitel stellt die Grundziele der Theaterpädagogik vor, erläutert ihre Bedeutung im Darstellenden Spiel und beleuchtet verschiedene Einsatzbereiche in der Schule, wie z.B. den Wahlpflichtbereich, die Theater AG, die Tutorenstunde und das Darstellende Spiel in anderen Fächern.
Kapitel 5: Die unfassbare Kraft der Ästhetik
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Funktion der Ästhetik aus Sicht der Postmoderne, der Bedeutung der Ästhetik im Alltag und der Rolle der Ästhetischen Bildung im Theaterspiel.
Kapitel 7: Reflexion der Eigeninszenierung
Dieses Kapitel reflektiert die Eigeninszenierung des Autors und beleuchtet die Herausforderungen und Erkenntnisse, die im Rahmen der Inszenierungsarbeit gewonnen wurden. Die Gruppe, die Probenarbeit und die Auswertung der Inszenierung werden detailliert beschrieben.
Kapitel 8: Mediales Theater in der Schule
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Einsatz medialer Elemente im Schulunterricht, insbesondere dem Theater. Es analysiert verschiedene Möglichkeiten der Gestaltung des Aktionsraumes durch Medien wie Fernseher, Großbildprojektionen und Computeranimationen. Darüber hinaus werden die Chancen und Herausforderungen des medialen Theaters in der Schule beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit widmet sich den zentralen Themen der Mediatisierung, der kindlichen Entwicklung, der Theaterpädagogik, der Ästhetik und der Praxisbezogenen Reflexion. Es werden wichtige Schlüsselbegriffe wie Mediensozialisation, Kompensation, Wirklichkeitskonstruktion, Ästhetische Bildung und mediales Theater behandelt. Die Arbeit verbindet theoretische Erkenntnisse mit praktischen Erfahrungen und bietet einen umfassenden Einblick in die Möglichkeiten der Theaterpädagogik in einem mediatisierten Umfeld.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst das Fernsehen die kindliche Entwicklung?
Es wirkt massiv auf die Wirklichkeitskonstruktion von Kindern ein und kann zu Realitätsverlust, Reizüberflutung und einer Beeinträchtigung der verbalen Kommunikation führen.
Was kann Theaterpädagogik gegen die Mediatisierung bewirken?
Sie bietet eine Kompensation, indem sie Kindern ermöglicht, vom passiven "Zuschauen" zum aktiven "Erleben" überzugehen und körperlicher Entfremdung entgegenzuwirken.
Wo wird Theaterpädagogik im schulischen Bereich eingesetzt?
Einsatzbereiche sind unter anderem das Fach Darstellendes Spiel, Theater-AGs, Wahlpflichtkurse und fächerübergreifende Kooperationen.
Was ist unter "medialem Theater" in der Schule zu verstehen?
Dabei werden Medien wie Fernseher, Großbildprojektionen oder Computeranimationen aktiv in die Theaterarbeit integriert, um den Aktionsraum zu gestalten.
Warum ist ästhetische Bildung heute besonders wichtig?
In einer von schnellen Bildern geprägten Welt hilft ästhetische Bildung im Theaterspiel, eigene Ausdrucksformen zu finden und die Wahrnehmung zu schärfen.
- Quote paper
- Stefan Kappenberg (Author), 2001, Eine Chance für die mediatisierte Kinderwelt? Vom "Zuschauen" zum "Erleben" durch Theaterpädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20998