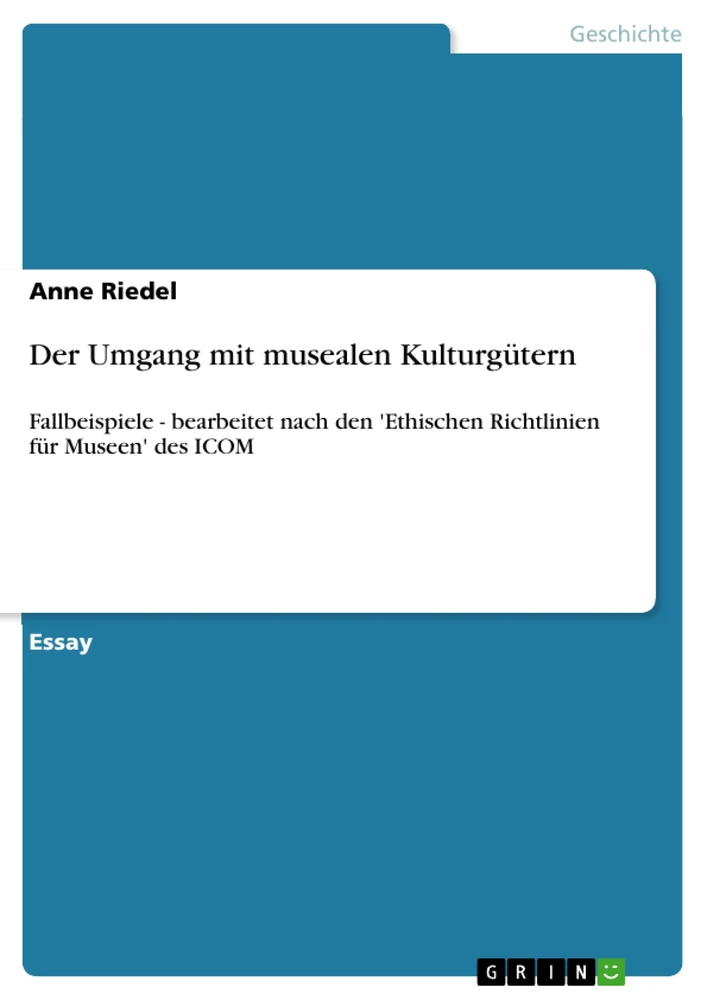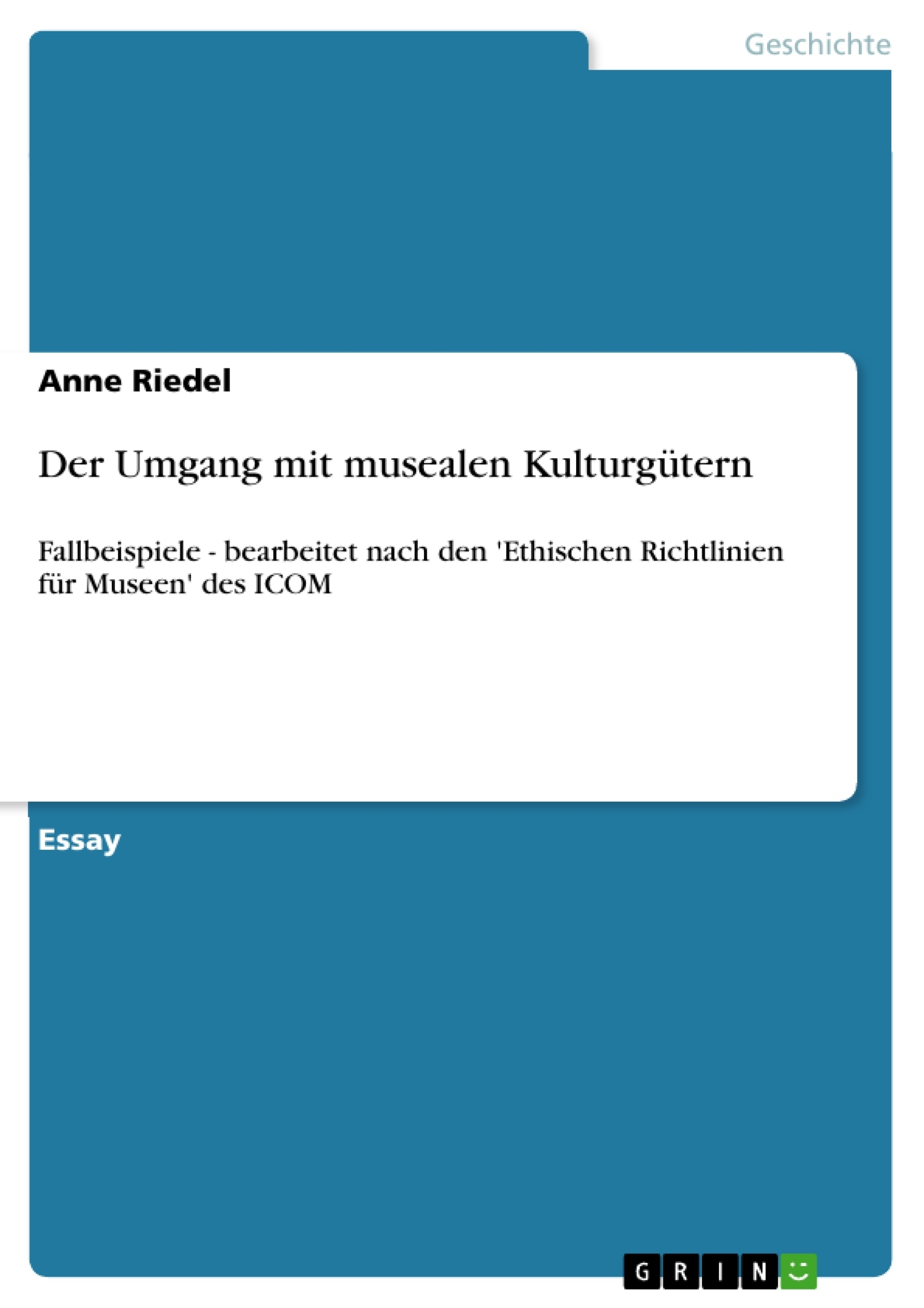„Ein Museum ist eine gemeinnützige, auf Dauer angelegte, der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung, die zum Zwecke des Studiums, der Bildung und des Erlebens materielle und immaterielle Zeugnisse von Menschen und ihrer Umwelt beschafft, bewahrt, erforscht, bekannt macht und ausstellt.“
Sie zeigen als Einrichtungen angewandter Geschichte also die Objekte als historische Zeugnisse. Der sorgsame Umgang mit solchen Kulturgütern muss dementsprechend auch einen hohen Stellenwert in der Museumsarbeit einnehmen.
Zu diesem Zwecke wurden vom Internationalen Museumsrat (International Council of Museums), kurz ICOM, die „Ethischen Richtlinien für Museen“ (Code of Ethics for Museums) entwickelt, welche weltweit gelten und die Grundlage für den korrekten Umgang mit musealem Kulturgut bilden.
Trotz der Maßnahmen zum guten Umgang mit Museumsgut kommt es weiterhin auch vermehrt zum Gegenteil. „Zahllose Raubgrabungen an archäologisch bedeutsamen Stätten, die zerstörerische Plünderung von antiken Kulturstätten sowie der massenhafte Diebstahl von Kunstgegenständen aus Kirchen und Museen in aller Welt bedrohen die wissenschaftliche Erschließung, die Erhaltung und den allgemeinen Zugang zu unserem gemeinsamen kulturellen Erbe.“ Die Umsätze mit dem illegalen Kulturgüter-Handel sind immens hoch, doch die von ihm verursachten wissenschaftlichen Verluste sind aber noch viel höher.
Wie ICOM aufgrund der „Ethischen Richtlinien für Museen“ gegen solch einen Kulturmissbrauch ankämpfen kann, soll in dieser Arbeit genauer betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Fallbeispiele
- a. Beispiel 1: Museum Krefeld
- b. Beispiel 2: Stadtmuseum Tübingen
- c. Beispiel 3: Neues Verwaltungssystem in Hessen
- d. Beispiel 4: Maori-Schädel
- e. Beispiel 5: Gemälde aus Niedersachsen
- f. Beispiel 6: Kambodscha
- III. Schlussgedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Umgang mit musealen Kulturgütern im 21. Jahrhundert. Im Fokus steht dabei die Rolle des Internationalen Museumsrates (ICOM) und dessen „Ethischen Richtlinien für Museen“ im Kontext von Konflikten und Herausforderungen, die sich aus der Bewahrung und Nutzung von Kulturgütern ergeben. Die Arbeit analysiert, wie der ICOM mithilfe der Richtlinien einen Beitrag zur Wahrung des kulturellen Erbes und zum Schutz von Museumsgütern leisten kann.
- Die Bedeutung der „Ethischen Richtlinien für Museen“ des ICOM für den Umgang mit Kulturgütern
- Konfliktbeispiele im Kontext der Museumsarbeit und deren ethische Bewertung
- Die Rolle des Museumsträgers und der Museumsleitung im Umgang mit Kulturgütern
- Die Bedeutung der Sammlungen als Ganzes und die Sicherung des kulturellen Erbes
- Die Herausforderungen des illegalen Kulturgüterhandels und der Schutz des kulturellen Erbes
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung definiert den Begriff „Museum“ und betont die Bedeutung des sorgsamen Umgangs mit Kulturgütern. Es wird auf die „Ethischen Richtlinien für Museen“ des ICOM als Grundlage für den korrekten Umgang mit musealem Kulturgut verwiesen. Darüber hinaus wird auf die Problematik des illegalen Kulturgüterhandels und die damit verbundenen Herausforderungen für den Schutz des kulturellen Erbes hingewiesen.
II. Fallbeispiele
Dieser Abschnitt präsentiert verschiedene Konfliktfälle im Kontext der Museumsarbeit, die die Anwendung der „Ethischen Richtlinien für Museen“ des ICOM aufzeigen.
a. Beispiel 1: Museum Krefeld
Der Fall des Museums Krefeld zeigt einen Konflikt zwischen dem Museumsträger (Stadt Krefeld) und dem Museum. Die Stadt fordert den Verkauf eines Gemäldes aus der Sammlung, um die dringend notwendige Dachreparatur zu finanzieren. Die Arbeit analysiert die Argumente beider Seiten und beleuchtet die relevanten Punkte der „Ethischen Richtlinien für Museen“ im Hinblick auf die Verantwortung des Museumsträgers und den Schutz der Sammlungen.
b. Beispiel 2: Stadtmuseum Tübingen
Im Fall des Stadtmuseums Tübingen wird die Problematik des Diebstahls und der mangelnden Sicherheitsmaßnahmen durch den Museumsträger (Stadt Tübingen) diskutiert. Die Arbeit untersucht die Verantwortung des Museumsträgers für die Sicherheit der Sammlungen und die Rolle des ICOM im Falle von Diebstahl und Verlust von Kulturgütern.
c. Beispiel 3: Neues Verwaltungssystem in Hessen
Dieser Abschnitt wird in der Zusammenfassung ausgelassen, da er sich mit dem neuen Verwaltungssystem in Hessen befasst und keine direkten Auswirkungen auf die generelle Problematik des Umgangs mit musealen Kulturgütern hat.
d. Beispiel 4: Maori-Schädel
Dieser Abschnitt wird in der Zusammenfassung ausgelassen, da er sich mit einem konkreten Fall von Kulturgütern befasst und somit die generelle Problematik des Umgangs mit musealen Kulturgütern nicht ausreichend beleuchtet.
e. Beispiel 5: Gemälde aus Niedersachsen
Dieser Abschnitt wird in der Zusammenfassung ausgelassen, da er sich mit einem konkreten Fall von Kulturgütern befasst und somit die generelle Problematik des Umgangs mit musealen Kulturgütern nicht ausreichend beleuchtet.
f. Beispiel 6: Kambodscha
Dieser Abschnitt wird in der Zusammenfassung ausgelassen, da er sich mit einem konkreten Fall von Kulturgütern befasst und somit die generelle Problematik des Umgangs mit musealen Kulturgütern nicht ausreichend beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den „Ethischen Richtlinien für Museen“ des ICOM, dem Schutz von musealen Kulturgütern, dem Museumsträger, dem Museum, dem illegalen Kulturgüterhandel, dem kulturellen Erbe, der Sammlung und den Herausforderungen der Museumsarbeit im 21. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die ICOM 'Ethischen Richtlinien für Museen'?
Dies sind weltweit geltende Richtlinien des Internationalen Museumsrates, die die Grundlage für den korrekten und verantwortungsvollen Umgang mit musealem Kulturgut bilden.
Dürfen Museen Sammlungsstücke verkaufen, um Reparaturen zu finanzieren?
Die Arbeit diskutiert dies am Beispiel des Museums Krefeld kritisch; laut ethischen Richtlinien sollte der Verkauf von Kulturgut nicht zur Deckung laufender Kosten dienen.
Wer trägt die Verantwortung für die Sicherheit einer Museumssammlung?
Sowohl die Museumsleitung als auch der Museumsträger (z.B. eine Stadt) sind verantwortlich für den Schutz und die Sicherung der Bestände vor Diebstahl und Verfall.
Welche Gefahren birgt der illegale Kulturgüterhandel?
Er führt zu wissenschaftlichen Verlusten durch Raubgrabungen und Plünderungen und bedroht den Erhalt des gemeinsamen kulturellen Erbes weltweit.
Wie definiert der ICOM den Begriff 'Museum'?
Ein Museum ist eine gemeinnützige, dauerhafte Einrichtung im Dienste der Gesellschaft, die Zeugnisse von Menschen beschafft, bewahrt, erforscht und ausstellt.
Was passiert bei Diebstahl von Museumsgut laut ICOM?
Die Richtlinien fordern eine sofortige Meldung und Zusammenarbeit mit Behörden, um den illegalen Handel mit den gestohlenen Objekten zu verhindern.
- Quote paper
- Anne Riedel (Author), 2011, Der Umgang mit musealen Kulturgütern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209993