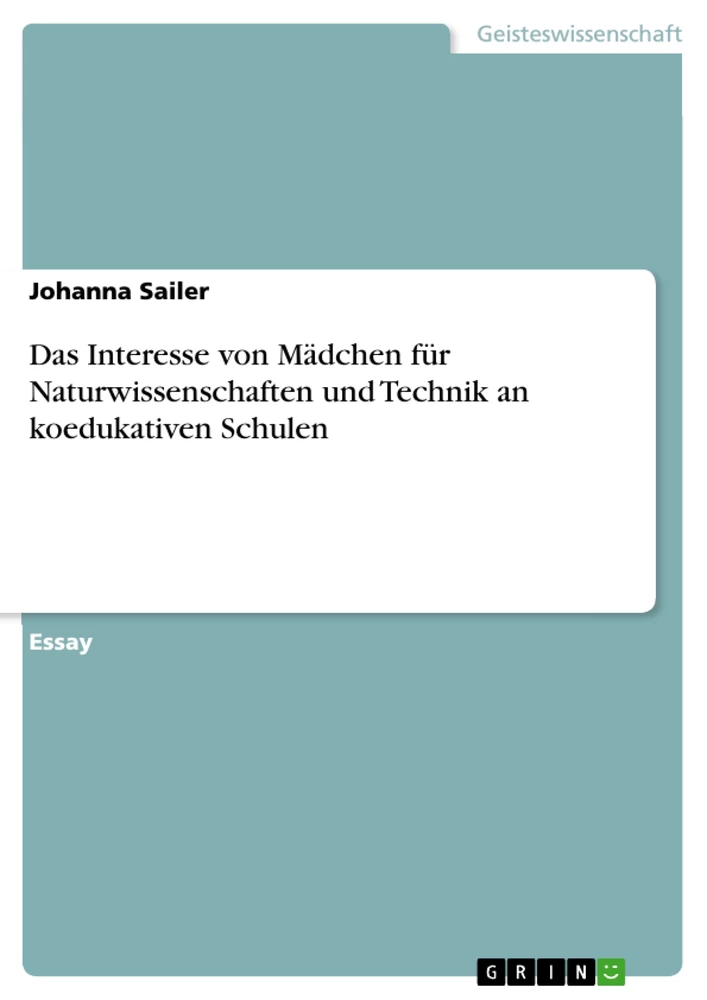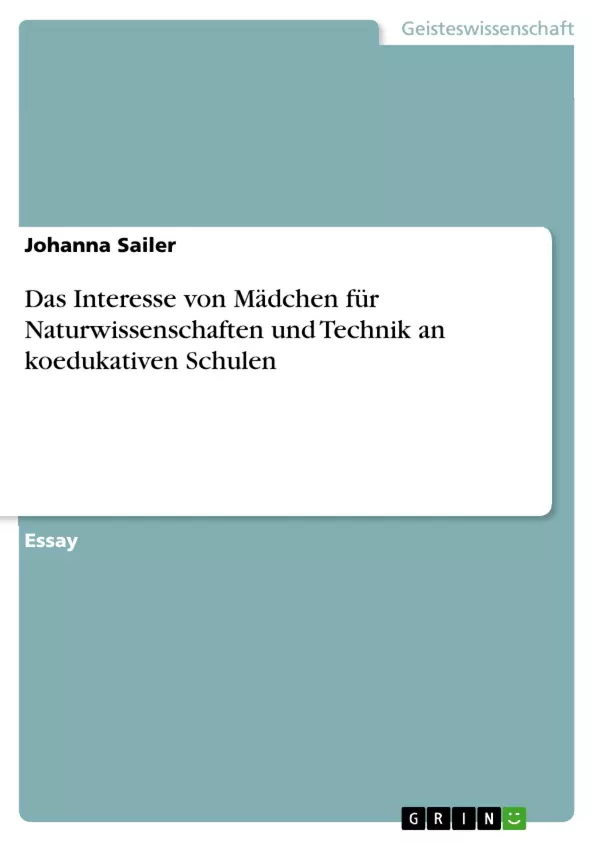1965 wird in Deutschland die Koedukation an allen staatlichen Gymnasien durchgesetzt. Der gemeinsame Unterricht von Jungen und Mädchen bewirkte eine formale Gleichstellung, da Lehrkräfte, Schulbücher und Lehrpläne sich für die Geschlechter nicht mehr unterschieden.
In der feministischen Pädagogik und in der Frauenpolitik entstanden mit der Einführung der Koedukation zahlreiche Debatten, in denen das Für und Wider der Schulreform diskutiert wurde. Speziell die Benachteiligung von Mädchen in den naturwissenschaftlichen Fachrichtungen wurde kritisiert und wird auch in meiner Arbeit besonders hinterfragt.
Dass Mädchen sich selten für Fächer wie „Physik“ oder „Informatik“ entscheiden, die in unserer Kultur einen hohen Prestige genießen, bringt ihnen vor allem einen wirtschaftlichen Nachteil.
Abitur und Studium sind dabei von besonderem Interesse, weil in dieser Phase die Wahl der Leistungskurse und Studienfächer stattfindet. Dies ermöglicht eine Aussage über die Motivation eigenständiger Entscheidungen junger Erwachsener, die zukünftige Berufs- und Lebenswege mitbestimmen.
Ich beziehe mich in meiner Arbeit vor allem auf die Sozialisation in koedukativen Schulen, auch wenn der gesellschaftliche Einfluss und die elterliche Erziehung eine mindestens genauso große Rolle spielen und die schulische Entwicklung von Jungen und Mädchen immer mit beeinflussen.
Warum interessieren sich an koedukativen Schulen so wenig Mädchen für Naturwissenschaften und Technik?
1965 wird in Deutschland die Koedukation an allen staatlichen Gymnasien durchgesetzt.[1] Der gemeinsame Unterricht von Jungen und Mädchen bewirkte eine formale Gleichstellung[2], da Lehrkräfte, Schulbücher und Lehrpläne sich für die Geschlechter nicht mehr unterschieden.
In der feministischen Pädagogik und in der Frauenpolitik entstanden mit der Einführung der Koedukation zahlreiche Debatten, in denen das Für und Wider der Schulreform diskutiert wurde. Speziell die Benachteiligung von Mädchen in den naturwissenschaftlichen Fachrichtungen wurde kritisiert und wird auch in meiner Arbeit besonders hinterfragt.
Dass Mädchen sich selten für Fächer wie „Physik“ oder „Informatik“ entscheiden, die in unserer Kultur einen hohen Prestige genießen, bringt ihnen vor allem einen wirtschaftlichen Nachteil.
Abitur und Studium sind dabei von besonderem Interesse, weil in dieser Phase die Wahl der Leistungskurse und Studienfächer stattfindet. Dies ermöglicht eine Aussage über die Motivation eigenständiger Entscheidungen junger Erwachsener, die zukünftige Berufs- und Lebenswege mitbestimmen.
Ich beziehe mich in meiner Arbeit vor allem auf die Sozialisation in koedukativen Schulen, auch wenn der gesellschaftliche Einfluss und die elterliche Erziehung eine mindestens genauso große Rolle spielen und die schulische Entwicklung von Jungen und Mädchen immer mit beeinflussen.
Eine grundlegende Beobachtung in der Koedukationsforschung ist, dass Jungen und Mädchen sich Interessengebiete aufteilen, um den jeweils Anderen nicht einzuschränken und in bestimmten Bereichen zu dominieren. Jungen spezialisieren sich dabei auf den naturwissenschaftlichen Bereich, während Mädchen sich häufiger für den Sprachunterricht begeistern können.
Diese Interessenaufteilung zeigt sich u.a. bei der Wahl der Leistungskurse im Abitur.
In der Physik herrscht ein besonders unausgewogenes Geschlechterverhältnis: Nach einer Untersuchung von 1993 wählten nur 5% der Schülerinnen auf koedukativen Schulen den Leistungskurs Physik.[3] Für einen Englisch- oder Deutschleistungskurs entschieden sich jeweils 37,7% und31% der Jungen.[4]
Diese Tendenz wird bei der Wahl der Studienfächer fortgeführt.
Im Jahr 2000 waren 21,3% der Studienanfänger im Fachbereich Physik weiblich, im WS 2003/2004 lag der Männeranteil bei den Studienanfängern der Germanistik bei 25%.[5] Jahresvergleiche zeigen, dass sich immer mehr Mädchen für ein naturwissenschaftliches Studium interessieren. Die 50%-Hürde, die in Chemie[6] und Mathematik[7] bereits erreicht wurde, ist im „Problemfach“ Physikjedoch noch weit entfernt.
Der Frauenanteil ist weitaus geringer, wenn es um spezialisierte Fachrichtungen wie die Elektrotechnik geht. Im WS 2001/2002 waren nur 7,7% der Studienanfänger weiblich.[8]
Monoedukative Schulen sind eine Möglichkeit, ein Geschlechtergleichgewicht in den Naturwissenschaft zu erreichen und die naturwissenschaftlichen Interessen der Mädchen mehr zu fördern.
Doch was versprechen sich Befürworter von den Mädchen- und Jungenschulen?
Es konnte allgemein festgestellt werden, dass sich mehr Schüler für ein Fach entscheiden, das nicht den Geschlechterstereotypen entsprach. Den Leistungskurs Physik besuchten auf monoedukativen Schulen 8% mehr Mädchen, als auf koedukativen Schulen.[9] Auf Jungenschulen wurde analog öfters der Leistungskurs Englisch oder Germanistik belegt, als auf gemischtgeschlechtlichen Schulen.[10]
Ein Vorteil von monoedukativen Schulen scheint zu sein, dass Geschlecht nicht mehr als Vergleichskriterium für Leistung dienen kann[11].
In den USA bestehen deshalb Frauencolleges neben den koedukativen Colleges.[12] In einigen deutschen Schulen finden Kurse für Mädchen statt und insbesondere im Physikunterricht konnten Verbesserungen festgestellt werden.[13]
Aber durch den Unterricht in monoedukativen Klassenverbänden können geschlechtsspezifische Verhaltensweisen auch verstärkt werden. Denn die Vermischung der Geschlechtergruppen dient allgemein dazu, „männliche“ und „weibliche“ Verhaltensweisen auszutauschen.[14] Eine Studie von Demant aus dem Jahr 1955 zeigt, dass der Zusammenhalt in gemischten Klassen stärker sei.[15]
Anhänger der Monoedukation argumentieren wiederum, dass durch eine homogene Lernphasen die Anerkennung über das eigene Geschlecht gelernt und somit Selbstbewusstsein erworben werden kann.[16]
Das Frauencollege entlässt also im Idealfall starke Frauen, die sich mit den Männern messen und dem Wettbewerb im patriarchalen System standhalten können.
Fraglich bleibt jedoch, ob die Frauen ihr Selbstbewusstsein im männerdominierten Alltag nicht schnell wieder verlieren!
Nach aktuellem Stand unseres Bildungssystems können sowohl monoedukative als auch koedukative Richtungen die Beseitigung von Geschlechterstereotypen einerseits begünstigen, andererseits können bei Beiden die Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen weiter verstärkt werden.[17] Eine schnelle Lösung bietet deshalb nach Faulstich-Wieland eine „reflexive Koedukation“, da hier nur eine vorübergehende Geschlechtertrennung zum Tragen kommt.[18]
In der feministischen Schulforschung ist man größtenteils der Ansicht, dass auf lange Sicht nur eine Reformierung der gegenwärtigen Konzeptionen zu einer spürbaren Verbesserung führen werde.[19] Ziel sollte es sein, Kinder in einem Umfeld aufwachsen zu lassen, in dem nicht nur formal, sondern auch faktisch eine Gleichstellung der Geschlechter stattgefunden hat.[20]
Dieser Anspruch besteht auch im Hochschulsystem. Es werden bereits in mehreren deutschen Städten Studiengänge für Frauen angeboten. Für die Steigerung der weiblichen Absolventen ist allerdings die Umstrukturierung und Reformierung der naturwissenschaftlichen und technischen Fächer gemäß der Interessen von Frauen ausschlaggebend.[21]
[...]
[1] vergl. Matza, S.44 und Hertel S.21.
[2] vergl. Wiesner, S.64.
[3] vergl. Hertel,.S.39. (es wurdenjeweils zwei koedukative- und zwei Mädchengymnasien untersucht.)
[4] vergl. Wiesner, S.65.
[5] Vergl.Grasberger , unter http://www.focus.de/wissen/wissenschaft/uni-ranking-und150-teil-sechs-und150- germanistik-anglistik-geschichte-lesen-lesen-lesen aid 198650.html (abgerufen am 09.03.2011).
[6] vergl. Heinsohn, S.47.
[7] vergl. Blunck, S.821.
[8] vergl. Stewart, S.18.
[9] vergl. Hertel,.S.39. (es wurden jeweils zwei koedukative- und zwei Mädchengymnasien untersucht.)
[10] vergl., Wiesner, S.65.
[11] vergl. Metz-Göckel, S.132.
[12] Ebd.
[13] vergl.ebd., S. 135.
[14] vergl. ebd., S. 133.
[15] vergl. Hertel, S. 24.
[16] vergl. Metz-Göckel, S.143.
[17] vergl. Wiesner, S.63f.
[18] vergl. ebd., S.64.
[19] vergl.Hertel,S.38f.
[20] vergl. Wiesner, S.62.
[21] vergl. Stewart., S.81.
Häufig gestellte Fragen
Warum wählen so wenig Mädchen Physik als Leistungskurs?
Studien zeigen, dass in koedukativen Schulen oft eine Interessenaufteilung nach Geschlechterstereotypen stattfindet, wobei Jungen den MINT-Bereich dominieren und Mädchen sich eher Sprachen zuwenden.
Was sind die Vorteile von monoedukativem Unterricht (Mädchenschulen)?
An Mädchenschulen entfällt das Geschlecht als Vergleichskriterium für Leistung. Mädchen trauen sich eher, Interesse an Technik und Physik zu zeigen, ohne soziale Ausgrenzung zu befürchten.
Was versteht man unter "reflexiver Koedukation"?
Dies ist ein pädagogisches Konzept, bei dem Jungen und Mädchen zeitweise getrennt unterrichtet werden, um geschlechtsspezifische Barrieren abzubauen, während der gemeinsame Unterricht grundsätzlich bestehen bleibt.
Hat die Einführung der Koedukation 1965 alle Probleme gelöst?
Zwar brachte sie formale Gleichstellung, aber die faktische Benachteiligung von Mädchen in Naturwissenschaften blieb durch subtile Sozialisationsprozesse in gemischten Klassen oft bestehen.
Wie kann man das Interesse von Mädchen an Technik nachhaltig fördern?
Durch eine Reformierung der Lehrpläne, die stärkere Berücksichtigung weiblicher Interessen in der Didaktik und die Schaffung eines Umfelds, das frei von Geschlechterstereotypen ist.
- Quote paper
- Johanna Sailer (Author), 2011, Das Interesse von Mädchen für Naturwissenschaften und Technik an koedukativen Schulen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210003