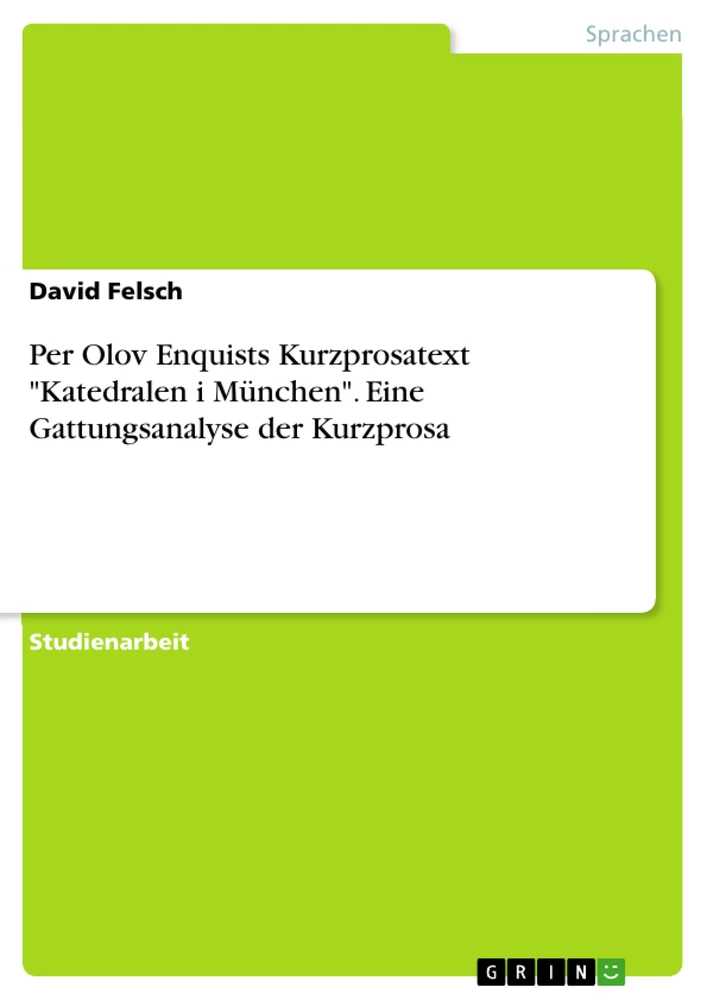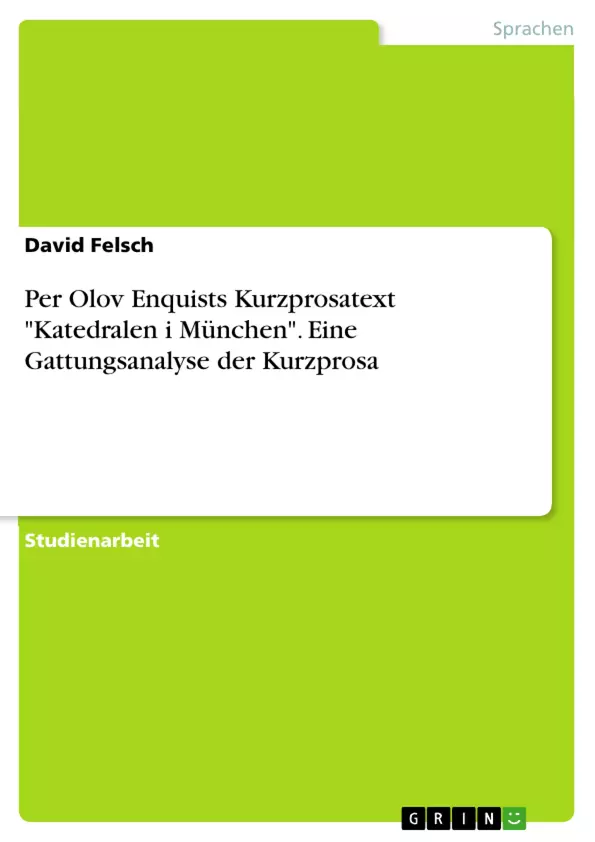Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Kurzprosatext Katedralen i München aus Per Olov Enquists Buch Katedralen i München och andra berättelser.
Bei diesem Buch handelt es sich um eine Sammlung von insgesamt 28 kurzen Texten, jeweils zwischen weniger als zwei und bis zu 19 Seiten lang, die auf Artikeln beruhen, die Enquist als Journalist während der Olympischen Sommerspiele 1972 in München für die Zeitung Expressen schrieb, und auf anderen Aufzeichnungen des Autors aus dieser Zeit.
Ziel dieser Arbeit soll es sein, auf der Grundlage einer Textanalyse eine Einordnung des ausgewählten Textes im Spektrum der Subgattungen der Gattung Kurzprosa zu versuchen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Textanalyse
2.1 Erzählgeschehen
2.2 Konfiguration
2.3 Erzählform
3. Gattungstheoretische Einordnung
4. Schluss
Literaturverzeichnis
- Citar trabajo
- David Felsch (Autor), 2012, Per Olov Enquists Kurzprosatext "Katedralen i München". Eine Gattungsanalyse der Kurzprosa, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210090