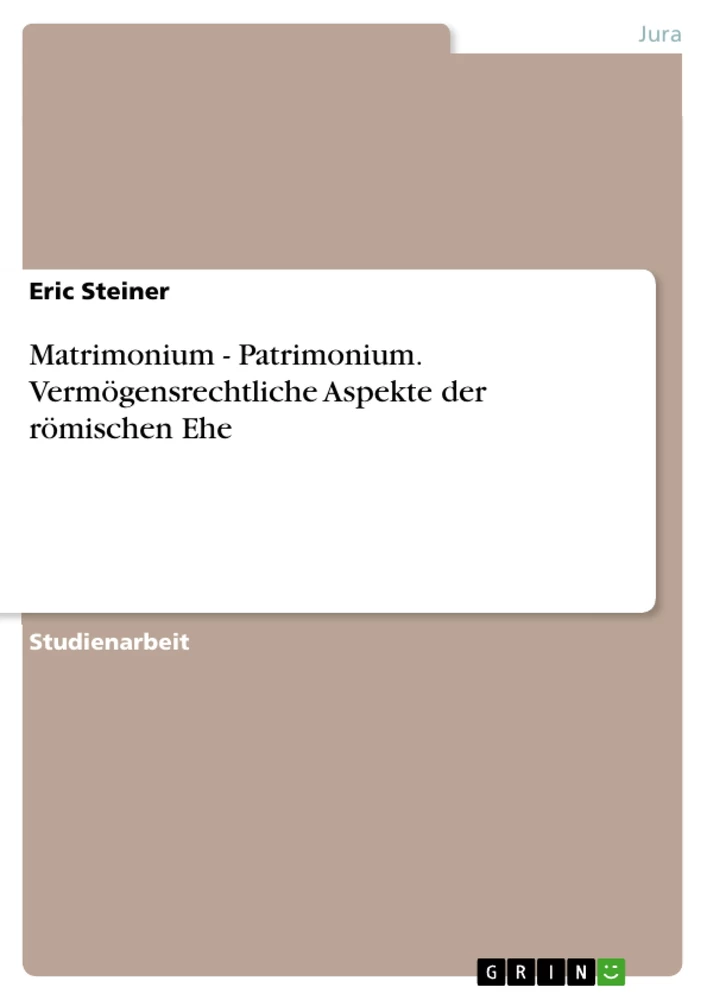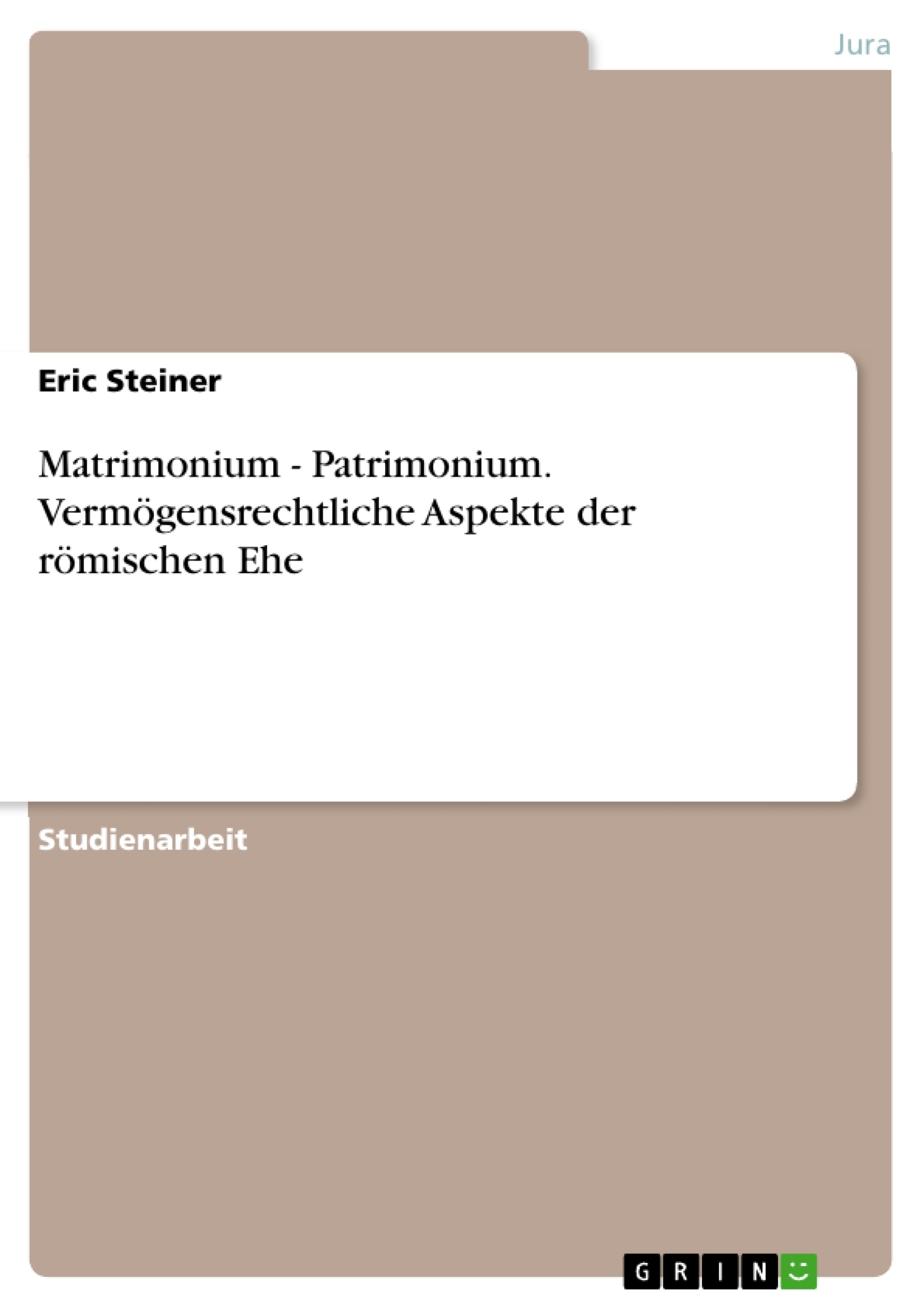Im Rahmen dieser Seminararbeit werde ich mich mit den Sanktionen des Ehebruchs, sowie der Scheidungsgesetzgebung in der Spätantike, so die moderne Bezeichnung dieser Übergangsepoche von der Antike zum Mittelalter, und den damit verwobenen Sitten- und Moralvorstellungen Konstantins des Großen (270/288 n. Chr. - 337 n. Chr.) auseinandersetzen.
Die Abstammung Konstantins, sowie die abgefassten Kaisergesetze im Corpus Iuris Civilis und im Codex Theodosianus werden uns wertvolle Aufschlüsse über die Denk- und Sichtweise des Mitbegründers der konstantinischen Kaiserdynastie gewinnen lassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Konstantins historische Wurzeln
- 3. Das „lanificium“ als Korrektiv der Sittlichkeit römischer Frauen
- 4. Betrachtung der erlassenen Kaisergesetze im Bezug auf den Ehebruch
- 5. Betrachtung des erlassenen Kaisergesetzes im Bezug auf die Ehescheidung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Sanktionen des Ehebruchs und die Scheidungsgesetzgebung in der Spätantike unter Kaiser Konstantin dem Großen. Sie analysiert die Kaisergesetze im Corpus Iuris Civilis und Codex Theodosianus, um Konstantins Denkweise und die Sitten- und Moralvorstellungen seiner Zeit zu verstehen. Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung des Rechts und die gesellschaftliche Bewertung von Ehebruch und Scheidung.
- Konstantins historische Wurzeln und deren Einfluss auf seine Rechtsprechung
- Das Idealbild der römischen Frau und das "lanificium" als Korrektiv der Sittlichkeit
- Kaiserliche Gesetzgebung zum Ehebruch in der Spätantike
- Kaiserliche Gesetzgebung zur Ehescheidung in der Spätantike
- Die Entwicklung des römischen Rechts im Kontext gesellschaftlicher Moralvorstellungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Fokus der Arbeit: die Untersuchung der Sanktionen des Ehebruchs und der Scheidungsgesetzgebung in der Spätantike unter Kaiser Konstantin. Sie ordnet die Arbeit zeitlich in die postklassische Periode ein und diskutiert den Begriff des Dominats nach Theodor Mommsen, wobei kritische Stimmen zu dieser Interpretation berücksichtigt werden. Die Einleitung betont die Bedeutung der Kaisergesetze im Corpus Iuris Civilis und Codex Theodosianus für das Verständnis der Denkweise Konstantins und der zeitgenössischen Moralvorstellungen. Die Einleitung schließt mit einer Diskussion über die umstrittene zeitliche Abgrenzung der Spätantike.
2. Konstantins historische Wurzeln: Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Hintergründe Konstantins, um seine Einstellung zu Sitte und Moral besser zu verstehen. Es beschreibt seine außereheliche Geburt und die Folgen seines eigenen Verhaltens bezüglich Ehebruch und Mord. Der Fokus liegt auf Konstantins Konkubinat und der Ausführung seines Sohnes Crispus sowie seiner Frau Fausta. Die grausamen Bestimmungen des Sexualstrafrechts werden als Ausdruck von Konstantins persönlichen Erlebnissen interpretiert. Der Einfluss von Konstantins Mutter Helena, deren Herkunft seine Reputation beeinflusste, wird ebenfalls thematisiert.
3. Das „lanificium“ als Korrektiv der Sittlichkeit römischer Frauen: Das Kapitel analysiert das Idealbild der römischen Frau, verkörpert im "lanificium", dem fleißigen Spinnen und Weben. Dieses Idealbild stand im Gegensatz zu Frauen mit einer Vergangenheit in Gaststätten, die sozial geächtet wurden. Rechtswissenschaftliche Kommentare zeigen, dass dieser Standpunkt über Jahrhunderte Bestand hatte, und die Rechtsexperten teilten die negative Sicht auf Frauen dieser sozialen Schicht. Das Kapitel betont den gesellschaftlichen Druck auf Frauen, dem Idealbild zu entsprechen.
4. Betrachtung der erlassenen Kaisergesetze im Bezug auf den Ehebruch: Dieses Kapitel untersucht Kaisergesetze im Codex Iuris Civilis und Codex Theodosianus bezüglich Ehebruch und Sittlichkeitsnormen. Es analysiert ein Gesetz aus dem Jahr 326 n. Chr., welches Konstantin möglicherweise erließ, um die Ehrbarkeit seiner Mutter Helena zu betonen und gegen vorherrschende Meinungen zu kämpfen. Das Kapitel unterstreicht die Verbindung zwischen persönlicher Erfahrung und Gesetzgebung Konstantins.
Schlüsselwörter
Konstantin der Große, Spätantike, Ehebruch, Scheidung, Kaisergesetze, Corpus Iuris Civilis, Codex Theodosianus, Sitten, Moral, "lanificium", römische Frauen, Helena, postklassische Periode, Dominat.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Seminararbeit über Ehebruch und Scheidung unter Kaiser Konstantin
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Sanktionen des Ehebruchs und die Scheidungsgesetzgebung in der Spätantike unter Kaiser Konstantin dem Großen. Sie analysiert die Kaisergesetze im Corpus Iuris Civilis und Codex Theodosianus, um Konstantins Denkweise und die Sitten- und Moralvorstellungen seiner Zeit zu verstehen. Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung des Rechts und die gesellschaftliche Bewertung von Ehebruch und Scheidung.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Kaisergesetze im Corpus Iuris Civilis und Codex Theodosianus. Sie bezieht außerdem historische Hintergründe und zeitgenössische Moralvorstellungen mit ein.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Konstantins historische Wurzeln und deren Einfluss auf seine Rechtsprechung, das Idealbild der römischen Frau und das "lanificium" als Korrektiv der Sittlichkeit, die kaiserliche Gesetzgebung zum Ehebruch und zur Ehescheidung in der Spätantike, sowie die Entwicklung des römischen Rechts im Kontext gesellschaftlicher Moralvorstellungen.
Wie wird Konstantins Persönlichkeit in die Analyse einbezogen?
Konstantins außereheliche Geburt, sein eigenes Verhalten bezüglich Ehebruch und Mord (insbesondere die Tötung seines Sohnes Crispus und seiner Frau Fausta), sowie der Einfluss seiner Mutter Helena werden analysiert, um seine Denkweise und seine Gesetzgebung besser zu verstehen. Die grausamen Bestimmungen des Sexualstrafrechts werden als Ausdruck seiner persönlichen Erlebnisse interpretiert.
Welche Rolle spielt das "lanificium" in der Arbeit?
Das "lanificium", das fleißige Spinnen und Weben, wird als Idealbild der römischen Frau dargestellt, das im Gegensatz zu Frauen mit einer Vergangenheit in Gaststätten stand. Die Arbeit untersucht, wie dieses Idealbild den gesellschaftlichen Druck auf Frauen beeinflusste und wie es in rechtswissenschaftlichen Kommentaren widergespiegelt wurde.
Wie werden die Kaisergesetze zum Ehebruch und zur Scheidung analysiert?
Die Arbeit analysiert konkrete Kaisergesetze aus dem Codex Iuris Civilis und Codex Theodosianus, z.B. ein Gesetz aus dem Jahr 326 n. Chr., um Konstantins Gesetzgebung im Kontext seiner persönlichen Erfahrungen und der vorherrschenden Meinungen zu verstehen. Die Verbindung zwischen persönlicher Erfahrung und Gesetzgebung wird hervorgehoben.
Welche zeitliche Einordnung wird vorgenommen?
Die Arbeit ordnet die Thematik in die postklassische Periode ein und diskutiert den Begriff des Dominats nach Theodor Mommsen, wobei kritische Stimmen zu dieser Interpretation berücksichtigt werden. Die umstrittene zeitliche Abgrenzung der Spätantike wird ebenfalls diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Konstantin der Große, Spätantike, Ehebruch, Scheidung, Kaisergesetze, Corpus Iuris Civilis, Codex Theodosianus, Sitten, Moral, "lanificium", römische Frauen, Helena, postklassische Periode, Dominat.
- Citar trabajo
- Eric Steiner (Autor), 2012, Matrimonium - Patrimonium. Vermögensrechtliche Aspekte der römischen Ehe, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210174