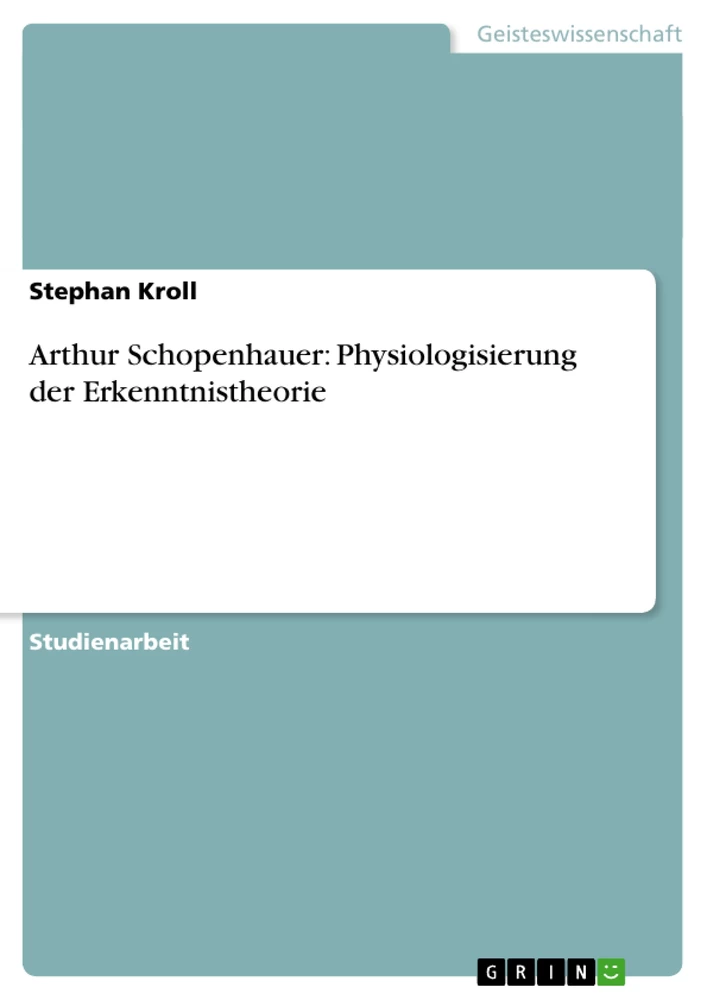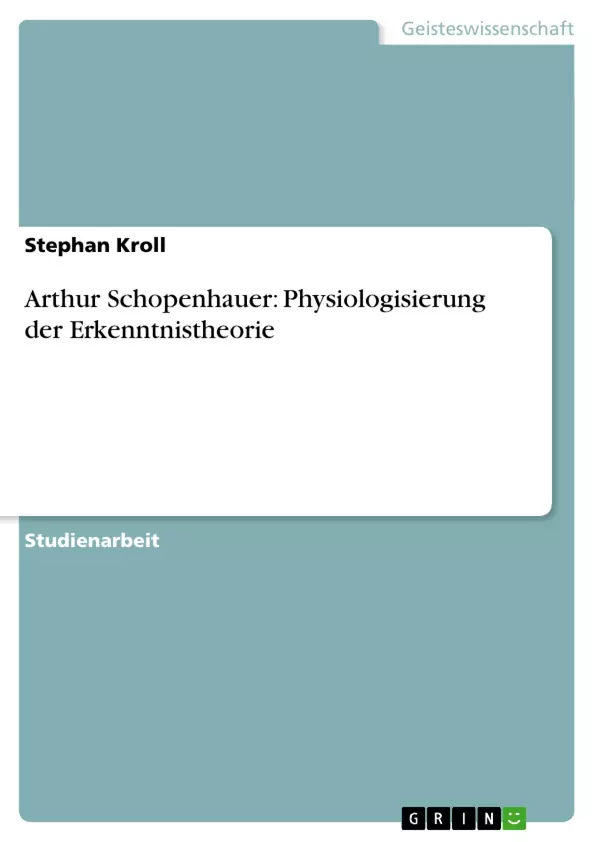Bereits im Titel seines Hauptwerkes „Die Welt als Wille und Vorstellung“ verdeutlicht
Schopenhauer die Grundidee seiner Philosophie. Schopenhauer stimmt mit der Auffassung
Kants überein, dass der erkennende Mensch die Welt nur innerhalb seiner Vorstellung erfährt,
d.h. dass die Welt durch die Erkenntnisweise des Subjekts bedingt ist. Im Gegensatz zu Kant
gibt es für ihn jedoch etwas diesen Vorstellungen Zugrundeliegendes und damit unabhängig
von aller Erfahrung und Erkenntnis Bestehendes, das Schopenhauer „Wille“ nennt. Der Wille
ist kein Ziel oder eine Absicht, sondern eine Art alles durchdringende Kraft, das innere Wesen
der Dinge und die Triebkraft der Natur. Als „Ding an sich“ liegt der Wille zwar der gesamten
Wirklichkeit zugrunde, aber er erscheint stets in einzelnen Willensphänomenen, die
Manifestationen dieses einen Willens sind. Er lehrt, dass allen Einzelerscheinungen, wie sie
dem Menschen subjektiv wahrnehmbar sind, ein Objektives, ein Ding an sich zugrunde liege:
der Wille. Er betätigt sich unbewusst im Pflanzen- und Mineralreich, bewusst im höheren und
niederen Tier. Dieser Wille ist aber im Grunde etwas Nichtseinsollendes. Wer erkannt hat,
dass der Wille zum Leben in dieser Welt des Scheins Mangel, Jammer, Qual und Tod sei,
sucht die Erlösung durch Verneinung des Willens zum Leben. Diese Resignation, die im
Buddhismus ihren Ursprung hat, lag zum Teil in Schopenhauers leicht melancholischer Natur
begründet und wurde durch mancherlei schlimme Lebenserfahrung gefördert. Schopenhauers
Gedanken beeinflussten F. Nietzsche und R. Wagner nachhaltig.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundgedanken
- Zwei Ansichten des Intellekts
- Schopenhauers idealistische Grundansicht
- Die subjektive Betrachtungsweise
- Materialistische Ergänzungen: Die objektive Betrachtungsweise
- Der „Zellersche Zirkel“
- Das „Gehirnparadox“ und der neurophilosophische Ansatz nach Roth
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert Schopenhauers „Physiologisierung der Erkenntnistheorie und das Gehirnparadox“ und untersucht die Wechselwirkung zwischen idealistischer und materialistischer Betrachtungsweise. Ziel ist es, die zentralen Argumente Schopenhauers im Kontext seiner Philosophie zu verstehen und seine Konzeption des „Gehirnparadox“ im Spannungsfeld von subjektiver und objektiver Wahrnehmung zu beleuchten.
- Schopenhauers idealistische Grundansicht
- Die Rolle des Willens in der Erkenntnis
- Die subjektive und objektive Betrachtungsweise des Intellekts
- Das „Gehirnparadox“ und seine Implikationen
- Die Verbindung zwischen Schopenhauers Philosophie und neurophilosophischen Ansätzen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Grundidee von Schopenhauers Philosophie ein, die die Welt als „Wille und Vorstellung“ versteht. Schopenhauer vertritt einen idealistischen Standpunkt, der die Erkenntnis als subjektiv bedingt sieht, jedoch im Gegensatz zu Kant eine zugrundeliegende Wirklichkeit, den „Wille“, postuliert.
Grundgedanken
Schopenhauer bezieht sich auf Platon und Kant und entwickelt eine eigene idealistische Erkenntnistheorie, die die Philosophie Hegels ablehnt. Er integriert naturwissenschaftliche Erkenntnisse und entwickelt eine „Physiologie der Wahrnehmung“. Die Erscheinungswelt existiert nur in der Wahrnehmung und im Bewusstsein als „Vorstellung“. Der „Wille“ liegt der Vorstellungswelt zugrunde und ist ein grundloser und zielloser Drang, der die gesamte Wirklichkeit umfasst.
Zwei Ansichten des Intellekts
Schopenhauer unterscheidet zwischen einer „subjektiven“ und einer „objektiven“ Betrachtungsweise des Intellekts. Die subjektive Betrachtungsweise betrachtet das Bewusstsein als gegeben und beschreibt die Mechanismen der Weltentfaltung, während die objektive Betrachtungsweise die äußere Erfahrung untersucht und das Verhältnis des Intellekts zu den Eigenschaften der Welt analysiert.
Schlüsselwörter
Schopenhauer, Idealismus, Materialismus, Erkenntnistheorie, Wille, Vorstellung, Gehirnparadox, subjektive Betrachtungsweise, objektive Betrachtungsweise, neurophilosophie
Häufig gestellte Fragen
Was meint Schopenhauer mit 'Die Welt als Wille und Vorstellung'?
Vorstellung ist die Welt, wie wir sie subjektiv wahrnehmen. Der Wille hingegen ist das 'Ding an sich', die blinde, dranghafte Urkraft, die allem zugrunde liegt.
Was ist das 'Gehirnparadox'?
Es beschreibt den Zirkelschluss, dass das Gehirn einerseits ein Produkt der materiellen Welt ist, diese Welt aber andererseits erst als Vorstellung im Gehirn entsteht.
Wie unterscheidet sich Schopenhauer von Kant?
Während Kant das 'Ding an sich' als unerkennbar ansieht, identifiziert Schopenhauer es konkret als den 'Willen'.
Welchen Einfluss hatte der Buddhismus auf Schopenhauer?
Schopenhauers Lehre von der Verneinung des Willens als Erlösung vom Leiden hat starke Parallelen zur buddhistischen Resignation und dem Nirvana.
Was ist die 'objektive Betrachtungsweise' des Intellekts?
Sie untersucht den Intellekt als physiologisches Organ (das Gehirn) und dessen Verhältnis zur materiellen Außenwelt.
- Arbeit zitieren
- Stephan Kroll (Autor:in), 2003, Arthur Schopenhauer: Physiologisierung der Erkenntnistheorie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21017