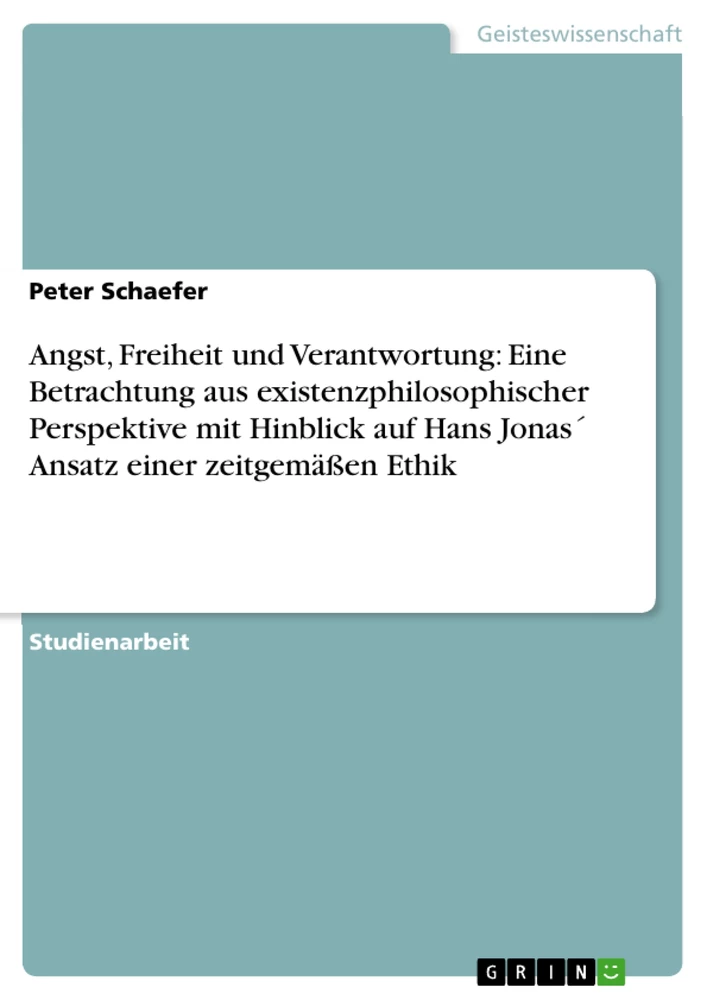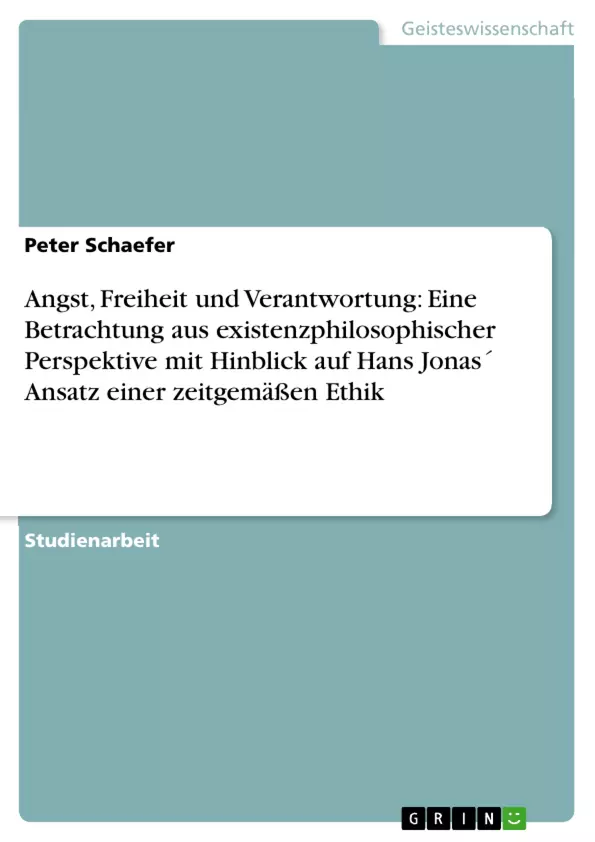Angst, Freiheit und Verantwortung: Drei große Begriffe, die vielfach besetzt sind. Angst beispielsweise ist, gerade in der heutigen Zeit, ein Begriff, der in der Psychologie besondere Aufmerksamkeit bekommt. Viele Menschen fühlen sich ängstlich – sie sehen sich existenziellen Nöten ausgesetzt. Sie finden sich in einer Welt wieder, die sich immer schneller zu drehen scheint. Viele haben Angst, den Anschluss zu verlieren. Die Menschen fühlen sich haltlos.
Diese Ängstlichkeit geht in der Folge oft mit einem subjektiv wahrgenommenen Freiheitsverlust einher. Unter der Diktatur der Angst, so kann man sagen, verlieren viele Menschen die Fähigkeit, freie Entscheidungen zu treffen. Sie sehen sich in den Determinismus gezwungen und geben vergleichsweise viel Entscheidungsgewalt an externe Faktoren ab.
Anliegen der vorliegenden Arbeit ist es nun, eine existenzphilosophische Perspektive einzunehmen, um das Problemfeld Angst, Furcht, Freiheit und Verantwortung aus einem Betrachtungswinkel heraus zu diskutieren, der uns letzten Endes zu angstbefreiten und frei entscheidenden Menschen macht, welche die Angst eher auf ihr Potential hin deuten als auf ihre Negativeffekte. Ein hoher Anspruch! Und in letzter Instanz kann diese Abhandlung auch nur die Grundlagen legen. Es liegt an jedem Einzelnen selbst, die Ideen, die hier vermittelt werden sollen, mit konkreten Inhalten zu füllen.
Inhalt
Vorwort
1. Vorüberlegungen zu den Begriffen Angst und Furcht
1.1. Differenzierung von Angst und Furcht
1.2. Angst: Das Tor zur Unendlichkeit der Welt
1.2.1. Die Angst vor dem In-der-Welt-sein
1.2.2. Angst als Freiheitsbewusstsein
2. Freiheit und Verantwortung
2.1. Zur Verantwortung verurteilt
2.2. Der handelnde Mensch
2.3. Hans Jonas‘ Ansatz einer zeitgemäßen Ethik
2.3.1. Die zentrale Forderung
2.3.2. Heuristik der Furcht
2.3.3. Hans Jonas‘ Verantwortungsbegriff
3. Abschließende Betrachtung
Literatur.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet Angst von Furcht?
Furcht bezieht sich auf ein konkretes Objekt oder eine Gefahr, während Angst ein existenzieller Zustand ohne konkreten Gegenstand ist, der die Freiheit des Menschen spiegelt.
Was bedeutet Hans Jonas’ „Heuristik der Furcht“?
Es ist ein ethisches Prinzip, bei dem die Vorstellung möglicher Katastrophen als Warnsignal dient, um verantwortungsvolle Entscheidungen für die Zukunft der Menschheit zu treffen.
Warum ist der Mensch laut Existenzphilosophie zur Freiheit „verurteilt“?
Da es keine vorgegebene Bestimmung gibt, muss der Mensch ständig selbst wählen und ist damit für jede seiner Handlungen absolut verantwortlich.
Wie kann Angst als „Freiheitsbewusstsein“ gedeutet werden?
Angst zeigt dem Menschen seine unendlichen Möglichkeiten auf. Sie ist das Schwindelgefühl vor der eigenen Freiheit, alles wählen zu können.
Welchen Kern hat Hans Jonas’ Verantwortungsbegriff?
Verantwortung bedeutet für Jonas primär die Sorge um das Fortbestehen echten menschlichen Lebens auf der Erde angesichts der technologischen Bedrohung.
- Quote paper
- Peter Schaefer (Author), 2012, Angst, Freiheit und Verantwortung: Eine Betrachtung aus existenzphilosophischer Perspektive mit Hinblick auf Hans Jonas´ Ansatz einer zeitgemäßen Ethik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210260