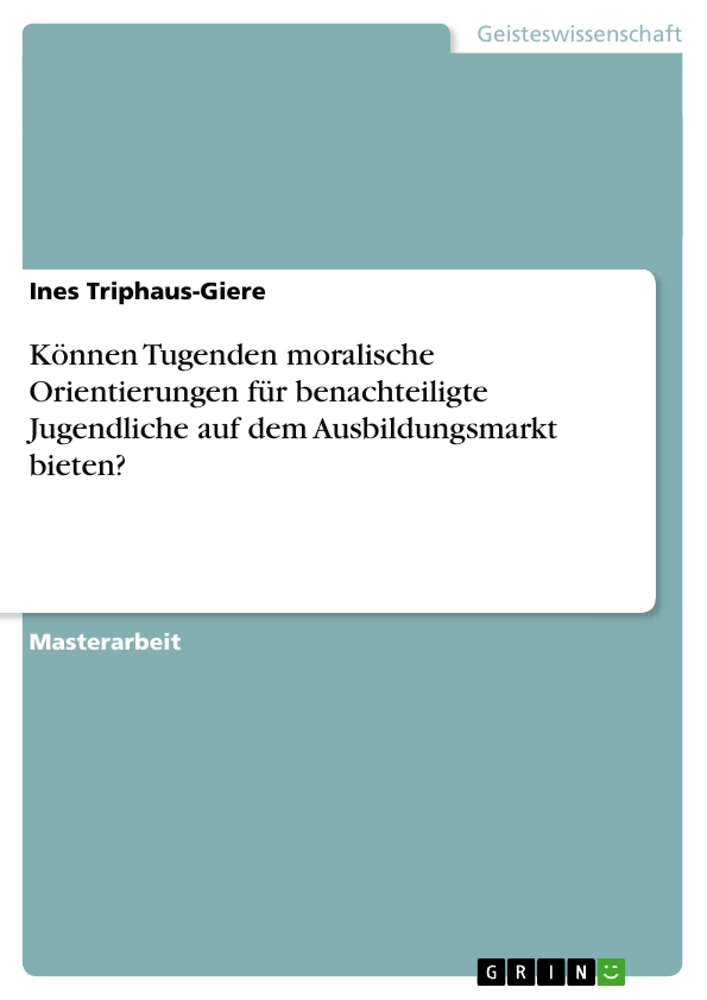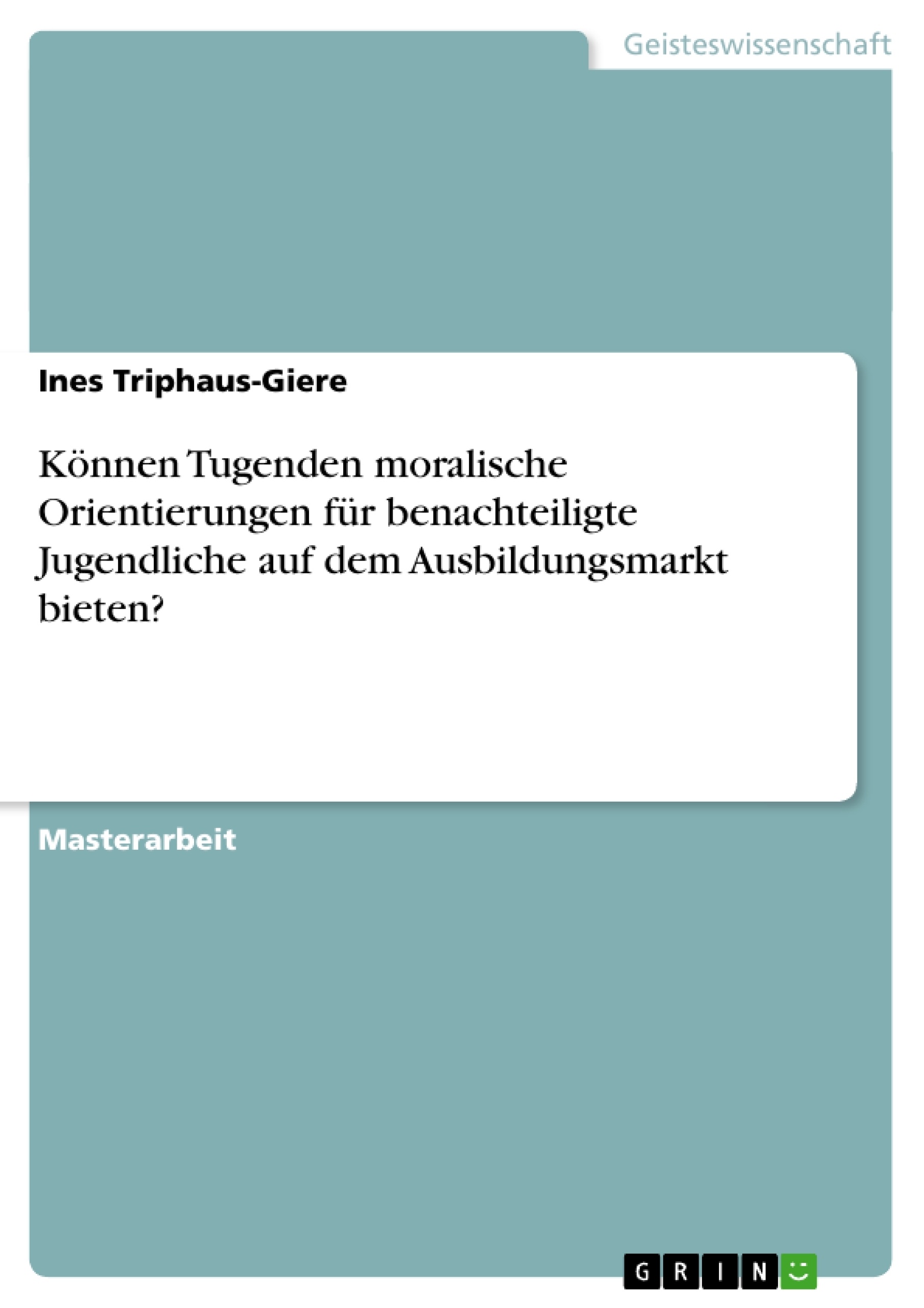´Tugenden` gehören nicht unbedingt zu den aktuellen, innovativen Begriffen, vielmehr kann ihnen schon beinah ein ´angestaubtes` Image attestiert werden, bzw. findet man sie „fast nur noch in iron.[ischer] Signalisierung lebendig“. Demgegenüber ist, besonders im Kontext von pädagogischer Arbeit, immer wieder der Ruf nach der Vermittlung von Werten und Tugenden zu hören. Insbesondere wird diese Forderung häufig in Hinblick auf die gesellschaftliche und berufliche Integration von Jugendlichen mit niedrigem Bildungsniveau erhoben, daher betrifft diese Forderung neben Haupt- und Sonderschulen im Wesentlichen auch die Berufsbildenden Schulen, da sie Jugendlichen, deren Übergang in die Berufsausbildung nicht reibungslos verläuft, spezifische Bildungsangebote anbieten. Fordern die Anbieter von Berufsausbildungsplätzen ´tugendhafte` Bewerber, und sind daher Lehrer gefordert, die Tugenden ihrer Schüler zu stärken? Können Verhaltensweisen wie Pünktlichkeit und Lernbereitschaft mit ´Tugend` übersetzt werden? Kann Tugend überhaupt gelehrt werden?
Tugenden und Werte werden oft in einem Atemzug genannt, und häufig geht damit die Klage vom ´Werteverfall` einher. Demgegenüber zeigen empirische Studien die hohe Bedeutung, die Werte unter Jugendlichen nach wie vor haben, allerdings unterliegen sie einem ´Wertewandel`. Werte, an denen das eigene Handeln ausgerichtet wird und anhand derer die eigene Biographie geformt wird, unterliegen einer Präferenzverschiebung, ohne dass alte Werte durch neue ersetzt werden. Desweiteren kann, vermutlich intendiert durch die Anforderungen der Leistungsgesellschaft, eine höhere Wertschätzung ´alter Werten` wie Höflichkeit, Arbeitsethik, Sparsamkeit und Anpassung als ´neuer Zeitgeist` festgestellt werden. Wie die viel zitierte sokratische Schilderung ´der Jugend` zeigt, kann eine problematisierende Sichtweise auf ´Jugend und Werte` nicht auf aktuelle Herausforderungen begrenzt gesehen werden, vielmehr scheint das Verhältnis von Jugend und Werten sehr vertraut, und vielleicht wird daher die ´Wertediskussion` häufig primär auf die Werte Jugendlicher bezogen.
Gliederung
1 Einleitung
2 Begriffliche Grundlegungen
2.1 Ausbildungsplatzmarktbenachteiligte Jugendliche im Beruflichen
Übergangssystem
2.2 Kompetenzorientierung der beruflichen Bildung
2.3 Tugendbegriff und Werte in der Ethik
3 Werteorientierungen ausbildungsplatzmarktbenachteiligter Jugendlicher
3.1 Ausbildungsplatzmarktbenachteiligte Jugendliche in der Risikogesellschaft
3.1.1 Orientierung in pluraler, individualisierter Gesellschaft?
3.1.2 Tugenden - Zugangsvoraussetzung in die Berufsausbildung?
3.1.3 Benachteiligt beim Zugang in die Berufswelt
3.2 Werteorientierungen ausbildungsplatzmarktbenachteiligter Jugendlicher
im Spiegel empirischer Jugendforschung
3.3 Werteorientierungen im Kontext von Sozialisationserfahrungen und
personaler Identität
3.3.1 Werteorientierungen – abhängig von sozialen Faktoren?
3.3.2 Soziale Einbindungen – konstitutiv für die personale Identität?
3.3.3 Personale Identität und Werteorientierungen
3.4 Ausbildungsplatzmarktbenachteiligte Jugendliche – eine ethische Anfrage
an die Gesellschaft
4 Orientierungen durch Tugenden?
4.1 Zum Tugendbegriff in ethischer Diskussion
4.1.1 Prinzipienethik versus Tugendethik?
4.1.2 Neue Tugendethik
4.1.3 Tugend als Sein-Können
4.2 Woher können ausbildungsplatzmarktbenachteiligte Jugendliche moralische
Orientierungen beziehen?
4.2.1 Orientierung durch Prinzipien?
4.2.2 Moralisches Wissen und moralisches Handeln
4.2.3 Strebensziel Glückseligkeit
4.2.4 Moralisch Handeln lernen
4.3 Orientierung an Werten durch Tugend
5 Orientierungen durch Tugenden für ausbildungsplatzmarktbenachteiligte
Jugendliche
6 Literatur
Anhang
Anhang 1: Handreichung für die Berufseinstiegsklasse (Auszug)
Anhang 2: Ergebnisse aus der empirischen Sozialforschung zu Werteorientierungen aus-
bildungsplatzmarktbenachteiligter Jugendlicher
Anhang 3: Daten aus: Feige, Andreas et al., „Was mir wichtig ist im Leben“. Auffassungen Jugendlicher und Junger Erwachsener zu Alltagsethik, Moral, Religion und Kirche, Datenband, 2008. (Auszug)
Anhang 4: Erhebungsinstrument: Fragebogen zur Werteorientierung Jugendlicher
Anhang 5: Theoretisches Modell zu Kapitel 4.2.4 Moralisch Handeln lernen,
Visualisierung (eigene Darstellung)
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Übersichtsverzeichnis
Übersicht 2.1 Verteilung der Neuzugänge auf die drei Sektoren des beruflichen Ausbildungssystems 2000 und 2005 bis 2008
Übersicht 3.1 Interdependenz zwischen Sozialisation und Werteorientierungen
Übersicht 3.2 Zusammenhang zwischen den Faktoren
Übersicht 3.3 Interdependenz für das Individuum
Übersicht 3.4 Zusammenhang Sozialisation, Werteorientierung, Person
Übersicht 3.5 Zusammenhang Sozialisation, Werteorientierung, Person
Übersicht 4.1 Dualistisches Denkmodell
Übersicht 4.2 Erweitertes dualistischen Denkmodell
Übersicht 4.3 Dualistisches Denkmodell in verkürzter Übersicht
Übersicht 4.4 Handlungstheoretische Differenz zwischen Kant und Aristoteles
Übersicht 4.5: Dualistisches Denkmodell, verworfen
Übersicht 4.6: Korrigiertes Denkmodell
Übersicht 4.7: Tugenden nach Aristoteles
1 Einleitung
´Tugenden` gehören nicht unbedingt zu den aktuellen, innovativen Begriffen, vielmehr kann ihnen schon beinah ein ´angestaubtes` Image attestiert werden, bzw. findet man sie „fast nur noch in iron.[ischer] Signalisierung lebendig“[1]. Demgegenüber ist, besonders im Kontext von pädagogischer Arbeit, immer wieder der Ruf nach der Vermittlung von Werten und Tugenden zu hören. Insbesondere wird diese Forderung häufig in Hinblick auf die gesellschaftliche und berufliche Integration von Jugendlichen[2] mit niedrigem Bildungsniveau erhoben, daher betrifft diese Forderung neben Haupt- und Sonderschulen im Wesentlichen auch die Berufsbildenden Schulen, da sie Jugendlichen, deren Übergang in die Berufsausbildung nicht reibungslos verläuft, spezifische Bildungsangebote anbieten. Fordern die Anbieter von Berufsausbildungsplätzen ´tugendhafte` Bewerber, und sind daher Lehrer[3] gefordert, die Tugenden ihrer Schüler zu stärken? Können Verhaltensweisen wie Pünktlichkeit und Lernbereitschaft mit ´Tugend` übersetzt werden? Kann Tugend überhaupt gelehrt werden?
Tugenden und Werte werden oft in einem Atemzug genannt, und häufig geht damit die Klage vom ´Werteverfall` einher. Demgegenüber zeigen empirische Studien die hohe Bedeutung, die Werte unter Jugendlichen nach wie vor haben, allerdings unterliegen sie einem ´Wertewandel`. Werte, an denen das eigene Handeln ausgerichtet wird und anhand derer die eigene Biographie geformt wird, unterliegen einer Präferenzverschiebung, ohne dass alte Werte durch neue ersetzt werden[4]. Desweiteren kann, vermutlich intendiert durch die Anforderungen der Leistungsgesellschaft, eine höhere Wertschätzung ´alter Werten` wie Höflichkeit, Arbeitsethik, Sparsamkeit und Anpassung als ´neuer Zeitgeist` festgestellt werden[5]. Wie die viel zitierte sokratische Schilderung ´der Jugend` zeigt, kann eine problematisierende Sichtweise auf ´Jugend und Werte` nicht auf aktuelle Herausforderungen begrenzt gesehen werden, vielmehr scheint das Verhältnis von Jugend und Werten sehr vertraut[6], und vielleicht wird daher die ´Wertediskussion` häufig primär auf die Werte Jugendlicher bezogen. Damit wird ingleichem Maße, wie Wertewandel und Werteverlust beklagt werden, in einer verkürzten Folgerung, in der Vermittlung von Werten die Lösung gesehen für gesellschaftliche Probleme wie Jugendarbeitslosigkeit, Jugendkriminalität und Gewaltbereitschaft [7]. Entsprechend findet sich die Anforderung zur ´ Werteerziehung` in Schulen nicht nur in den Schulgesetzen[8], sondern auch die formulierten ´Leitziele` der einzelnen Schulen verpflichten zur Förderung der Werte und Tugenden[9]. Ergo sind Lehrer aufgefordert, ihren Schülern Werte und Tugenden nahezubringen.
Die Themenwahl zu dieser Arbeit bewegt sich in diesem Kontext. Als Studierende mit dem Ziel ´Lehramt an Berufsbildenden Schulen` bot sich während des Schulpraktikums die Gelegenheit, eine Religionsstunde in einer Berufseinstiegsklasse (BEK) zu hospitieren. Die gewonnenen Eindrücke führten schließlich zu dem Thema der vorliegenden Studie. Die BEK ist ein Bildungsgang im sogenannten ´Übergangssystem`, ein spezifisches Angebot für Jugendliche mit Benachteiligung am Ausbildungsplatzmarkt, charakterisiert in erster Linie durch keinen oder maximal einen Hauptschulabschluss. In der besuchten Unterrichtsstunde präsentierten die Schüler von ihnen erstellte Plakate zum Thema ´Vorbilder`. Durch die Darstellung von Musikgruppen mit gewaltverherrlichenden Songtexten als vorbildlich durch die Schüler, wurde ´Gewaltakzeptanz` zum Thema der Unterrichtsstunde. Der Lehrer forderte die Schüler auf, ihre gewaltbefürwortende Position zu reflektieren, allerdings wurden Gesprächsansätze durch eingerufene Parolen und Gemeinplätze durch die jeweils anderen Schüler sanktioniert. Mehrere disziplinierende Maßnahmen und ein Unterrichtsausschluss wurden notwendig. In den Werteorientierungen der beobachteten Schüler kann eine Präferenz zum Selbst, zu ihrer Autonomie und eine hohe Akzeptanz von physischer und psychischer Gewalt vermutet werden.
Hierin zeigt sich eine individuelle und gesellschaftliche Problematik auf mehreren Ebenen. Einerseits kann eine Benachteiligung beim Zugang zur Berufswelt in Abhängigkeit vom Bildungsniveau benannt werden. Der Übergang in die Ausbildung verläuft bei Jugendlichen, die maximal den Hauptschulabschluss erlangt haben, in hohen Anteilen problematisch[10] und die schlechtesten Chancen auf dem Ausbildungsmarkt haben Jugendliche ohne Sc hulabschluss. In dieser Gruppe, die 2010 einen Anteil von 6,5% der Schulabgänger stellt[11], werden verlängerte und kompliziertere Ausbildungsverläufe und ´Warteschleifen`, häufig ohne Aussicht auf eine vollqualifizierende Ausbildung, zunehmend zum Regelfall[12]. Fast jeder dritte Ausbildungsplatzinteressierte hat im Jahr 2011 keinen Ausbildungsvertrag bekommen[13], womit sich für die betreffenden Jugendlichen nicht nur mittelfristig berufliche Perspektiven einschränken, sondern durch die hohe Bedeutung von Berufsausbildung und Beruf kann von einer Einschränkung der Lebenschancen in beruflicher, privater und individueller Hinsicht gesprochen werden. Demgegenüber beachtenswert ist, dass jede dritte angebotene Ausbildungsstelle nicht besetzt werden konnte[14]. Das Bundeswirtschaftsministerium publiziert, das Blatt habe sich gewendet, "jeder Motivierte, der die Schule verlässt, hat beste Chancen auf einen Ausbildungsplatz“[15]. Mit diesen Entwicklungen besteht die Gefahr einer Stigmatisierung von benachteiligten Jugendlichen als ´nicht ausbildungsreif`, die unbedingt zu vermeiden ist[16], sondern vielmehr kann damit die gesellschaftliche Herausforderung benannt werden, die Zahl der derzeit rund 1,5 Mio. jungen Menschen im Alter zwischen 20 und 29 Jahren ohne Berufsabschluss[17], zu verringern und benachteiligten Jugendlichen eine Perspektive aufzuzeigen.
Desweiteren zeigt sich in den geäußerten Werteorientierungen der BEK-Schüler eine Problematik hinsichtlich der moralischen Orientierung. Woher können Jugendliche heute moralische Orientierungen beziehen? Woran können sie sich in moralischen Entscheidungen und in Entscheidungen zur Lebensgestaltung orientieren? Auf einen einheitlichen gesellschaftlichen Wertehorizont kann mit den Entwicklungen der letzten Jahrzehnte nur noch eingeschränkt zurückgegriffen werden. In individualisierter, säkularer und pluralisierter Gesellschaft ist jeder Einzelne gefordert, seine Werte, seinen Weg und sein Leben inklusive Sinngestaltung selber zu suchen und zu gestalten. Damit bieten sich Wahlfreiheit und eine Vielzahl an individuellen Gestaltungsmöglichkeit, allerdings besteht damit auch der Zwang, das eigene Leben erfolgreich gestalten zu müssen, der insbesondere bei benachteiligten Jugendlichen zu Überforderung, Orientierungslosigkeit und Zukunftsängsten führen kann.
Das Thema und die Fragestellung der vorliegenden Arbeit "Können Tugenden moralische Orientierungen für ausbildungsplatzmarktbenachteiligte Jugendliche bieten?" ist sicherlich geeignet und lohnenswert, in einem deutlich größeren Rahmen, als dem dieser Arbeit bearbeitet zu werden. Es bieten sich vielfältige methodische und inhaltliche Herangehensweisen und Schwerpunkte an. Als methodischer Zugang wird für diese Arbeit der hermeneutische Weg gewählt. Aufgrund der Vielschichtigkeit des Themas sind im Verlauf der Arbeit immer wieder Entscheidungen über Ein- und Ausgrenzungen zu treffen und viele interessante Aspekte können in diesem Rahmen nicht verfolgt werden, dies betrifft z. B. die große Thematik des ´Gewissens`. Ebenso wird, auch wenn in dieser Arbeit sozialethische Aspekte thematisiert werden, die Frage nach der ´Gerechtigkeit` nicht behandelt, sondern die Individualethik zur moralischen Orientierung steht im Vordergrund. Die Tugenden, die hier auf ihr Potential zu moralischen Orientierungen angefragt werden, finden in den meisten zeitgenössischen Abhandlungen zum Thema Moral keine Verwendung, stattdessen stehen Begriffe wie ´Pflicht` und ´Verpflichtung` im Vordergrund und man beruft sich vor allem auf Prinzipien der Vernunft[18]. Allerdings wird die normative Ethik des Sollens zunehmend kritisiert, da sie für viele aktuelle Herausforderungen nicht endgültig zufriedenstellend ist, und zum Teil wird ihr Realitätsferne vorgeworfen. Beispielsweise zeigt sich auch in aktueller Diskussion zum kirchlichen Lehramt, dass ein deontologisches Moralverständnis kritisch angefragt wird. Daher kann in der Ethik eine Rückbesinnung auf das klassische Modell der Tugenden nach Aristoteles und in mittelalterlicher Rezeption z. B. mit Thomas von Aquin festgestellt werden, es wird von einer ´Renaissance der Tugendethik` gesprochen. "Aristoteles und Kant spielen im aktuellen ethischen Diskurs eine eminente Rolle"[19], und entsprechend begrenzt sich die vorliegende Arbeit zur klassischen Tugendethik auf die aristotelische Tugendlehre und zur normativen Ethik auf die Prinzipienethik Immanuel Kants.
Zunächst steht zu fragen, ob ein Zusammenhang zwischen Werteorientierungen und Ausbildungsplatzmarktbenachteiligung tatsächlich besteht (Kap. 3.1). Spielen Werte und Tugenden eine Rolle zum Eingang in die Berufsausbildung? Dann wird zu fragen sein, ob Jugendliche mit niedrigem Bildungsniveau eine abweichende Werteorientierung gegenüber anderen Jugendlichen haben (Kap. 3.2), und welche Faktoren neben dem Bildungsniveau als konstituierend für individuelle Werteorientierungen benannt werden können (Kap. 3.3). Nach einer Annäherung an das Verständnis von Tugenden, das methodisch durch die Gegenüberstellung zur Prinzipienethik erfolgt (Kap. 4.1), steht die Frage nach moralischer Orientierung im Mittelpunkt (Kap. 4.2), um schließlich die Tugendethik auf ihr Potential zu moralischen Orientierungen anzufragen.
2 Begriffliche Grundlegungen
Zu Beginn erfolgt für ein einheitliches Verständnis die Darstellung der für diese Arbeit grundlegenden Begriffe in dem hier verwendeten Verständnis. Zudem wird für einige Begriffe die ausschließliche Darstellung einer Definition nicht als ausreichend angesehen, daher werden spezifische Termini jeweils in dem für diese Arbeit relevanten Zusammenhang dargestellt.
2.1 Ausbildungsplatzmarktbenachteiligte Jugendliche im Beruflichen Übergangssystem
Ausbildungsplatzmarktbenachteiligte Jugendliche werden in dieser Arbeit verstanden als Jugendliche, die nach Beendigung einer allgemeinbildenden Schule nicht oder nicht direkt in die Berufsausbildung übergehen. Jugendliche, die maximal den Hauptschulabschluss haben, können als Gruppe, deren Übergänge in die Berufsausbildung „in besonders hohen Anteilen problematisch verlaufen“[20] benannt werden. Daher liegt hier der Focus auf Hauptschulabsolventen und –abgänger, die Schüler in Schulformen des ´Übergangssystems` sind bzw. werden, und diese mit dem Ziel besuchen, den Hauptschulabschluss zu erwerben oder zu verbessern, und ihre Chancen am Ausbildungsplatzmarkt zu verbessern. Der Begriff Ausbildungsplatzmarktbenachteiligung ist nicht eindeutig definiert und steht einerseits zwischen arbeits- und ausbildungsmarktsystematischen Aspekten, z. B. der regionalen Angebotsverteilung, und nimmt damit Bezug auf die Vermittelbarkeit der Jugendlichen, auf der anderen Seite wird Ausbildungsplatzmarktbenachteiligung im Verhältnis zu individuellen Faktoren wie Ausbildungsreife und Qualifikationen verstanden.[21] Daher kann in Abhängigkeit vom jeweiligen Begriffsverständnis Ausbildungsplatzmarktbenachteiligung und unzureichende Ausbildungsreife voneinander abgegrenzt werden, auf diese Differenzierung wird aber im Rahmen dieser Arbeit verzichtet und unter ausbildungsplatzmarktbenachteiligten Jugendlichen eine heterogene Gruppe gemäß der obigen Eingrenzung verstanden. Auf spezifische Aspekte, z. B. genderbezogene Aspekte, die sogenannten ´Altbewerber`, die Benachteiligung von Jugendlichen mit Behinderungen oder von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht gesondert eingegangen werden.
Übersicht 2.1: Verteilung der Neuzugänge auf die drei Sektoren des beruflichen Ausbildungssystems nach schulischer Vorbildung 2006 und 2008 (in %). Quelle: Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2010, 98.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Berufliche Übergangssystem umfasst alle Bildungsangebote, die „zu keinem anerkannten Ausbildungsabschluss führen, sondern auf eine Verbesserung der individuellen Kompetenzen von Jugendlichen zur Aufnahme einer [Berufs-] Ausbildung oder Beschäftigung zielen und zum Teil das Nachholen eines [..] Schulabschlusses ermöglichen“[22]. Neben Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit gehören mehrere vollschulische Angebote an berufsbildenden Schulen (BBS) zum sogenannten ´Übergangssystem`[23], auf diese wird hier Bezug genommen. Die Schulformen im ´Übergangssystem` sind variantenreich hinsichtlich der Zugangsvoraussetzungen und Zielsetzungen, z. B. berufsfeldbezogene, vorberufliche Qualifizierung. Das berufliche Ausbildungssystem umfasst die drei Sektoren Duales Berufsausbildungssystem, Schulberufssystem und das ´Übergangssystem`, zu dem die Anzahl der Neuzugänge im Jahre 2011 bundesweit 294.294 Jugendliche betrug[24].
In dieser Arbeit wird Bezug genommen auf Schüler im ´Übergangssystem` mit eingeschränkten Chancen einen Ausbildungsplatz zu bekommen, Jugendliche mit einem niedrigen Bildungsniveau, die einen Anteil von knapp einem Drittel aller Neuzugänge[25] zum beruflichen Ausbildungssystem stellen. Wie an anderen Schwellen im Bildungssystem, vollziehen sich auch beim Übergang von den allgemeinbildenden Schulen in die Berufsausbildung soziale Selektionsprozesse bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen nach schulischer Vorbildung. Die Übersicht zeigt die hohe Abhängigkeit von Schulabschluss und Zugang zur dualen Ausbildung. Umgekehrt wird auch die hohe Korrelation zwischen fehlendem Schulabschluss und dem Zugang zum beruflichen Übergangssystem deutlich. Trotz des aktuell entspannten Ausbildungsstellenmarktes[26] gehen etwa die Hälfte der Jugendlichen mit Hauptschulabschluss und mehr als drei Viertel von denen ohne Hauptschulabschluss nach Beendigung der allgemeinbildenden Schule ins berufliche Übergangssystem[27].
Die Berufseinstiegsklasse (BEK) ist ein einjähriges, vollschulisches Angebot an niedersächsischen BBS im ´Übergangssystem`, das sich an Jugendliche, die die Abschlussklasse der Sekundarstufe1 ohne allgemein bildenden Schulabschluss oder mit einem Hauptschulabschluss mit einer Durchschnittsnote geringer als 3,5 beendet haben, richtet[28]. Das Ziel der BEK ist, die Ausbildungsreife der Schüler zu erwirken, um sie für den Einstieg in die Berufs- und Ausbildungswelt zu qualifizieren[29].
Die Zielsetzung des ´Übergangssystems` ist der erfolgreiche Zugang in eine Berufsausbildung, vornehmlich im dualen System. Die Berufsausbildung im dualen System erfolgt in den institutionell und rechtlich getrennten Bildungsträgern Berufsschule und ausbildender Betrieb in einem geordneten Ausbildungsgang[30]. Die rechtliche Grundlage für die duale Berufsausbildung bilden das Berufsbildungsgesetz (BBiG) und die Ordnungsmittel der Berufsausbildung. Trotz der institutionellen Trennung der beiden Lernorte gilt das traditionelle dualistische Verständnis über die Kenntnisvermittlung in der Berufsschule und die Vermittlung praktischer Fertigkeiten im Betrieb heute als überholt[31], vielmehr erfordert die Vermittlung der notwendigen beruflichen Handlungskompetenz eine enge Verzahnung praktischer und theoretischer Ausbildungsinhalte.
2.2 Kompetenzorientierung der beruflichen Bildung
Das Bildungsziel in der beruflichen Bildung, die berufliche Handlungs-Kompetenz ist aus den Begriffen Kompetenz und Handlungsorientierung zu einer Begriffsverbindung zusammen gesetzt[32], daher soll der Beitrag beider Elemente zum derzeit in der deutschen beruflichen Bildung vorherrschenden Begriffsverständnis von Handlungskompetenz separat betrachtet werden. Dazu steht im Rahmen dieser Arbeit weniger die historische Entwicklung des Begriffs, als vielmehr das aktuelle Begriffsverständnis in der beruflichen Bildung im Mittelpunkt.
Das Konstrukt der beruflichen Handlungskompetenz steht in einer Entwicklungslinie mit dem didaktischen Prinzip der Handlungsorientierung, die sich in der Handlungstheorie nach Aebli begründet[33]. Die Leitidee der Handlungsorientierung verbindet sich mit der Erwartung, die Auswirkungen des traditionellen Dualismus von menschlichem Denken und Handeln in der inneren und äußeren Organisation von beruflichem Lernen überwinden zu können. Die Entgegensetzung von Handeln und Denken, von Wissen und Tun, von Arbeiten und Lernen begründet sich in der Ideenlehre Platons, der in einer bewussten Hierarchisierung[34] „Menschen einteilte in solche, die wissen und nicht tun, und solche, die tun und nicht wissen, was sie tun[35] “. In den antiken griechischen und römischen Gesellschaften waren Arbeit und Bürgertum nicht vereinbar, entsprechend schloss Aristoteles alle vom Bürgerrecht aus, die nicht über genügend ´Muße zur Entfaltung ihrer Tugend` verfügten[36]. In der Neuzeit legitimierte sich die Trennung von materieller und ideeller Welt mit dem materialistisch angelegten Empirismus und Sensualismus[37] sowie über das dualistisch geprägte neuhumanistische Bildungsideal[38], und zeigt sich bis in das heutige Bildungsverständnis z. B. im deutschen dreigliedrigen allgemeinbildenden Schulsystem. Das antidualistische Konzept kritisiert dieses zweitausendjährige philosophische, politische und soziale Denkmuster, mit dem eine Bildungselite den Geist für sich in Anspruch nimmt und Anderen das Tun zuweist, und betont demgegenüber die strukturelle und funktionale Verwandtschaft von Denken und Handeln[39] durch die Darstellung ihrer wechselseitigen Interdependenz: „Das Denken, das Wissen und das Können entwickeln sich aus dem praktischen Handeln und dem Wahrnehmen heraus, und Denken, Wissen und Können haben sich wiederum im praktischen Handeln und in der deutenden Wahrnehmung der Welt zu bewähren“[40].
Im aktuellen Verständnis von Handlungskompetenz in der deutschen beruflichen Bildung wird Handlungskompetenz als Innehaben von handlungsrelevantem Wissen und dem Verfügenkönnen über dieses Wissen im Rahmen von Handlungen, als Handlungsdisposition verstanden[41], wobei die zur Ausführung einer Handlung notwendigen motivationalen und volitionalen Aspekte, über Aebli hinaus, als konstitutive Bestandteile der Handlungskompetenz verstanden werden. Die Kompetenzorientierung der beruflichen Bildung hat ihre Wurzeln in der Debatte um materiale und formale Bildung unter dem Einfluss nachlassender tayloristischer Arbeitsorganisation[42]. Im Zuge dieser Entwicklung nahm der emanzipatorische Kompetenzbegriff und dessen Dimensionen nach Roth maßgeblichen Einfluss auf den Kompetenzbegriff[43], auch dem des umgangssprachlichen Verständnisses. Das Roth´sche Kompetenzmodell bildet die Grundlage für das Kompetenzkonstrukt der ´Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der Kultusministerkonferenz für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule und ihre Abstimmung mit Ausbildungsordnungen des Bundes für anerkannte Ausbildungsberufe` (KMK-Handreichung). Dagegen herrscht in der Allgemeinbildung ein Kompetenzverständnis vor, das primär kognitive Aspekte in den Vordergrund stellt und explizit vom berufspädagogischen Kompetenzbegriff abgegrenzt wird[44]. Handeln wird als eine der nachgeordneten Facetten von Kompetenz benannt[45]. Die zahlreichen Differenzierungen und Kontroversen zum Begriffsverständnis können hier nicht dargestellt werden, festzuhalten bleibt, dass über einige Merkmale von Kompetenz, beispielsweise Subjektbezug, Performanzbezug und die Differenzierung in Dimensionen, Konsens zu verzeichnen ist[46]. Weitgehende Einigkeit besteht im Verständnis von Kompetenz als eine relativ stabile, aber durch Lernen veränderbare Disposition für erfolgreiches Handeln[47].
Die berufliche Handlungskompetenz der KMK-Handreichung wird beschrieben „als die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten“[48]. Handlungskompetenz entfaltet sich in einzelne Dimensionen, die miteinander vernetzt und interdependent zu verstehen sind. Die Fach- auch Sachkompetenz wird von der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) bezeichnet, als „die Bereitschaft und Befähigung […] Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen“[49]. Für das Thema dieser Arbeit besonders beachtenswert ist die Erläuterung der KMK zur Human- bzw. Selbstkompetenz. Humankompetenz umfasst motivationale und metakognitive Fähigkeiten, die neben personalen Eigenschaften, wie z. B. Kritikfähigkeit und Zuverlässigkeit, auch die „Entwicklung durchdachter Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte“ umfasst[50]. Die Kompetenzdimension Sozialkompetenz bezieht sich auf sozialbezogene und kommunikative Fähigkeiten, und die Fähigkeit „sich mit Anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen“[51]. Das Kompetenzkonstrukt der KMK-Handreichung wurde als Zielsetzung zwar explizit für die Schulform Berufsschule formuliert, allerdings hat sich dieses Begriffsverständnis in der Berufspädagogik manifestiert[52] und hat auch in die Curricula anderer beruflicher Bildungsgänge als Bildungsziel Einzug genommen, so auch in die Rahmenrichtlinien für die BEK[53]. Im Rahmen dieser Arbeit wird auf dieses 3dimensionale Verständnis von Kompetenz in dem hier dargestellten Begriffsverständnis Bezug genommen.
2.3 Tugendbegriff und Werte in der Ethik
Um den Begriff Tugend zu bestimmen, kann zunächst unterschieden werden zwischen instrumentellen und moralischen Tugenden. Instrumentelle Tugenden sind nicht in sich selbst gut, sondern ihre Qualität ist abhängig von der Zielsetzung ihres Einsatzes, weshalb sie auch als Sekundärtugenden bezeichnet werden. Sekundärtugenden zu denen z. B. Fleiß, Pünktlichkeit, Sparsamkeit und Ordnungsliebe sowie heutzutage auch IT-Kenntnisse[54] gezählt werden, haben die Tendenz, sich als Selbstzweck auszugeben und sich in den Vordergrund zu rücken. Den Primärtugenden, die hier im Fokus stehen, gehören beispielsweise Hilfsbereitschaft, Toleranz und Gerechtigkeit an.[55] Im frühen Christentum entfalteten sich, mit Ambrosius beginnend, die vier Kardinaltugenden[56] Klugheit, Tapferkeit, Gerechtigkeit und Maß, sie galten als Bilder menschlichen Richtigseins[57] und wurden daher mit ´cardo` (Türangel) als Dreh- und Angelpunkt alles Sittlichen verstanden[58]. Die Kardinaltugenden lassen sich unter anderer Akzentuierung auch in partikulären Tugendsystemen, wie den ´bürgerlichen Tugenden` oder dem Arbeiterethos wiederfinden[59]. Auf Aristoteles geht die Unterscheidung in Charaktertugenden, die für die richtigen Einstellungen und Ziele sorgen, sowie den Verstandestugenden (dianoetische Tugenden), von denen die eine Art, Phronesis für die richtigen Mittel und Wege der moralischen Praxis zuständig ist, zurück[60]. Der Tugendbegriff lässt sich einerseits unter Bezug auf institutionelle Tugenden, als Ethoskontext einer Gemeinschaft[61] oder als individuelle Tugenden unter Bezug auf die sittliche Haltung des Individuums, wenn auch zwischen beiden eine Abhängigkeit besteht, getrennt betrachten. Im Rahmen dieser Arbeit steht der Bezug auf die Tugenden der einzelnen Person im Mittelpunkt.
Eine begriffliche Ausdifferenzierung des Tugendbegriffs in der Perspektive dieser Arbeit erfolgt im Verlauf dieser Arbeit, daher sei im Folgenden lediglich ein Arbeitsverständnis eingeführt. Tugend wird hier als subjektive „personhaft integrierte, in der Personenmitte des Menschen verankerte“[62] Grundhaltung verstanden, „kraft derer der Mensch geneigt [Hervorh. d. Verf.] ist, das Gute zu tun“[63]. Damit sind Tugenden ganzheitliche ´Haltungsbilder` die den Ethos eines bestimmten Lebensvollzuges veranschaulichen und gleichermaßen ´Handlungsbilder`, die situativ die Wirklichkeit gestalten helfen[64]. Tugend fragt vor allem danach, wie wir sein sollen[65]. Entsprechend bringt Mieth den Tugendbegriff in einen Sinnzusammenhang mit Humanität und der Würde des Menschen[66]. Die Tugendethik, auch eudaimonistische oder aretaische Ethik, beschäftigt sich mit der Orientierung des Handelnden bei der Aufgabe, ein gutes Leben zu führen, entgegen der deontologischen Ethik, die ethische Bewertungen auf das Gesollte im Sinne der ethisch richtigen Handlung bezieht[67].
Der Werte begriff ist gegenüber der Tugend kein Begriff aus der klassischen Ethik, sondern entstammt der Ökonomie. Als Wert wird allgemein angesehen, was in kollektiver als auch in individueller Einschätzung als erstrebenswert, gut, beglückend und nützlich gilt[68], sowie Dinge, Eigenschaften und Verhaltensweisen, die von Menschen als ´wert`-voll angesehen werden[69]. Allerdings kommt auch den Werten, auch in der Eingrenzung auf ´ethische Werte`, eine breite Bedeutung zu. So berührt der Versuch, ein Begriffsverständnis für Werte grundzulegen u. a. Fragen der Normbegründung, der Erkenntnistheorie und der moralischen Autonomie des Menschen, die im Rahmen dieser Arbeit nicht angesprochen werden können.
Eine Funktion von ethischen Werten ist, dass sie helfen können, ethisch legitime von illegitimen Interessen zu unterscheiden. In Sichtweise der Wertethik, aber auch des Utilitarismus und z. T. auch der Diskursethik werden Werte deontologisch verstanden und die Bedeutung des Guten im moralischen Subjekt reduziert. Demgegenüber wird hier der Sichtweise gefolgt, die einem planen Wertobjektivismus unabhängig vom Subjekt kritisch gegenübersteht und Werte universal gültig ansieht, die durch die Anerkennung von moralfähigen, autonomen Subjekten zur Existenz gelangen.[70] Werte stellen zwar Produkte menschlicher Reflexion dar, sie liegen aber objektiv, unabhängig vom Menschen vor. In diesem Sinne sind Werte von Menschen formuliert, aber nicht durch subjektive Setzungen, denn dann wären Werte ´nur` Konventionen. Ethische Werte werden hier verstanden als grundlegende Überzeugungen und Einstellungen, womit sowohl kognitive als auch affektive und volitionale Aspekte einhergehen, an denen der Mensch sein Verhalten ausrichtet. Die Anerkennung und Ablehnung von Werten beeinflusst motivierend das Denken und Handeln des Menschen, daher formen Werte die Grundlinien menschlichen Daseins.[71]
Mit Werteorientierungen kann einerseits die Wert-Haltung des Subjekts verstanden werden, andererseits kann von Werteorientierung gesprochen werden als objektive Orientierungsquelle für die Ausbildung der Wert-Haltung des Einzelnen. In den für diese Arbeit angefragten empirischen Arbeiten wird unter Werteorientierungen die Orientierung des befragten Individuums an Werten, unter der Perspektive von Lebensplanung und Sinngebung, verstanden[72]. Entsprechend wird der Begriff Werteorientierung hier als Synonym zu subjektiver Wert-Haltung des Einzelnen verwendet. Insbesondere werden Werteorientierungen hier verstanden, als eine aus den anerkannten Werten erwachsene Herausforderung des Subjektes zu einem, den Werten entsprechenden Handeln[73] und kann somit als Verbindlichkeitsseite von Werten angesehen werden.
Unter dem Begriff moralische Orientierung wird hier die ´Quelle` für die individuelle Anerkennung von Werten und für die Ausprägung der persönlichen Werteorientierungen gesehen. In dem für diese Arbeit zugrundegelegten Verständnis wird davon ausgegangen, dass allein die Kenntnis von Werten nicht ausreichend für die moralische Orientierung ist, sondern dazu die freie, autonome Bindung des Individuums an begründete Werte voraussetzend ist. Dazu wird hier auf das Modell der autonomen Moral Bezug genommen, dessen philosophischer Ansatz mit Kant begründet ist, und die Alfons Auer als autonome Moral in den Sinnhorizont des christlichen Glaubens stellt[74].
In der Perspektive dieser Arbeit ist sowohl in theologischer als auch in soziologischer Sichtweise ein Bezug zum Subjektsein der Person, zur personalen Identität gegeben. Im Rahmen dieser Arbeit werden die Begriffe Identität, personale Identität und Persönlichkeit synonym verwendet. Identität wird verstanden als „innere, selbstkonstruierte, dynamische Organisation von Trieben, Fähigkeiten, Überzeugungen und individueller Geschichte“[75] und ist damit mehr als „Wissen um die eigene Existenz, ist mehr als Selbstwertgefühl, ist mehr als Überzeugung von den eigenen Handlungsmöglichkeiten, und ist doch zugleich auch all dieses“[76]. Identität kann auch funktionell als Befähigung verstanden werden, insofern ist sie „Entschiedenheit zur Gestaltung des eigenen Lebens und so Basis menschlicher Selbstbestimmung“[77]. Erikson bringt Identität in den Zusammenhang mit einer Selbst-Stärke gewachsen aus einer erfahrenen Zuneigung durch Andere, die den Einzelnen zur anteilnehmenden personalen Interaktion befähigt. Dazu seien – besonders in der Adoleszenz - Vorbilder für die Ausprägung der Identität bedeutsam.[78] Verschiedene sozialwissenschaftliche Ansätze zur Identitäts bildung, wie sie z. B. mit Haußer vorliegen, können im Rahmen dieser Arbeit nicht behandelt werden, dennoch sei hingewiesen auf dessen Verständnis von der Ausprägung der personalen Identität anhand zyklischer Prozesse der Verarbeitung von situativen und über-situativen Erfahrungen mit der Identität als motivationale Quelle, die als Prozess wiederum Handeln generiert[79]. Insofern ist personale Identität nicht als Status zu sehen, „sondern der Deckname für einen Prozeß“[80]. Identität stellt sich ein, als Ergebnis einer ständigen Konstruktion, mit der der Mensch seine Erfahrungen in Relation zu seiner ihn umgebenden Umwelt bringt[81]. Damit wird hier eine Nähe zum handlungstheoretischen Ansatz des Persönlichkeitsbegriffs, der von einer komplexen wechselseitig gestaltenden Interaktion zwischen Individuum und seiner Umwelt ausgeht[82], beschrieben.
3 Werteorientierungen ausbildungsplatzmarktbenachteiligter Jugendlicher
Die Frage nach Orientierung, ´was soll ich tun?` ist immer auch eine Anfrage an Werte. Werte, die sich im Spannungsfeld zwischen dem Standpunkt des Individuums und den normativen Bedingungen in der Gesellschaft ausprägen und bewähren müssen. Aber ´welche Werte sollen gelten`? Diese Frage spitzt sich in einer zunehmend komplexen Lebenswelt, in der die Folgen des eigenen Handelns immer weniger überschaubar sind, für jeden Einzelnen zu. Die plurale, individualisierte Gesellschaft ist gekennzeichnet durch eine Vielfalt an unterschiedlichen Lebenslagen und –stilen, und dem Verlust der unhinterfragten Gültigkeit von orientierenden Instanzen, mit der Folge erweiterter Wahl- und Entscheidungsspielräume hinsichtlich der moralischen Orientierung und der Lebensgestaltung für den Einzelnen.
Auch wenn ein allgemeiner Wertehorizont keine universelle Gültigkeit mehr beanspruchen kann, so werden in gesellschaftlichen Teilbereichen z. B. der Berufsbildung, bestimmten Werten eine besondere Bedeutung beigemessen. Daher ist hier von Interesse, welche wertebezogenen Erwartungen an jugendliche Bewerber von Ausbildungsplätzen gestellt werden. Besteht in diesem Zusammenhang und in Hinblick auf einen erfolgreichen Übergang in die Berufsbildung, eine Abhängigkeit zwischen Ausbildungsplatzmarktbenachteiligung und Werteorientierungen? Zur Bearbeitung dieser Frage und letztlich mit Blick auf die Fragestellung dieser Arbeit, steht zu ermitteln, welche Werte ausbildungsplatzmarktbenachteiligten Jugendlichen wichtig sind. Dazu werden in Kap. 3.2 die Ergebnisse zweier empirischer Studien angefragt. Damit schließt sich die Frage nach gesellschaftlichen, sozialen und individuellen Einflussfaktoren auf die Werteorientierungen des Einzelnen, speziell hinsichtlich ausbildungsplatzmarktbenachteiligter Jugendlicher an, um schließlich sich daraus ergebende ethische Anfragen an die Gesellschaft zu thematisieren.
3.1 Ausbildungsplatzmarktbenachteiligte Jugendliche in der Risikogesellschaft
´Risikogesellschaft` titelt das Buch von Ulrich Beck zu den Folgen der Individualisierung, in dem eine damit einhergehende ´Produktion von Risiken` problematisiert wird[83]. Was bedeuten Individualisierung und Pluralisierung für die Orientierung des Einzelnen und was bedeutet ´Risikogesellschaft` für ausbildungsplatzmarktbenachteiligte Jugendliche? Welche Anforderungen stellen sich vonseiten der Berufsbildung, als Teilsystem der ´Risiko`-Gesellschaft an Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz anstreben? Welche Risiken stellen sich für ausbildungsplatzmarktbenachteiligte Jugendliche beim Übergang in das Berufsbildungssystem?
3.1.1 Orientierung in pluraler, individualisierter Gesellschaft?
Woher kann der Einzelne in pluraler, individualisierter Gesellschaft seine Orientierung beziehen? Früheren Generationen dienten als Orientierungsinstanzen v. a. der religiöse Glaube, Traditionen, kulturelle Standards und soziale Strukturen, in die das Individuum integriert war. Doch diese Instanzen haben zunehmend an Autorität und unhinterfragter Gültigkeit verloren, mit der Folge, dass es in unserer säkularen und pluralen Gesellschaft für den Einzelnen keine Gewissheit mehr gibt.
Für diese gesellschaftlichen Veränderungen können folgende Prozesse benannt werden. Zum einen die Säkularisierung, die den Prozess des Wandels von einer durch die Religion geprägten Gesellschaft zu einer neuzeitlich-moderne Gesellschaft, gekennzeichnet durch den Rückgang von religiösen Einflüssen in der Gesellschaft sowie zunehmender Privatisierung der Religion, beschreibt.[84] Desweiteren die Pluralisierung, mit der die Vielfalt von divergierenden Weltanschauungen beschrieben wird. Mit den gesellschaftlichen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Veränderungen sind auch traditionelle tragende Wertmuster in Bewegung geraten und das gelebte Ethos unterliegt durch pluralistische Vielfalt und der Konkurrenz der Werteangebote einer stetigen Veränderlichkeit, wodurch zum Teil die Tendenz zu einer Beliebigkeit von Werten feststellbar ist. Die eigenen Werte und Wertkonzepte werden von den Einzelnen hinterfragt, wodurch eine existenzielle Verunsicherung und Orientierungskrise ausgelöst werden kann. Durch das plurale Überangebot an Werten und das offene Orientierungsangebot entsteht ein ´Zwang einer Wahl`, welcher grundsätzliche Fragen nach Kriterien zur Wert- und Lebenswahl intendiert, denn die mit der Pluralität einhergehende Unübersichtlichkeit relativiert grundlegende lebenstragende Haltungsbilder.[85] Mit dem Begriff der funktionalen Differenzierung wird die Fragmentierung der Gesellschaft als Ganzes in einzelne funktionale, autonome Einheiten ohne regulierende Intersystemverbindungen beschrieben. Jedes dieser Systeme (z. B. Wirtschaft, Politik, Familie) agiert weitgehend nach eigenen Regeln und eigener Rationalität und nimmt alle anderen Systeme als ´Umwelt` wahr.[86] Zumindest bedeutet die funktionale Differenzierung für die christliche Ethik, sich einerseits Anfragen durch die vorhandene Wertepluralität und andererseits, sich dem Argument von begrenzter ´Zuständigkeit` stellen zu müssen. Für das Individuum bedeutet eine funktional differenzierte Gesellschaft die Herausforderung, sich für oder gegen die Teilhabe an Teilsystemen der Gesellschaft entscheiden zu müssen und sich jeweils separat zu integrieren.
Individualisierung beschreibt den Prozess zur Ablösung der vormodernen einheitlichen Gesellschaft. Unter Individualisierung werden die Freisetzung des Individuums aus traditionellen Bindungen und der damit einhergehende Zugewinn an Autonomie, aber auch der Verlust von traditionalen Sicherheiten gefasst[87]. Diese angesprochenen Zusammenhänge werden, im Rahmen dieser Arbeit, unter dem Blickwinkel Orientierung für ausbildungsplatzmarktbenachteiligte Jugendliche konkretisiert. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden sie als zwei Teilaspekte unter den Begriffen Pluralisierung und Individualisierung betrachtet.
Pluralisierung beschreibt den Prozess zu einer zunehmenden Vielfalt unserer Lebenswelt in vielen Bereichen, z. B. religiöser und politischer Pluralismus, Wertepluralismus. Diese Entwicklung ist grundsätzlich positiv zu bewerten, da mit ihr vielfältige Optionen für die Lebensgestaltung des Einzelnen einhergehen. Zunehmende Pluralisierung findet sich auch im Bereich Werte und Werthaltungen. Unter dem Schlagwort ´Wertepluralismus` wird bisweilen eine Diskussion geführt, in der gewandelte Werte mit ´Werteverfall` gleichgesetzt, und auf den Verlust gesellschaftlicher Sekundärtugenden reduziert werden. Dagegen hat sich in öffentlicher Diskussion als Konvention durchgesetzt „über Werte diskutiert man nicht […], Werte und Überzeugungen sind Privatangelegenheiten“[88], womit die Anforderung nach Orientierung an dem Einzelnen abgegeben wird. Im Rahmen dieser Arbeit kann auf die Wertediskussion nicht vertiefend eingegangen werden, vielmehr stehen die, sich durch die Pluralisierung an junge Menschen stellenden Anforderungen im Focus.
In pluraler Lebenswelt sieht sich der Einzelnen einer Vielzahl unterschiedlicher Werthaltungen gegenüber, womit sich für Jeden die Frage stellt, an welchen Werten er sich orientiert. Früheren Generationen bot sich eine größere moralische Sicherheit, da menschliches Tun „durch ein sehr engmaschiges Netz moralischer Tugend“[89] und geführt von der Interpretation des kirchlichen Lehramtes einer klaren Klassifikation in Form von ´richtig` und ´falsch` unterworfen war[90]. Auf diese klare Klassifikation und Einheitlichkeit kann heute nicht mehr zurückgegriffen werden, sondern die Vielfalt nebeneinander existierender Strömungen und Deutungsmuster in pluraler Lebenswelt führt zur Unbegreiflichkeit der Welt als Ganzes, in der der Einzelne die sinnhafte Integration der Lebensvollzüge selbst bestimmen muss[91]. Insofern stellt sich für den Einzelnen in der pluralisierten Gesellschaft die Anforderung, die Vielfalt der gesellschaftlich gelebten Wirklichkeit auf sich selbst bezogen zu ordnen und zu selektieren, um dadurch das System der individuellen Überzeugungen als integrierbares, sinnvolles Ganzes zu erhalten[92]. Aber wie kann er das? Woran kann der Einzelne sich heute bei seinen Entscheidungen orientieren? Auf welcher Grundlage können diese Entscheidungen getroffen werden und welche Fähigkeiten oder Eigenschaften erfordert eine autonome Entscheidung? In gleicher Hinsicht, wie die Pluralisierung dem Einzelnen Entscheidungsoptionen offeriert, stellen sich durch den Prozess der Individualisierung neue Entscheidungsanfragen an das Individuum.
Unter der Individualisierung werden das Herauslösen des Einzelnen aus vorgegebenen Sozialformen und sozialen Bindungen, aber auch der Verlust von Sicherheiten, sowie einer neuen Art der sozialen Einbindung verstanden. Beck beschreibt den Verlust von traditionalen Sicherheiten, wie Handlungswissen, Glaube und leitende Normen als ´Entzauberungsdimension` der Individualisierung.[93] Durch diesen fortlaufenden Prozess, in dem die regelnden Funktionen von Institutionen immer weiter in den Hintergrund geraten, stellt sich an das Individuum die Anforderung, das persönliche Leben „im Sinne eines Programms reflexiv gesteuerter Selbstentfaltung[94] “ zu ´konstruieren`[95], bzw. sich seine persönliche Existenz mehr oder weniger ohne handlungsleitende Regeln zu ´basteln`[96]. Somit sind mit der Individualisierung erweiterte Entscheidungsoptionen verbunden, die sich sowohl auf die Ausbildung einer eigenen Werthaltung, als auch auf die persönliche Lebens- und Biographieplanung beziehen.
Im Kontext dieser Arbeit sind Aspekte zur beruflichen Biographiesierung im Zuge der Individualisierung von Interesse. Während für vorindividualisierte Generationen die Wahl des Berufes und der beruflichen Biographie nicht entscheidungsoffen war, und z. B. weibliche Biographien überwiegend durch die Familie geprägt wurden, bietet sich dem Einzelnen heute - wenn auch nicht unbegrenzt - eine Vielzahl an Gestaltungsoptionen sowie die Perspektive, eine getroffene Entscheidung möglicherweise auch revidieren zu können oder zu müssen. Lebensläufe unterliegen nicht mehr einem durch soziale Strukturen vorgezeichneten Verlauf, als ´Normalbiographie`, dennoch ist der Einzelne als Planer seiner Biographie nicht entscheidungsoffen, denn die Entscheidungen über Ausbildung, Beruf, Arbeitsplatz, Kinderzahl usw. mit all ihren Unterentscheidungen können nicht nur, sondern müssen getroffen werden[97] und auch dort, „wo die Rede von ´Entscheidungen` ein zu hochtrabendes Wort ist, weil weder Bewusstsein noch Alternativen vorhanden sind, wird der Einzelne die Konsequenzen […] ´ausbaden` müssen“[98]. Insofern unterliegt der Lebenslauf des Individuums einer Dialektik von Freiheit und Repression, oder mit Beck/ Beck-Gernsheim ´riskanten Freiheiten`[99].
Neben berufsbiographischen Aspekten betrifft die Individualisierung den Verlust von leitenden Normen für den Einzelnen und damit die Frage nach moralischer Orientierung. Dieser Prozess, des zunehmenden Verlustes der regelnden Funktionen der Institutionen, bedeutet für den Einzelnen ein Zugewinn an Autonomie, demgegenüber aber auch ein Verlust an Stabilität. Zudem entsteht durch die Zunahme an Entscheidungsoptionen auch Wahlzwang, weil in Bereichen, in denen früher keine Entscheidung möglich war, z. B. in elementaren Fragen, wie jene das Lebensende betreffend, heute Entscheidungen nötig sind. Damit verschärft sich für jeden Einzelnen die Frage, an welchen Kriterien er sich auf seinem Weg zu einem erfüllten Leben und dem persönlichen Glück orientieren kann. Die Individualisierung wird auch als neuer Modus der ´Vergesellschaftung` dargestellt, weil an die Stelle traditionaler Bindungen neue Bindungen treten, z. B. Bedingungen des Bildungssystems, des Arbeitsmarktes und der Konsumexistenz, die den Lebenslauf des Einzelnen prägen und ihn mit den in ihnen enthaltenen Standardisierungen, gegenläufig zu der individuellen Verfügung, „zum Spielball von Moden, Verhältnissen, Konjunkturen und Märkten [macht]“.[100] Insofern wird Individualisierung zu einer Form markt-, rechts-, bildungs- usw. abhängiger Vergesellschaftung[101] mit neuen Vorgaben, die die Menschen in ihrer Suche nach Orientierung aufgreifen, die durch die neuen Freiheiten entstandenen Lücken werden gefüllt mit neuen Orientierungen, z. B. aus Massenmedien[102]. Somit stehen anstelle alter Verbindlichkeiten neue Instanzen und Institutionen, neue Zwänge werden geschaffen, die aber auf der Suche nach Orientierung keine neue Sicherheit anbieten.
Unter der Fragestellung nach einer Bezugsquelle für moralische Orientierung kumulieren die Herausforderungen durch die oben beschriebenen gesellschaftlichen Prozesse. Im Zuge der Pluralisierung sind sittliche und religiöse Wirklichkeitsdeutungen zahlreich und für den Einzelnen präsent geworden. Der christliche Glaube hat als sittliche Instanz seine unhinterfragte Gültigkeit verloren und ist im Zuge der Individualisierung zunehmend in den Raum der Privatsphäre gerückt. Für den Einzelnen ergibt sich mehr Freiheit und Autonomie, allerdings wird auch auf die Institutionalisierung eines Konsenses verzichtet, wodurch sich für den einzelnen Mensch die Anforderung ergibt, die disparaten Segmente der funktional ausdifferenzierten Gesellschaft[103] sowohl hinsichtlich seiner Lebensgestaltung, als auch für seine moralische Orientierung zu verknüpfen. Daher stellt sich nicht ´nur` die Frage, woher der Einzelne seine moralische Orientierung beziehen kann, sondern auch, welche Fähigkeiten und Eigenschaften er für die o. g. Anforderungen benötigt.
Im Rahmen dieser Arbeit stellt sich daher die Frage, wie ausbildungsplatzmarktbenachteiligten Jugendlichen eine konsensfähige moralische Grundlage aufgezeigt werden kann, aus der der Einzelne in der Risikogesellschaft selbstbestimmt seine Orientierung beziehen kann. Desweiteren besteht mit der geschilderten gesellschaftlichen Situation die Anforderung, ausbildungsplatzmarktbenachteiligten Jugendlichen eine Orientierung zur Lebensgestaltung zu bieten. Darüber hinaus kann es nicht ausreichend sein, den Jugendlichen entsprechende Optionen anzubieten, sondern es steht zusätzlich zu bedenken, mittels welcher personalen Voraussetzungen sich die Jugendlichen den dargestellten Anforderungen stellen können, und wie die berufliche Bildung sie in der Entwicklung bzw. Stärkung derer unterstützen kann.
3.1.2 Tugenden - Zugangsvoraussetzung in die Berufsausbildung?
Die ´Risikogesellschaft` mit den bisher dargestellten Entwicklungen zeigt auch Auswirkungen auf das gesellschaftliche Teilsystem Berufsbildung, und für diese Arbeit bedeutend, in besonderem Maße an der Übergangsschwelle von Schule in die Berufswelt. In der Tradition des dreigliedrigen deutschen Schulsystems war ein nach Bildungsniveau differenzierter und reibungsloser Übergang ins Berufsausbildungs- und Erwerbssystem durch die Zuordnung von Schulabschlüssen zu beruflichen Bildungsgängen vorgesehen. Diese klar strukturierten Übergangswege an der ersten Schwelle in die Berufswelt sind allerdings für immer weniger Jugendliche noch zutreffend.[104] Für leistungsstarke Jugendliche kann dieser Strukturverlust von Vorteil sein, indem die horizontale Durchlässigkeit und sich damit bietende Chancen genutzt werden können. Demgegenüber kann der Verlust der klaren Übergangsstruktur in die Berufswelt auch mit Unsicherheiten und dem Risiko, den Übergang nicht reibungslos oder gar nicht zu vollziehen, verbunden sein. Insbesondere problematisch sind diese Individualisierungsaspekte für Jugendliche, die die Schule mit einem niedrigen Bildungsniveau verlassen, weil diese Entwicklungen innerhalb der ´Risikogesellschaft` maßgeblichen Einfluss auf ihre Benachteiligung am Ausbildungsplatzmarkt haben.
In öffentlicher Diskussion, auch im Kontext des ´Ausbildungspaktes` verschiebt sich die Diskussion zur Thematik Ausbildungsplatzmarktsituation zunehmend von ´Ausbildungsplatzmangel` zum Verhältnis zwischen den individuellen Kenntnissen und Kompetenzen der Ausbildungsplatzbewerber einerseits und den Erwartungen und Anforderungen der Ausbildungsbetriebe andererseits. Aktuell scheinen wachsende Diskrepanzen zwischen den mitgebrachten und den erwarteten Zugangsvoraussetzungen wahrgenommen zu werden, wodurch der Thematik eine erhöhte Virulenz zukommt[105]. So werden von Vertretern der betrieblichen Berufsausbildung zum Teil pauschalisierend, Mängel in der Ausbildungsreife von Jugendlichen beklagt, die allerdings teilweise mit erhöhten Ansprüchen der ausbildenden Betriebe an die Bewerber erklärt werden können[106] und nicht unbedingt als Defizite auf der Bewerberseite gesehen werden können. Schließlich ziehen sich mit dem Wandel zur Wissensgesellschaft und der Strukturierung zu Rationalisierungs- und Reorganisierungsprozessen sowie der dadurch bedingten veränderten Strategien der Personalrekrutierung, viele Betriebe zunehmend aus der Ausbildung zurück[107], wodurch dann teilweise im ´verkürzten Umkehrschluss` aus der daraus resultierenden Nichtvermittelbarkeit der Jugendlichen ein Indikator für sinkende Ausbildungsreife der Jugendlichen gesehen wird. Im Zuge dieser Problematik sehen sich in Deutschland derzeit über 294.294 Jugendliche pro Jahr[108], beim Übergang von der allgemeinbildenden Schule in die Berufsausbildung einer Hürde gegenüber und gehen, trotz des aktuell entspannten Ausbildungsstellenmarktes[109] nach Beendigung der allgemeinbildenden Schule nicht in eine Berufsausbildung, sondern besuchen Schulformen des ´Übergangssystems`[110]. Mit Blick auf die aktuellen Zahlen der Ausbildungsplatzmarktstatistik (vgl. Kap. 2.1) und unter dem Eindruck der öffentlich geführten Diskussion zum (drohenden) Fachkräftemangel in verschiedenen Branchen und Wirtschaftszweigen, beispielsweise dem Handwerk, stellt sich die Frage: Warum verzichten ausbildende Betriebe jährlich auf die genannten 294.294 Jugendlichen? Welche Fähigkeiten oder Eigenschaften werden für den Zugang zur dualen Berufsausbildung vorausgesetzt, die einige Bewerber nicht mitbringen? Wodurch ist ´Ausbildungsreife` charakterisiert?
Zur Bearbeitung dieser Frage fokussiert sich der Blick auf die BEK als eine der Schulformen des ´Übergangssystems`. Eine Eingrenzung ist notwendig, da die Vielfalt des ´Übergangssystems` kaum zu überblicken und zudem bundeslandspezifisch ist. Für die Fokussierung auf die BEK seien zwei Gründe genannt, einerseits lieferte die Beobachtung einer BEK-Klasse den konkreten Anstoß zur Themenwahl für die vorliegende Arbeit und desweiteren ist die BEK ein vollständig neu konzipierter Bildungsgang, der in den Curricula als „eine sehr innovative Schulform“[111] bezeichnet wird. Diese Beschreibung weckt Erwartungen an eine zielgruppenspezifische Intention und Konzeption des neuen Bildungsgangs. In der Annahme, die Zielsetzung dieser Schulform spiegele den Bedarf der Schüler wieder, an die sich das Angebot der BEK richtet, erfolgt ein Blick auf die curricular formulierte Zielsetzung des Bildungsgangs BEK. Charakteristisch für eine Schulform des ´Übergangssystems` hat die BEK die Zielsetzung, diejenigen individuellen Kompetenzen von Jugendlichen zu verbessern, die zur Aufnahme einer Berufsausbildung oder Beschäftigung notwendig sind[112]. Darüber hinaus verfolgt die BEK das zentrale Anliegen, die Ausbildungsreife der Schüler zu erwirken, um sie für den Einstieg in die Berufs- und Ausbildungswelt zu qualifizieren[113]. Die spezifische Zielsetzung dieser Schulform ist demnach, jene Jugendliche, die bestimmte Eigenschaften, die sie als ´reif` gelten lassen für die Aufnahme einer Berufsausbildung, vermissen lassen, in der Entwicklung dieser Eigenschaften zu fördern, also zur ´Ausbildungsreife` zu führen. Wie ist der Begriff ´Ausbildungsreife` inhaltlich gefüllt? In der ´Handreichung für die Berufseinstiegsklasse` (BEK-Handreichung) wird der Begriff als „sehr vielschichtig und teils unterschiedlich interpretiert“[114] dargestellt, allerdings bestünde Einigkeit darüber, dass „unter ´Ausbildungsreife` nur solche Aspekte subsumiert werden können, die schon bei Antritt [Hervorh. d. Verf.] der Berufsausbildung vorhanden sein müssen“[115]. Welche Aspekte sind dies und welche Eigenschaften sind in dieser Sichtweise notwendig, um eine Berufsausbildung antreten zu können? Hierzu beruft sich die BEK-Handreichung auf die Befragung von ca. 500 Expertinnen und Experten für die Berufsausbildung[116], und nennt sehr konkret Eigenschaften wie Zuverlässigkeit, Lern- und Leistungsbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein, Konzentrationsfähigkeit, Sorgfalt, Rücksichtnahme, Höflichkeit, Toleranz, Fähigkeit zur Selbstkritik, Konfliktfähigkeit und die Bereitschaft, sich in betriebliche Hierarchien einzuordnen, welche als Sekundärtugenden einordbar sind. Dazu findet sich auch in der BEK-Handreichung explizit der Hinweis, unter ´Ausbildungsreife` seien diejenigen Fähigkeiten und Arbeit stugenden zu zählen, die für alle Ausbildungsberufe voraussetzend sind.[117] Damit kann festgehalten werden, dass im Bereich der Berufsausbildung bestimmte Arbeits-, Leistungs- und Sozialtugenden in der Berufsausbildung als unerlässlich angesehen werden, und von den Bewerbern erwartet wird, dass sie diese Tugenden bei Antritt der Ausbildung mitbringen.
Neben der spezifischen Zielsetzung der ´Ausbildungsreife` verfolgt die BEK das Ziel, „diejenigen individuellen Kompetenzen von Jugendlichen [zu verbessern], die zur Aufnahme einer Ausbildung oder Beschäftigung notwendig sind“[118]. Welches sind diejenigen Kompetenzaspekte, die zur Aufnahme einer Berufsausbildung als notwendig angesehen werden? In den Curricula ist das Kompetenzkonstrukt der KMK-Handreichung (vgl. Kap. 2.2) als Bildungsziel der BEK definiert[119]. In der Perspektive dieser Arbeit ist unter den einzelnen Kompetenzdimensionen insbesondere die Humankompetenz von Interesse. Diese umfasst gemäß den Rahmenrichtlinien für die BEK, „Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein“[120]. Dazu fällt ins Auge, dass hier personale Eigenschaften als Aspekte von Kompetenz dargestellt werden, die zum Teil identisch sind mit denen, die als Merkmale von ´Ausbildungsreife` benannt wurden, und zudem wiederum als Sekundärtugenden bezeichnet werden können. Desweiteren gehören zur Humankompetenz gemäß den BEK-Rahmenrichtlinien „insbesondere auch die Entwicklung durchdachter Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte“[121].
Der erfolgte Blick in die Curricula der BEK verdeutlicht die Rolle von sozialen Tugenden und Werten als Bildungsziele der BEK. Außerdem lässt sich damit die Bedeutung von sozialen Tugenden und Werten in der Berufsausbildung hervorheben, da die BEK zur Aufnahme einer Berufsausbildung befähigen soll. Implizit enthalten in den Formulierungen der Bildungsziele ist die Annahme, Schüler der BEK, entsprechend dem hier zugrunde gelegten Begriffsverständnisses sind dies ausbildungsplatzmarktbenachteiligte Jugendliche, bedürften in dieser Hinsicht einer besonderen Förderung. Daraus lässt sich wiederum die Annahme eines Zusammenhangs zwischen Ausbildungsplatzmarktbenachteiligung und vorliegenden Werteorientierungen ableiten. Daher stehen zunächst die Auswirkungen der ´Risikogesellschaft` für Jugendliche mit einem niedrigen Bildungsniveau an der Schwelle ins Berufsleben zu präzisieren. In der Folge zu klären, an welchen Werten sie sich in ihrer Lebenswelt und Lebensgestaltung orientieren.
3.1.3 Benachteiligt beim Zugang in die Berufswelt
Die Eingliederung in die berufliche Lebenswelt und damit in ein eigenverantwortliches Leben hat im Laufe der Adoleszenz eine hohe Bedeutung. Im deutschen beruflichen Bildungssystem kommt außerhalb von akademischen Berufen, für die Mehrheit der Jugendlichen (knapp 65% einer Jahrgangskohorte)[122], der beruflichen Erstausbildung im dualen System die Funktion einer Eintrittspforte in diesem Integrationsprozess zu, womit der Abschluss eines Ausbildungsvertrages eine Eintrittsschwelle darstellt. Durch die Individualisierung bieten sich bei der Berufswahl für den Einzelnen eine Vielfalt an Entscheidungsoptionen, z. B. ist die Wahl des eigenen Berufes, entgegen der Situation in der ständischen Gesellschaft, nicht mehr vollständig abhängig vom väterlichen Beruf und dem jeweiligen sozio-ökonomischen Status der Ursprungsfamilie, allerdings geht damit für benachteiligte Jugendliche an diese Schwelle in den Beruf auch das Risiko einher, die Schwelle und damit den Übergang in den Beruf nicht bewältigen zu können.
Damit werden Aspekte von Bildungsbenachteiligung und Selektionsprozessen im Bildungssystem, die ein weites Feld in verschiedenen Disziplinen darstellen, sowie eine aktuelle Diskussion in der Bildungspolitik angesprochen. Im Rahmen dieser Arbeit können nur ausgewählte Gesichtspunkte des komplexen Wirkungsgefüges von Merkmalen des Bildungssystems und sozial ungleichen Handlungsbedingungen und -folgen angesprochen werden. Im Folgenden sollen vor allem die sozialen Integrations- und Selektionsmechanismen, die mit dem dualen System der beruflichen Bildung verbunden sind, thematisiert werden.
Der Beruf hat für die gesellschaftliche Teilhabe, für die Sicherung der finanziellen Lebensgrundlage und auch für die Identität des Einzelnen eine hohe Bedeutung. Deutlich wird dies, wenn die Frage ´Was sind Sie?` vielfach mit der Bezeichnung des Berufes beantwortet wird. In diesem Verständnis ist der Beruf nicht nur Ausdruck einer gesellschaftlichen Funktion von Arbeitsteilung, sondern vielmehr Teil des soziokulturellen gesellschaftlichen Systems. Dementsprechend kann dem Beruf die Funktion eines Rahmens der individuellen Biographie, des Kerns der persönlichen Identität sowie eines Mediums der gesellschaftlichen Integration und Statuszuweisung zukommen.[123] Entsprechend fasst Greinert die Funktionen des Berufes, die als Prozess ebenso für die Berufsausbildung Geltung haben, zusammen. So habe der Beruf für den Einzelnen eine Qualifizierungsfunktion, da mit der Berufsausbildung eine spezifische Qualifikation in Form einer bestimmten beruflichen Handlungskompetenz erlangt und mit Zertifikaten belegbar wird. Für die Gesellschaft und den Einzelnen kann die Allokations-, Selektions- und Statusdistributionsfunktion des Berufes beschrieben werden, mit welcher der Einzelne durch die Berufsausbildung eine jeweils für seine Befähigung adäquate Position auf dem Arbeitsmarkt erlangen kann, bzw. sie ihm zugewiesen oder auch verwehrt werden kann. Die Absorptions- und Aufbewahrungsfunktion beschreibt die Vergesellschaftung des Einzelnen in der Sichtweise des Nutzens für die Gesellschaft. Während die Verwertungsfunktion den Nutzen der Berufsausbildung für den Einzelnen beschreibt, indem diese, im Idealfall für die Dauer des Erwerbslebens, als Erwerbsgrundlage fungiert. Ebenso für den Einzelnen hat die Integrationsfunktion, mit der die Sozialisation des Einzelnen in die Gesellschaft und die Lebenswelt der Erwachsenen aus Sichtweise des Individuums, sowie die Legitimation für das Innehaben des mit der Berufsausbildung erreichten sozialen Status zukommt, eine Bedeutung.[124] Aus theologischer Sicht kann die individuelle subjektive Bedeutung von Berufsarbeit, für die durch eine Berufsausbildung die Voraussetzungen gelegt werden, betont werden. Denn „Arbeit ist ein Gut für den Menschen – für sein Menschsein, weil er durch die Arbeit nicht nur die Natur umwandelt und seinen Bedürfnissen anpasst, sondern auch sich selbst als Mensch verwirklicht, ja gewissermaßen ´mehr Mensch` wird“[125].
Diese beiden Aspekte zur Propädeutik von beruflicher Erwerbsarbeit sollen die Bedeutung der Berufsausbildung als Eintritt in die Berufswelt verdeutlichen. Allerdings müssen sie an dieser Stelle genügen, denn vertiefende Perspektiven zum deutschen Berufsbegriff, zum Arbeitsethos und zu theologischen Dimensionen von Arbeit und Beruf, die wiederum Aspekte von Menschenwürde tangieren, können im Rahmen dieser Arbeit nicht verfolgt werden. Betont sei das der beruflichen Bildung in Deutschland zugrunde liegende Bildungsverständnis, in dem berufliche Bildung, in Anschluss an Kerschensteiner, als von den betrieblichen Anforderungen gelöstes, auf Vergesellschaftung bezogenes Erziehungsprinzip verstanden wird[126]. Damit grenzt sich die berufliche Bildung vom neuhumanistischen Bildungsverständnis, in dem die Allgemeinbildung der beruflichen Bildung entgegengesetzt wird, und Letztere die „pure Ausrichtung des Menschen auf Nützlichkeit unterstellt[127] “, womit die Einschränkung der individuellen Freiheit und Subjektwerdung einher gehe[128], ab (vgl. Kap. 2.2). Vielmehr besteht der Anspruch, die berufliche Bildung solle den Prozess der Vergesellschaftung und der sozialen Integration von Jugendlichen unterstützen und sie so auf ihrem Weg zu erwachsenen Mit-Gestaltern der ´Risikogesellschaft` befähigen[129]. Entsprechend ist auch das emanzipatorische Kompetenzverständnis der KMK als Bildungsziel zu verstehen, mit dem Jugendlichen einerseits für die Berufstätigkeit qualifiziert und sie anderseits zur Mitgestaltung ihrer Arbeitswelt und Lebenswelt befähigt werden soll[130]. Gelingt es nicht, diese beiden Zielsetzungen anti-dualistisch zu interpretieren, setzt sich die berufliche Bildung dem Verdacht aus, eines der Ziele zu vernachlässigen und eröffnet damit Wege, wie in den 1990er Jahren teilweise geschehen, ihren Bildungsauftrag durch von wirtschaftlichen Interessen geleiteten Argumenten kritisch hinterfragen zu lassen.[131] Damit kann die die sinn- und identitätsstiftende Funktion der Berufsausbildung für den Einzelnen und ebenso eine hohe gesellschaftliche, soziale, ökonomische und persönliche Bedeutung des Berufes und damit auch der Berufsausbildung festgehalten werden.
Die Stärke des dualen Berufsbildungssystems kann darin gesehen werden, dass es einer großen Mehrheit der Schulabgänger, die eine nichtakademische Laufbahn einschlagen, einen relativ ´sicheren` Weg in den Beruf und damit in die qualifizierte Erwerbsarbeit ebnet. Damit hat das duale System, eine entscheidende Funktion im Hinblick auf die Verteilung von Lebenschancen.[132] Demgegenüber scheinen allerdings für viele Jugendliche die Schwierigkeiten, ihre berufliche Einmündung erfolgreich aktiv zu gestalten, zugenommen zu haben und die Lebensphase Jugend ist in individualisierter Gesellschaft zu einem Lebensabschnitt der strukturellen Unsicherheit und Zukunftsungewissheit geworden[133]. Grundsätzlich weist das berufliche Bildungssystem zwar gegenüber der dreigliedrigen Struktur des allgemeinen Bildungssystems eine vergleichsweise große soziale Offenheit auf, schon weil der Zugang zu einer Ausbildung im dualen System[134] zumindest formell nicht an bestimmte, nicht mal an einen Schulabschlüsse gebunden ist. Allerdings ist die soziale Offenheit und damit auch die Zuweisung von Lebenschancen de facto dennoch eingeschränkt, denn die ausbildenden Betriebe kontrollieren auch den Ausbildungszugang, indem sie die Jugendlichen, denen sie einen Ausbildungsvertrag anbieten, auswählen. Die Besonderheit dabei ist, dass Schulabgänger aus allgemeinbildenden Schulen nicht auf der Basis bereits erlernter beruflicher Handlungskompetenz ausgewählt werden, sondern aufgrund ihrer potenziellen Eignung für das Erlernen berufsspezifischer Fertigkeiten und Kenntnisse werden Lebenschancen zugeteilt oder verwehrt. Durch dieses Vorgehen wird der Zugang zum dualen System entscheidend durch die Auswahl der ausbildenden Betriebe bestimmt, und da dieses Ausbildungssystem in beinahe allen Wirtschaftsbereichen und Branchen vorrangig vorhanden ist, bieten sich dem Einzelnen kaum alternative Wege in den Arbeitsmarkt.[135] Insofern spielt die ´erste Schwelle` in die Berufswelt, der Zugang zu einer Berufsausbildung im dualen System für die Mehrheit der Jugendlichen eine strategische Schlüsselrolle im Hinblick auf die Zuweisung von Lebenschancen.
Anhand welcher Kriterien entscheiden betriebliche Ausbildungspartner über die Eignung eines Bewerbers für den vakanten Ausbildungsplatz? Da die Auswahl durch die ausbildenden Betriebe nicht anhand von schon erworbenen beruflichen Qualifikationen erfolgen kann, stellt der erlangte Schulabschluss, das Bildungsniveau, das primäre Auswahlkriterium für die Betriebe dar. In dieser Hinsicht lassen sich in den letzten Jahrzehnten deutliche Verschiebungen feststellen. Während im Jahr 1970 noch 80% aller Auszubildenden über einen Hauptschulabschluss verfügten[136], betrug bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen im Jahr 2010 der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss 3,1% und mit Hauptschulabschluss 32,9%. Die Realschulabsolventen stellen mit 42,9% den Hauptanteil und 21% der Zugänge in die Berufsausbildung verfügen über die Studienberechtigung.[137] Der auffällig gesunkene Anteil der Hauptschulabsolventen bzw. –abgänger im dualen System wird häufig auf zunehmende soziale Verdrängungsprozesse durch die vermehrte Anzahl an Bewerbern mit höheren Bildungsniveaus zurückgeführt, vermutlich dürften ebenso soziale Selektionseffekte und negative Etikettierungen bzw. Stigmatisierungen eine bedeutende Rolle spielen. Nicht von der Hand zu weisen ist jedoch die veränderte Rolle der Hauptschule von der ehemaligen ´Volksschule` zu einer Schulart für lernschwache und benachteiligte Jugendliche.[138] Mit dieser Entwicklung haben sich auch die durchschnittlichen Chancen von Absolventen der Hauptschulen auf dem Ausbildungsmarkt negativ verändert und damit ihre Zugangschancen in die Berufswelt, wodurch wiederum ihr Zugang zu bestimmten sozialen Positionen eine Einschränkung erfährt. In diesem Sinne wird in Deutschland „eine soziale Fatalität dadurch gesetzt, dass die Mechanismen des Bildungssystems und der Positionszuweisung in der Arbeitswelt vorhandene Schichtunterschiede eher bestätigt als auflockert“[139]. Dementsprechend heben die Autoren der Shell-Jugendstudie Bildung als Schlüssel in der Biographie Jugendlicher hervor und betonen die Bedeutung des schulischen Erfolges als Weichenstellung für das weitere Leben. Dabei nehmen die befragten Jugendlichen die Schlüsselrolle der Bildung für den weiteren Lebensverlauf durchaus wahr, und entsprechend sehen Jugendliche denen kein Bildungsaufstieg winkt, ihre geringen Chancen und blicken mit wenig Optimismus auf ihre eigenen Möglichkeiten im Leben[140].
Damit stellt sich allerdings die Frage nach den Gründen für die Benachteiligung am Ausbildungsplatzmarkt. Warum werden Jugendliche mit einem geringen Bildungsniveau seltener als andere in die betriebliche Berufsausbildung aufgenommen? Lassen, aus Sicht der Ausbilder, ihre geringeren schulischen Leistungen ein geringeres Vermögen zum Erlernen beruflicher Fertigkeiten, Kenntnisse und Qualifikationen erwarten? Unter Beachtung der, von Berufsausbildungsexpertinnen und -experten genannten Faktoren von Ausbildungsreife (vgl. Kap. 3.1.2), scheint bemerkenswert, dass hierzu in erster Linie Sekundärtugenden genannt wurden und erst in zweiter Linie Aspekte von Bildung, sowie kognitive Aspekte keine Erwähnung hinsichtlich einer ´Reife` zur Berufsausbildung finden. Kann dementsprechend von einem Verständnis eines Zusammenhangs zwischen niedrigem Bildungsniveau und Mängeln im Verfügen über Sekundärtugenden vonseiten der Ausbilder ausgegangen werden? In der Wertediskussion werden teilweise Sekundärtugenden und Werte unzureichend voneinander abgegrenzt, kann es daher bei den geäußerten, bei Bewerbern erwünschten Sekundärtugenden auch implizit um Werte gehen? Weisen ausbildungsplatzmarktbenachteiligte Jugendliche in der Mehrheit Werteorientierungen auf, bzw. äußern sie Werteorientierungen, die von denen der Mehrheit der Jugendlichen abweichen? Daher steht in Kap. 3.2 die Frage an Ergebnisse aus der empirischen Sozialforschung zu Werteorientierungen ausbildungsplatzmarktbenachteiligter Jugendlicher an.
3.2 Werteorientierungen ausbildungsplatzmarktbenachteiligter Jugendlicher im Spiegel empirischer Jugendforschung
Durch die beschriebenen gesellschaftlichen Veränderungen stellen sich an den Einzelnen ganz unterschiedliche soziale, institutionelle und individuelle Anforderungen, die er jeweils für sich in Einklang bringen muss. Besonders Jugendliche sind der Individualisierung in einem expliziten Masse ausgesetzt, daher stellt sich die Frage nach empirischen Ergebnissen. Wie gehen Jugendliche mit den Herausforderungen um? Welche Wertewirklichkeit schaffen sich insbesondere ausbildungsplatzmarktbenachteiligte Jugendliche angesichts der gesellschaftlichen Entwicklungen?
Zu Lebens- und Werteorientierungen Jugendlicher gibt es eine Vielzahl empirischer Untersuchungen, von denen die Shell-Jugendstudie derzeit wohl zu den aktuellsten öffentlich diskutierten empirischen Studien gehören dürfte, sowie die Studie zu ´Lebensorientierungen Jugendlicher. Alltagsethik, Moral und Religion in der Wahrnehmung von Berufsschülerinnen und –schülern in Deutschland`[141]. Beide Studien liefern Daten zu Werteorientierungen Jugendlicher, allerdings verwendet die Feige-Gennerich-Studie, im Gegensatz zur Shell-Jugendstudie, eine bewusst vom kirchlich-religiösen Sprachgebrauch abweichende Semantik zu wertbezogenen Befragungs-Items[142]. Aus diesen Gründen erfolgt für die empirische Grundlegung zur Thematik dieser Arbeit ein Blick auf die Ergebnisse dieser beiden Studien. Darüber hinaus liegt eine Vielzahl weiterer Studien (z. B. Sinus-Milieu-Studie) vor, die allerdings im Rahmen dieser Arbeit nicht angefragt werden können. Die Auswertung der Daten aus den beiden genannten Studien bezogen auf ausbildungsplatzmarktbenachteiligte Jugendliche, gemäß dem Begriffsverständnis in Kap. 2 eingegrenzt als Jugendliche ohne oder mit maximal einem Hauptschulabschluss, sowie die dafür verwendeten Daten, befinden sich im Anhang (vgl. Anhang 2 und 3) dieser Arbeit.
Wodurch kennzeichnen sich die Werteorientierungen dieser Gruppe Jugendlicher? Die Shell-Jugendstudie stellt für alle befragten Jugendlichen im Mittel eine hedonistische, aber leistungsorientierte Werteorientierung[143] heraus, und für Jugendliche mit niedrigem Bildungsniveau bezüglich mehrerer Faktoren von der Mehrheit abweichende Werteorientierungen[144]. Mit den Ergebnisse der Feige-Gennerich-Studie können für ausbildungsplatzmarktbenachteiligter Jugendliche im Mittel überwiegend eher selbstorientierte und materialistische Werteorientierungen erwartet werden[145].
Zusammenfassend können als Ergebnis der Anfrage an empirische Daten folgende Aussagen zu Werteorientierungen ausbildungsplatzmarktbenachteiligter Jugendlicher getroffen werden. Sowohl mit der Shell-Jugendstudie als auch mit der Feige-Gennerich-Studie kann eine Abhängigkeit zwischen Ausbildungsplatzmarktbenachteiligung und den Werteorientierungen der Jugendlichen angenommen werden. Es besteht ein, wenn auch an einer kleinen Stichprobe, belegter Zusammenhang zwischen Ausbildungsplatzmarktbenachteiligung und materialistischen, autonomie- sowie statusbezogenen Werteorientierungen. Jugendliche ohne oder mit maximal einem Hauptschulabschluss bewerten viele Werte aus dem gesellschaftlichen, partnerschaftlichen und religiösen Kontext abweichend von Jugendlichen mit einem höheren Bildungsniveau. So werden z. B. in einer Partnerschaft fremdgehen, Vertrauensmissbrauch und Gewalt deutlich eher akzeptiert als von der Mehrheit der Jugendlichen[146]. Es sei allerdings betont, dass es sich hierzu um relativ geringe Zustimmungsquoten handelt und daher lediglich als Tendenzen aufzeigend zu interpretieren sind.
[...]
[1] Gadamer, Hans-Georg, zit. n. Stoeckle 1975, 243
[2] Anmerkung: Jugendliche wird hier synonym mit ´jungen Menschen` gebraucht. Der Begriff bezieht sich nicht auf eine juristische Definition oder eine konkrete Altersspanne.
[3] Anmerkung: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird hier für Lehrerinnen und Lehrer, sowie für Schülerinnen und Schüler die männliche Form verwendet, die weibliche Form aber impliziert.
[4] Vgl. Tamke 2008, 2005
[5] Vgl. Noelle-Neumann/ Petersen 2001, 15
[6] Vgl. Tamke 2010, 231
[7] Vgl. Niedersächsischer Landtag 2000, 1 f
[8] Vgl. Niedersächsisches Schulgesetz 1998, § 2 Abs. 1
[9] Vgl. Berufsbildende Schulen Osnabrück Brinkstraße 2012, 1 (exemplarisch ausgewählt)
[10] Vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2008, 163 f
[11] Vgl. Statistisches Bundesamt 2012, 1
[12] Vgl. Konietzka 2010, 291
[13] Vgl. BIBB 2012 c, 5
[14] Vgl. BMBF 2012, 11
[15] Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2012 , 1
[16] Vgl. BIBB 2012 c, 5
[17] Vgl. ebd.
[18] Vgl. Colemann 1987, 179
[19] Anzenbacher 2003, 31
[20] Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2008, 163 f
[21] Vgl. Rützel 2002, 3 f
[22] Konsortium Bildungsberichterstattung 2006, 79
[23] Vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2010, 97 f
[24] Vgl. BMBF 2012, 34
[25] Vgl. a. a. O., 49
[26] Vgl. BMBF 2012, 11
[27] Vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2010, 99
[28] Vgl. KM 2010 b, 14
[29] Vgl. KM 2010 a, 5
[30] Vgl. Schelten 2004, 65
[31] Vgl. Schmidt 1998, 17
[32] Vgl. Bader/ Müller 2002, 176
[33] Vgl. Cycoll 2006, 272
[34] Vgl. Tramm 1994, 39 f
[35] Arendt 1978, 49
[36] Vgl. Kurtz 2002, 9
[37] Vgl. Czycoll 2006, 271
[38] Vgl. Tramm 1994, 39
[39] Aebli 1980, 15
[40] A. a. O., 18
[41] Vgl. Aebli 1980, 99
[42] Vgl. Seeber/ Nickolaus 2010, 10
[43] Vgl. Klieme/ Hartig 2007, 19
[44] Vgl. Klieme et al. 2003, 22
[45] Vgl. a. a. O., 73
[46] Vgl. Brand et al. 2005, 3 ff
[47] Vgl. Spöttl/ Musekamp 2009, 21
[48] Sekretariat der KMK 2007, 10
[49] Sekretariat der KMK 2007, 11
[50] Vgl. Sekretariat der KMK 2007, 11
[51] Ebd.
[52] Vgl. Bader/ Müller 2002, 176
[53] Vgl. KM 2010 a, 5
[54] Vgl. Ehrenthal et al. 2005, 4
[55] Vgl. Höffe 1998, 46 f
[56] Vgl. Mieth 1984, 19
[57] Vgl. a. a. O., 33 f
[58] Vgl. Mieth 1984, 19
[59] Vgl. a. a. O., 36 f
[60] Vgl. Höffe 1998, 47
[61] Vgl. Anzenbacher 1998, 118
[62] Stoeckle 1975, 244
[63] Pieper 1974, 284
[64] Vgl. Beirer 1995, 85
[65] Vgl. Weber 1991, 320
[66] Vgl. Mieth 1984, 15
[67] Vgl. Quante 2008, 138
[68] Vgl. Eid 1975, 270
[69] Vgl. Beirer 1995, 81
[70] Vgl. Höffe 2007, 308 f
[71] Vgl. Eid 1975, 270 f
[72] Vgl. Albert et al. 2010 a, 28; Vgl. Feige et al. 2008 b, 27
[73] Vgl. Beirer 1995, 85
[74] Vgl. Auer 1975, 53
[75] Marcia, James E. 1980, zitiert nach Haußer 1983, 21
[76] Haußer 1983, 11
[77] Beirer 1995, 79 f
[78] Vgl. Fleischer 1975, 149
[79] Vgl. Haußer 1983, 104 f
[80] Maurer 1995, 33
[81] Vgl. ebd.
[82] Vgl. Ulrich 1982, 94
[83] Vgl. Beck 1986, 25
[84] Vgl. Vorgrimler 2008, 555
[85] Vgl. Beirer 1995, 76 ff
[86] Vgl. Luhmann, Paradigm Lost, 1988, zit. n. Höffe 2007, 33
[87] Vgl. Beck 1986, 206
[88] Lesch 1995, 145
[89] Römelt 1996, 119
[90] Vgl. Römelt 1996, 119
[91] Vgl. Goertz 1998, 339
[92] Vgl. Luhmann 1973, 224
[93] Vgl. Beck 1986, 205 f
[94] Kudera 1995, 86
[95] Vgl. Kudera 1995, 86
[96] Vgl. Hitzler/ Honer 1994, 310
[97] Vgl. Beck 1986, 216
[98] A. a. O., 216 f
[99] Vgl. Beck/ Beck-Gernsheim 1994, Titel
[100] Beck 1986, 211
[101] Vgl. Beck 1986, 210
[102] Vgl. Kos 2010, 5
[103] Vgl. A. a. O., 4
[104] Vgl. Lex/ Geier 2010, 164
[105] Vgl. Frommberger 2010, 3
[106] Vgl. Hilger/ Servering 2010, 97
[107] Vgl. Dobischat et al. 2009, 131 f
[108] Vgl. BMBF 2011, 42
[109] Vgl. BMBF 2012, 11
[110] Vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2010, 96
[111] KM 2010 a, 2
[112] Vgl. Konsortium Bildungsberichterstattung 2006, 79
[113] Vgl. KM 2010 a, 3
[114] A. a. O., 4
[115] Ebd.
[116] Anmerkung: Genannt werden 89 Ausbilder, 64 Lehrer an berufsbildenden Schulen, 87 Mitgliedern von Berufsbildungsausschüssen, 54 Forschern und Entwicklern sowie 188 sonstigen Experten. Vgl. Ehrenthal et al. 2005, 1
[117] Vgl. KM 2010 a, 3
[118] Konsortium Bildungsberichterstattung 2010, 95
[119] Vgl. KM 2010 b, 5
[120] Ebd.
[121] Ebd.
[122] Vgl. BMBF 2011, 11
[123] Vgl. Arnold/ Gonon 2006, 74 f
[124] Vgl. Greinert 1998, 146 ff
[125] Papst Johannes Paul II. 1981, Laborem Exercens 9
[126] Vgl. Arnold/ Gonon 2006, 56 f
[127] Rebmann et al. 2003, 102
[128] Vgl. Rebmann et al. 2003, 102
[129] Vgl. a. a. O., 98
[130] Vgl. Sekretariat der KMK 2007, 9
[131] Vgl. Tramm 1994, 43
[132] Vgl. Konsietzka 2010, 297
[133] Vgl. Albert et al. 2010 a, 38
[134] Anmerkung: dies gilt für alle (z. Zt. 344) anerkannten Ausbildungsberufe nach § 4, 5 BBiG und § 25 Handwerksordnung, jedoch nicht für Ausbildungsberufe an vollqualifizierenden Berufsfachschulen z. B. im Gesundheitswesen.
[135] Vgl. Konsietzka 2010, 281 ff
[136] Vgl. Tessaring 1993, 138
[137] Vgl. BIBB 2012 a, 155
[138] Vgl. Konietzka 2010, 290
[139] Gensicke 2010, 192
[140] Vgl. Albert et al., 16 f
[141] Anmerkung: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird der umfangreiche Titel der Studie als Feige-Gennerich-Studie bezeichnet.
[142] Vgl. Feige 2008, 220
[143] Vgl. Anhang 2, 6 f
[144] Vgl. Anhang 2, 7
[145] Vgl. Anhang 2, 19
[146] Vgl. Anhang 2, 18
- Arbeit zitieren
- Ines Triphaus-Giere (Autor:in), 2012, Können Tugenden moralische Orientierungen für benachteiligte Jugendliche auf dem Ausbildungsmarkt bieten?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210300