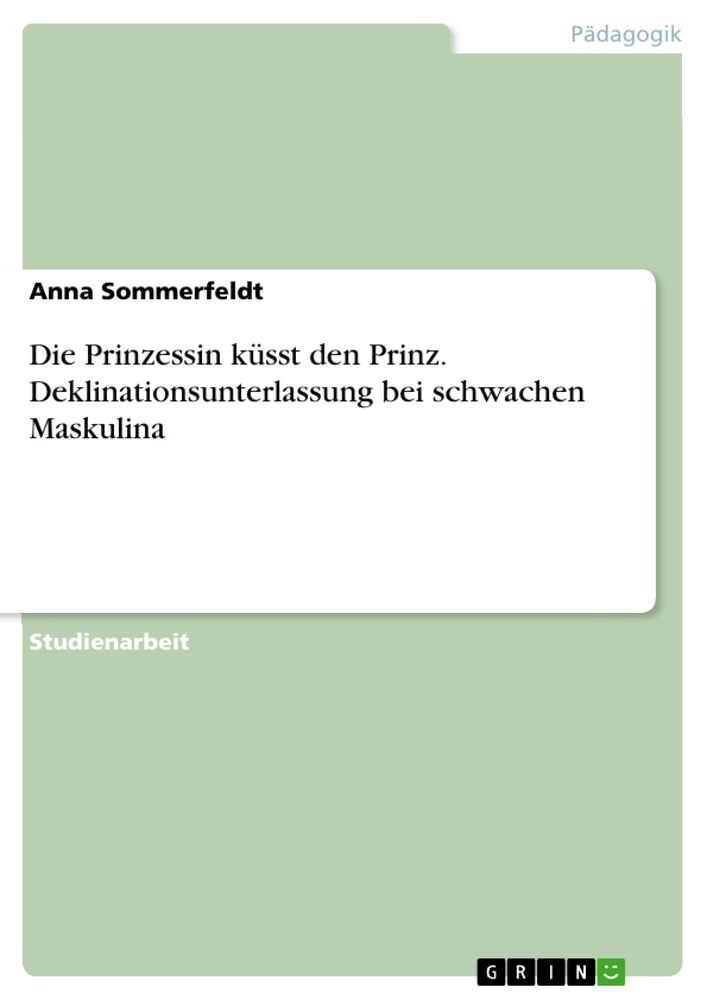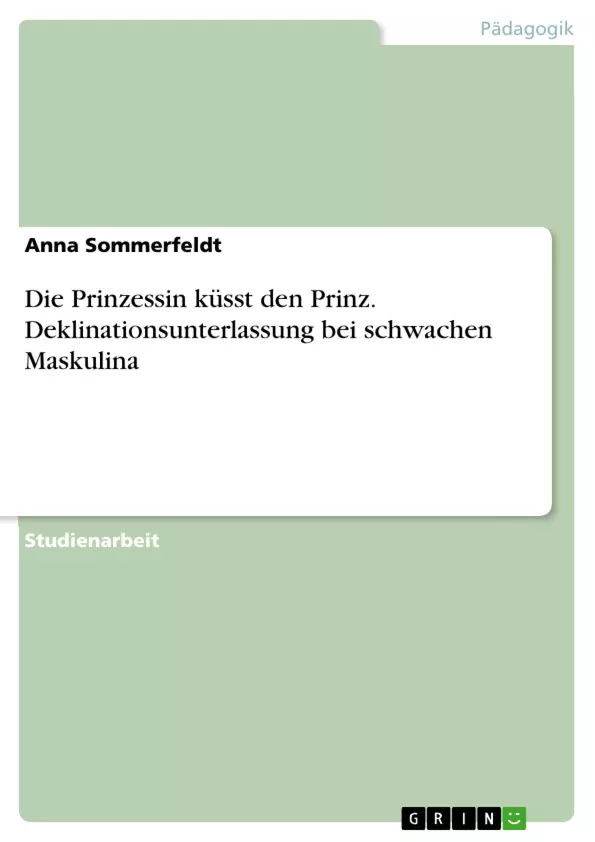Zeigt man die Überschrift dieser Hausarbeit verschiedenen Personen, so werden einige nach dem Fehler erst suchen müssen. Laut Duden wird das Substantiv Prinz schwach dekliniert. Demnach müsste an den Prinz noch die Endung en angehängt werden. Doch ist dieser Satz so, wie er im Titel steht wirklich falsch, oder handelt es sich hierbei um einen Sprachwandel, der die Grammatikregeln verändern wird?
Die vorliegende Arbeit knüpft an Köpckes Aufsatz an. Schwerpunkt ist hier allerdings der sprachwissenschaftliche Hintergrund. Dabei steht besonders die Entwicklung des grammatikalischen Problems, der Flexion von Nomen im Singular, in den letzten Jahren im Fokus. Die Grundlage der Erkenntnisse über die neusten Entwicklungen in diesem Bereich stellt die Arbeit von Thieroff und Vogel dar.
Am Anfang dieser Arbeit wird zunächst die Einteilung in Flexionsklassen von Peter Eisenberg und die der Duden Redaktion vorgestellt. Anschließend folgt ein historischer Abriss, in dem die Entwicklung der schwachen Deklination kurz dargestellt wird. Danach wird die wissenschaftliche Diskussion um die Deklinationsunterlassung im Singular bei schwachen Maskulina beleuchtet.
Um die Meinung der Laien zu ermitteln, wurden Passanten in der Kieler Innenstadt befragt. Da dies nur eine Stichprobe darstellt, wurden auch die Treffer bei der Suchmaschine Google ermittelt, die bei verschiedenen Wortkombinationen auftraten. Auch die COSMAS-Datenbank diente, mit einigen ausgewählten Wörtern, als Hintergrund für die Analyse.
Abschließend werden die gesammelten Ergebnisse diskutiert und kritisch beleuchtet, denn es soll letztendlich die Frage geklärt werden, ob das genannte Phänomen als grammatikalischer Fehler oder als zulässiger Sprachwandel zu bewerten ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Deklinationsklassen
- Nominalflexion starker Maskulina
- Nominalflexion schwacher Maskulina
- Nominalflexion gemischter Maskulina/Neutra
- Flexionsklassenwechsel in der Literatur
- Historischer Abriss
- Sprachwandel oder Fehler?
- Positionen von wissenschaftlichen Werken
- Verwendung schwacher und starker Deklination
- Befragung Kieler Passanten
- Treffer bei Google, COSMAS Korpusanalyse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das sprachwissenschaftliche Phänomen des Deklinationswechsels bei schwachen Maskulina im Singular, insbesondere im Kontext des Satzes „Die Prinzessin küsst den Prinz“. Dabei geht es darum, zu untersuchen, ob die vermeintliche Deklinationsunterlassung ein grammatischer Fehler oder ein Sprachwandel ist, der die Regeln der deutschen Grammatik möglicherweise verändern wird.
- Entwicklung der schwachen Deklination im Singular
- Wissenschaftliche Diskussion um die Deklinationsunterlassung
- Analyse von Sprachdaten aus verschiedenen Quellen (Google, COSMAS-Datenbank, Befragung von Passanten)
- Bewertung des Phänomens als grammatikalischer Fehler oder Sprachwandel
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Kontext der Arbeit vor. Sie beleuchtet die wissenschaftliche Diskussion um das Phänomen des Deklinationswechsels und gibt einen Überblick über die verwendeten Methoden. Kapitel 2 erläutert die verschiedenen Flexionsklassen, die nach Peter Eisenberg und dem Duden Grammatik unterschieden werden, und fokussiert dabei insbesondere auf die Nominalflexion starker und schwacher Maskulina. Kapitel 3 befasst sich mit dem historischen Abriss der Deklination und der wissenschaftlichen Diskussion um den Deklinationswechsel. Die Ergebnisse der Befragung Kieler Passanten und der Analyse von Google-Suchergebnissen und der COSMAS-Datenbank werden in Kapitel 4 dargestellt. Schließlich werden die gewonnenen Erkenntnisse in einem Fazit diskutiert und bewertet.
Schlüsselwörter
Deklinationswechsel, schwache Maskulina, Sprachwandel, grammatikalischer Fehler, Nominalflexion, Flexionsklassen, Duden Grammatik, Eisenberg, COSMAS-Datenbank, Google, Befragung, Sprachdaten, wissenschaftliche Diskussion.
Häufig gestellte Fragen
Ist „den Prinz“ statt „den Prinzen“ ein grammatischer Fehler?
Laut Duden ist es eine schwache Deklination und müsste „den Prinzen“ heißen. In der Sprachwissenschaft wird jedoch diskutiert, ob dies ein zulässiger Sprachwandel ist.
Was ist die schwache Deklination bei Maskulina?
Schwache Maskulina erhalten in allen Kasus außer dem Nominativ Singular die Endung -en (z. B. der Bär, des Bären, dem Bären, den Bären).
Warum lassen Sprecher die Endungen bei schwachen Maskulina oft weg?
Dies liegt oft an einem Flexionsklassenwechsel hin zur starken Deklination, bei der im Akkusativ keine zusätzliche Endung nötig ist.
Was zeigt die Analyse von Google- und COSMAS-Daten?
Die Daten zeigen, dass die Form ohne -en im Alltagsgebrauch und im Internet extrem häufig vorkommt, was auf einen fortschreitenden Sprachwandel hindeutet.
Wie bewerten Laien dieses Phänomen?
Umfragen zeigen, dass viele Sprecher den „Fehler“ gar nicht mehr als solchen wahrnehmen oder ihn als weniger störend empfinden.
- Quote paper
- Anna Sommerfeldt (Author), 2012, Die Prinzessin küsst den Prinz. Deklinationsunterlassung bei schwachen Maskulina, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210355