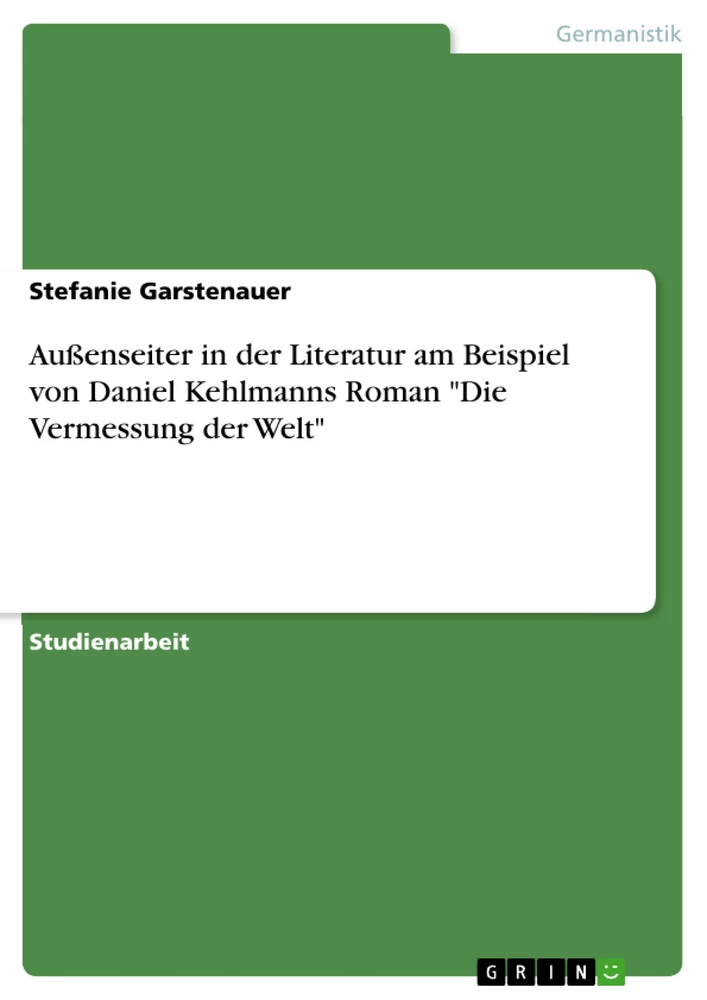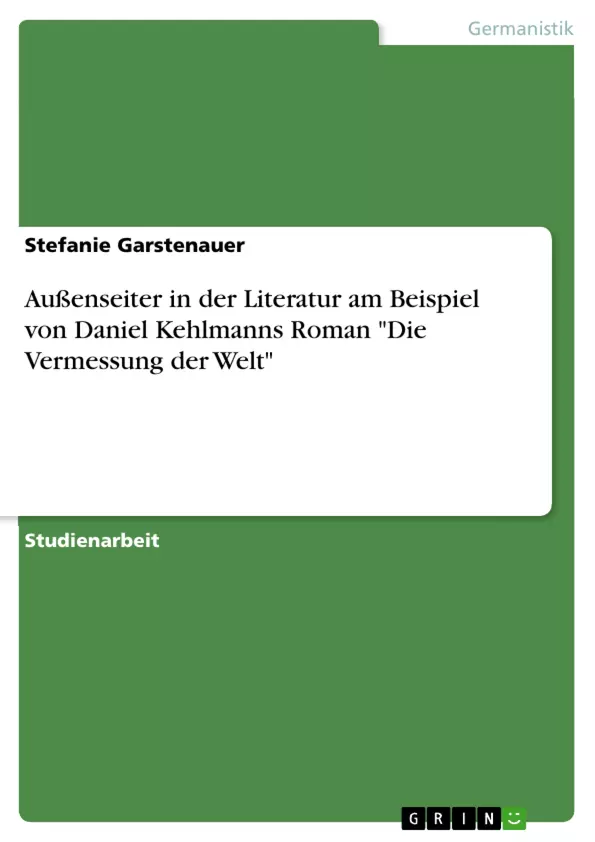In der vorliegenden Arbeit wird der Aspekt des Außenseitertums im Verhältnis zur Wissenschaft in Daniel Kehlmanns „Die Vermessung der Welt“ anhand der beiden Protagonisten Alexander von Humboldt und Carl Friedrich Gauß beleuchtet. Aufgrund der Aktualität des Werkes ist der Forschungsstand bisher noch relativ wenig fortgeschritten. Am meisten Beachtung fand das Buch in der literarischen Diskussion bisher beim Thema der nur teilweise gegebenen Authentizität der Darstellung von Humboldt und Gauß, welche oftmals auf Kritik stieß, wobei die die Unterscheidung zwischen den realen, historischen Persönlichkeiten und der Fiktionalität der Romanfiguren wohl des Öfteren nicht ausreichend beachtet wurde. Insbesondere der der Arbeit zugrunde liegenden Aspekt „Wissenschaft und Außenseitertum“ ist jedoch in der Sekundärliteratur noch kaum speziell betrachtet worden. Ausgehend von theoretischen Positionen wird in einer Textinterpretation untersucht, inwiefern die beiden Wissenschaftler im Roman durch ihre Genialität tatsächlich ausgegrenzt sind. Hierfür wird zunächst erläutert, inwiefern sich die beiden absoluten Insider ihrer jeweiligen Disziplinen dennoch als gesellschaftliche, soziale, politische, berufliche und zumindest im Fall von Humboldt auch geographische Außenseiter bezeichnen lassen. Zusätzlich wird die Frage aufgeworfen, ob ihr Außenseiterstatus konstitutiv für ihre wissenschaftliche Arbeit ist, oder umgekehrt ihre Wissenschaftlerrolle die Ausgegrenztheit bedingt.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Wissenschaftliche Positionen zu Wissenschaft und Außenseitertum
3. Wissenschaft und Außenseitertum in Daniel Kehlmanns „Die Vermessung der Welt“
3.1. Außenseiterstatus der Protagonisten
3.2. Gegenseitige Beeinflussung von Wissenschaft und Außenseitertum anhand der Protagonisten
4. Schlussbetrachtung
5. Literaturverzeichnis
- Arbeit zitieren
- Stefanie Garstenauer (Autor:in), 2011, Außenseiter in der Literatur am Beispiel von Daniel Kehlmanns Roman "Die Vermessung der Welt", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210396