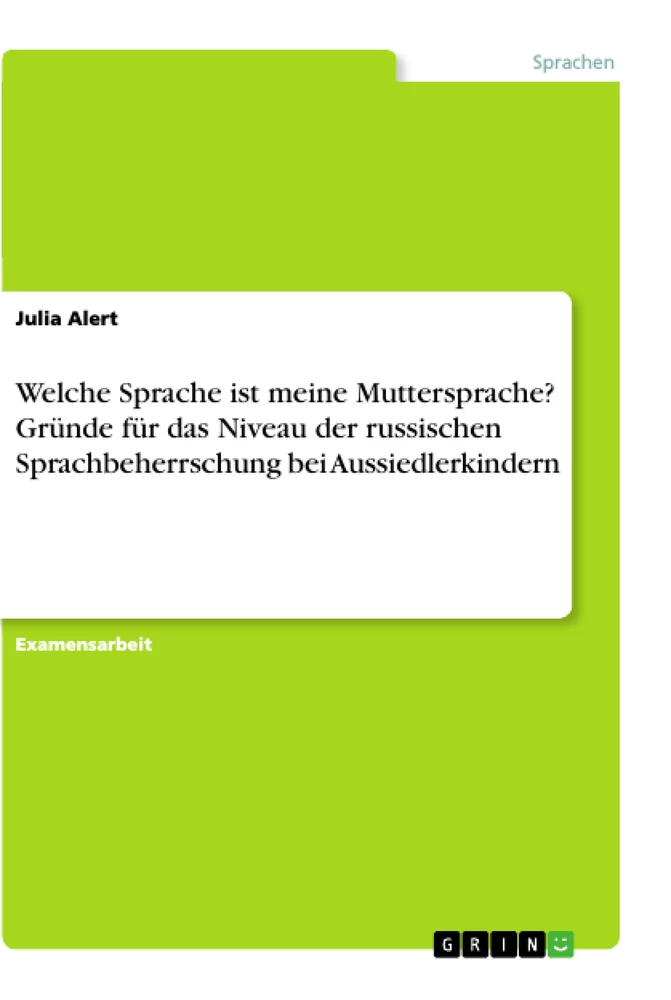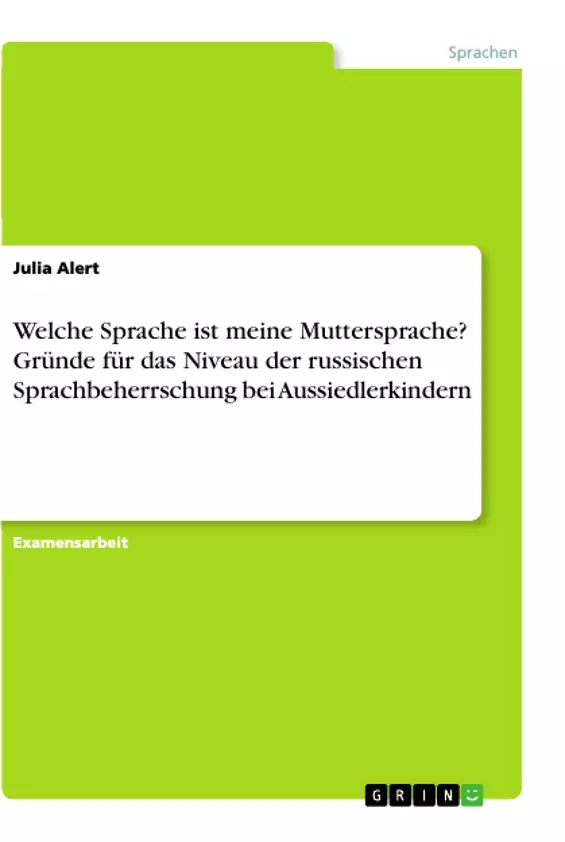In den letzten fünfzig Jahren ist Deutschland zu einem Vielvölkerstaat
geworden. Nicht nur durch wirtschaftliche Gründe bestimmte Zuwanderung
der ausländischen Arbeitskräfte hat dazu beigetragen. Mit der Milderung in der
Auswanderungspolitik der Ostblockstaaten und der späteren Auflösung der
UdSSR bekamen die ethnischen Deutschen, die in diesen Regionen lebten, eine
Möglichkeit in ihre historische Heimat zurück zu kehren.
Viele jungen Aussiedler und Spätaussiedler starteten ins Erwachsenenleben
schon in Deutschland. Wie erfolgreich haben sie sich in die Neue Gesellschaft
integriert? Was und wie viel von der mitgebrachten Kultur geben sie ihren
Kindern weiter? Wie hoch sind der Stellenwert und das Niveau der russischen
Sprache in ihren Familien? All diese Fragen gehören in den soziolinguistischen
Teil dieser Arbeit. Geschichtliche Situation im Herkunftsland und
Integrationsschwierigkeiten, welche diese Menschen anfangs in Deutschland
hatten, werden einige Rückschlusse über die Kulturidentität dieser Gruppe
geben. Ausgehend von diesen Feststellungen ist der Stellenwert der russischen
Sprache zu ermitteln. Diese Erkenntnisse sind für den zweiten,
strukturlinguistischen Teil dieser Arbeit wichtig. Denn die Sprachkenntnisse,soweit solche überhaupt vorhanden sind, und der Grad der Interferenzen ins Russische bei den Kindern, die in Deutschland geboren oder im Kleinkindalter eingereist sind, hängt in sehr hohem Maße von der elterlichen Auffassung der Realität bezüglich der russischen Sprache und Kultur. Es ist nicht das Ziel dieser Arbeit Schlussfolgerungen zu ziehen, die für alle Aussiedlerfamilien ihre Gültigkeit haben. Es wird allerdings angestrebt ein konkretes Handlungsmuster auszuarbeiten, das zum Verlust oder Erhalt der russischen Sprache bei Kindern, also bei der zweiten Generation, führt. Die Richtung der Sprachentwicklung wird durch einige Sprachbeispiele dokumentiert.
Diese Arbeit basiert größtenteils auf einer Befragung, welche die angesprochenen Aspekte erörtert und viele Beispiele der Kindersprache liefert.
Trotz der großen Menge an Fachliteratur zur Bilingualität und Mehrsprachigkeitsforschung, die aus verschiedenen Blickwinkeln den
Gegenstand untersucht, gibt es nur sehr wenige Arbeiten, die sich mit der
Sprache der Aussiedler beschäftigen.
Inhalt
I. Einleitung
II. Hauptteil
1. Exkurs in die Geschichte
1.1. Situation im Herkunftsland
1.2. Kulturelle und sprachliche Identität
1.2.1. Zum Identitätsbegriff
1.2.2. Sprachliche Identität
1.2.3. Kulturelle Identität
1.3. Zwischenfazit
2. Situation in Deutschland
2.1. Sprachliche Barriere
2.2. Die Verhaltensmuster von Einwanderern
2.2.1. Die Assimilation
2.2.2. Die Integration
2.2.3. Die Isolation
2.2.4. Die Dissimilation
2.3. Zwischenfazit
3. Sprachliche Situation der Migrantengemeinschaft
3.1. Deutsch in einer Aussiedlerfamilie
3.2. Russisch derAussiedler
3.2.1. Die mitgebrachte Sprache
3.2.2. Veränderungen der Sprache in Deutschland
3.2.3. „Aussiedlerrussisch“
3.3. Zwischenfazit
4. „Neuland“ Zweisprachigkeit
4.1. Definition
4.2. Staatliche Sprachpolitik
4.3. Einstellung in der Familie
4.3.1. Russisch wird nicht akzeptiert
4.3.2. Russisch ist ein Teil des Alltages
4.3.3. Russisch wird weitergegeben
4.4. Zwischenfazit
5. Empirische Untersuchung
5.1. Strukturlinguistische Terminologie
5.2. Allgemeine Merkmale der Testpersonen
5.3. DerFragebogen
5.3.1. Ausgangshypothese
5.3.2. Der Fragebogen (Text)
5.3.3. Gliederung und Erläuterungen
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
5.4. Durchführung der Befragung
5.5. Auswertung
5.5.1. Ergebnisse der Befragung
Zu dem 1. Teil
Zu dem 2. Teil
Zu dem 3. Teil
Zu dem 4. Teil
Zu dem 5. Teil
Zu dem 6. Teil
5.6. Zwischenfazit
6. Das Niveau der russischen Sprache
6.1. Ausgewählte Sprachbeispiele
6.1.1. Phonetisch unauffällige Sprache
6.1.2. Der starke phonetische Einfluss
6.2. Zwischenfazit
III. Schlussbetrachtung
IV. Literatur
V. Anhang
1.1. Die Fragebögen
I. Einleitung
In den letzten fünfzig Jahren ist Deutschland zu einem Vielvölkerstaat geworden. Nicht nur durch wirtschaftliche Gründe bestimmte Zuwanderung der ausländischen Arbeitskräfte hat dazu beigetragen. Mit der Milderung in der Auswanderungspolitik der Ostblockstaaten und der späteren Auflösung der UdSSR bekamen die ethnischen Deutschen, die in diesen Regionen lebten, eine Möglichkeit in ihre historische Heimat zurück zu kehren. „In der Zeit zwischen 1980 und 2007 waren das mehr als 2,3 Millionen Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion.“1 In wieweit politische, kulturelle oder wirtschaftliche Aspekte sich auf die Auswanderungsentscheidung dieser Menschen auswirkten, sei dahin gestellt. Doch es ist unumstritten, dass diese neuen Mitbürger einen großen Teil der Heimatkultur mitgebracht haben. Es steht ebenso außer Frage, dass für Viele die Sprache ein Indikator der Kulturzugehörigkeit ist. Für die meisten Sowjetuniondeutschen2 ist die russische Sprache zu Muttersprache geworden. Aus diesem Grund werden sie in der einheimischen Bevölkerung schlicht und einfach „Russen“ genannt. Nur die Wenigsten kennen die geschichtlichen Hintergründe dieser Menschen, die ihr Leben lang „Deutsche“ hießen. Sie bekamen einen besonderen politischen Status in Deutschland und in der offiziellen Sprache werden „Aussiedler“ und „Spätaussiedler“3 genannt.
Viele jungen Aussiedler und Spätaussiedler starteten ins Erwachsenenleben schon in Deutschland. Wie erfolgreich haben sie sich in die Neue Gesellschaft integriert? Was und wie viel von der mitgebrachten Kultur geben sie ihren Kindern weiter? Wie hoch sind der Stellenwert und das Niveau der russischen Sprache in ihren Familien? All diese Fragen gehören in den soziolinguistischen Teil dieser Arbeit. Geschichtliche Situation im Herkunftsland und Integrationsschwierigkeiten, welche diese Menschen anfangs in Deutschland hatten, werden einige Rückschlusse über die Kulturidentität dieser Gruppe geben. Ausgehend von diesen Feststellungen ist der Stellenwert der russischen Sprache zu ermitteln. Diese Erkenntnisse sind für den zweiten, strukturlinguistischen Teil dieser Arbeit wichtig. Denn die Sprachkenntnisse, soweit solche überhaupt vorhanden sind, und der Grad der Interferenzen ins Russische bei den Kindern, die in Deutschland geboren oder im Kleinkindalter eingereist sind, hängt in sehr hohem Maße von der elterlichen Auffassung der Realität bezüglich der russischen Sprache und Kultur. Es ist nicht das Ziel dieser Arbeit Schlussfolgerungen zu ziehen, die für alle Aussiedlerfamilien ihre Gültigkeit haben. Es wird allerdings angestrebt ein konkretes Handlungsmuster auszuarbeiten, das zum Verlust oder Erhalt der russischen Sprache bei Kindern, also bei der zweiten Generation, führt. Die Richtung der Sprachentwicklung wird durch einige Sprachbeispiele dokumentiert.
Diese Arbeit basiert größtenteils auf einer Befragung, welche die angesprochenen Aspekte erörtert und viele Beispiele der Kindersprache liefert. Trotz der großen Menge an Fachliteratur zur Bilingualität und Mehrsprachigkeitsforschung, die aus verschiedenen Blickwinkeln den Gegenstand untersucht, gibt es nur sehr wenige Arbeiten, die sich mit der Sprache der Aussiedler beschäftigen. Das sind vor allem die Studien von Katharina Meng und Nina Bernd4. Ihre Untersuchungen beziehen sich allerdings nicht direkt auf die Zweisprachigkeit der Kinder. Bei K. Meng findet man sehr gute Sprachbiographien. Die Sprachentwicklung von drei Kindern wird detailliert beschrieben, von der Beurteilung der Situation und Verallgemeinerung ihrer Ergebnisse im Bezug auf Kinder sieht siejedoch ab.5 Es wird ein treffendes Bild der Großeltern heutiger Kinder, die im Mittelpunkt meiner Untersuchung stehen, gezeichnet. Und obwohl, oder gerade deswegen, die genannte Arbeit 2000 erschien, entsprechen viele Schlussfolgerungen nicht mehr der Realität. Außerdem findet man als „Insider“ bei der Autorin einige Unstimmigkeiten, die daraufhindeuten, dass sie nicht zu der Aussiedlergruppe gehört. Es sind Kleinigkeiten, welchejedoch ein leicht verzerrtes Bild geben. Dies ist nicht der Fall bei N. Bernd. Ihr sehr interessantes und authentisches Werk macht einige Probleme der Aussiedler in Deutschland verständlicher, da gibt es auch Vorschläge, wie man vor allem sprachliche Integration beschleunigen und verbessern kann. Dennoch sind in der Arbeit keine Informationen zu Kindern der Russlanddeutschen vorhanden. E. Protassova6 beschäftigt sich wie auch E. Zemskaja7 mit der Entwicklung der russischen Sprache im Ausland. Ihre Arbeit über die russische Sprache bei Kindern ist als Anleitung zur bilingualen Erziehung sehr wertvoll. Sie ist aber nicht sehr aufschlussreich im Bezug auf in der vorliegenden Arbeit behandeltes Thema. Somit musste ich auf die Arbeiten zurückgreifen, die sich mit der Zweisprachigkeit bei den Ausländerkindern beschäftigen. Dabei ist zu bedenken, dass bei diesen Untersuchungen eine andere geschichtliche, kulturelle und rechtliche Basis als Ausgangspunkt genommen wurde, deshalb wird der Gegenstand der oben genannten Arbeiten oft aus einem anderen Blickwinkel betrachtet als bei Aussiedlern. Viele theoretische Anhaltspunkte für meine Untersuchung bot die „Einführung in die Mehrsprachigkeitsforschung“8 von N. Müller et al.
II. Hauptteil
„Die Sprache als Ausdrucksmittel oder Trägermedium der Kultur wird bei einer eingewanderten Gruppe in der Zielgesellschaft oft als eines der wichtigsten Merkmale der Identität betrachtet.“9 Da die überwiegende Mehrheit der eingewanderten Russlanddeutschen Russisch spricht, werden die Mitglieder dieser Minderheit in der deutschen Gesellschaft als „Russen“ identifiziert. Deswegen ist zunächst einmal zu klären, wie aus den Deutschen, die auf den Territorien der Sowjetunion lebten, „Russen“ wurden. Des Weiteren wird die Einstellung zu der eigenen Identität, in der auch die Sprache mit einbegriffen ist, in der Aussiedlergemeinschaft genau betrachtet. Der Stand der russischen Sprache in Deutschland, der gegenseitige Einfluss der beiden Sprachen und die Einstellung zur Zweisprachigkeit sowohl in der Gesellschaft als auch gruppenintern werden als nächstes untersucht. Daraus folgende Schlüsse dienen als Hintergrundwissen für die empirische Untersuchung, die mit Hilfe einer Fragebogenaktion durchgeführt wurde. Durch die Aktion gewonnene Erkenntnisse werden den Schlussfolgerungen aus dem ersten Teil gegenüber gestellt, um die bereits aufgestellten Thesen zu bekräftigen oder zu widerlegen.
1. Exkurs in die Geschichte der Sowjetuniondeutschen
In den folgenden Kapiteln wird ein Versuch unternommen unter der Berücksichtigung des geschichtlichen Hintergrunds, die soziale, kulturelle und sprachliche Situation dieser Gruppe darzustellen. Dies soll zum besseren Verständnis des „Andersseins“ der Aussiedler und ihrer Schwierigkeiten in Deutschland, welche direkten Einfluss auf die russische Sprache haben, beitragen.
Um die Zusammenhänge der komplexen Identität der Aussiedler verständlich zu machen, ist ein kurzer Exkurs in die Geschichte der Russlanddeutschen unerlässlich.
1.1. Situation im Herkunftsland
Fast drei Hundert Jahre haben die Deutschen in Russland ihre Sprache und Kultur bewahren können. Natürlich war diese Sprache nicht einheitlich, ihre Bräuche wiesen ebenso einige Unterschiede auf, doch sie waren Deutsche. „Ende der 20er Jahre des 20. Jh. existierten in der Sowjetunion 2024 deutsche Siedlungen; die größte deutsche Sprachlandschaft bildete die wolgadeutsche Sprachinsel.“10 Diesem friedlichen Nebeneinanderleben verschiedener Völker wurde in der Mitte des letzten Jahrhunderts ein Ende gesetzt. Durch den zweiten Weltkrieg wurden die Deutschen nicht nur umgesiedelt, sie wurden als Feinde stigmatisiert. Die Entwicklung, welche man in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts beobachtete, ist als Folge der Politik in der Kriegs- und Nachkriegszeit zu verstehen. Durch Deportationen verlor die Gemeinschaft ihre relative Geschlossenheit, welche unter anderem ein sehr wichtiger Faktor in der Sprachentwicklung und Spracherhaltung war. Die einzelnen Familien wurden in verschiedene und oft weit von einander entfernte Ortschaften angesiedelt. Die Sprachkontakte zwischen den deutschsprachigen Menschen waren aufgrund der Entfernung auf die Familie beschränkt.11 Das Leben in der neuen Umgebung forderte Kenntnisse anderer Sprachen, vor allem des Russischen, Kasachischen, Kirgisischen. Die Deutschen waren aber nicht das einzige „verdächtige“ Volk. Nach Kasachstan wurden viele anderen ethnischen Minderheiten wie Tschetschenen, Griechen, Türken, Koreaner, Kurden deportiert. Diese Aufzählung soll eine ungefähre Vorstellung von dem multikulturellen Hintergrund vieler Familien, die aus Kasachstan nach
Deutschland kamen, verdeutlichen. Außerdem soll sie das Verständnis über die Unterschiede in Lebenserfahrungen bezüglich der eigenen Nationalität der Aussiedler erleichtern.
Die Situation der Deutschen in der Sowjetunion hat sich nach Stalins Tod verändert. Die Menschen konnten ihren Wohnort im Umkreis der neuen Wohngebiete selbst bestimmen, dadurch entstanden kleinere Gebiete, in die die Deutschen mit dem gleichen Sprachdialekt siedelten. Aber „es kann nicht die Rede davon sein, dass die sprachliche Entwicklung und die Sprachsituation auch annähernd die früheren Konstellationen angenommen haben.“12 Man darf auch die Migration innerhalb eines Staates in der zweiten Hälfte des 20. Jh. aus dem Blickfeld nicht verlieren. Sie hat sich sowohl in Russland bzw. Sowjetunion, als auch in Deutschland aus bestimmten wirtschaftlichen Gründen verstärkt. Es gibt wahrscheinlich nicht sehr viele Familien, die seit Generationen in einem Ort leben. Für die Mehrheit mag es unbedeutend sein, doch für eine ethnische Minderheit und deren Kulturidentität ist es verhängnisvoll.
1.2. Kulturelle und sprachliche Identität
In diesem Kapitel werden die wichtigsten Gründe für die Minderung der Sprachkenntnisse und der Veränderung der kulturellen Identität bei den Sowjetuniondeutschen kurz skizziert.
1.2.1. Zum Identitätsbegriff
Zunächst soll festgelegt werden, was im Allgemeinen unter dem Begriff „Identität“ zu verstehen ist und wie es in dieser Arbeit gebraucht wird. Dazu einige Definitionen: „In einem auf die Person bezogenen Sinne ist mit Identität hier eine Selbst- oder Fremdzuordnung zu einem Identitätsangebot oder - entwurf gemeint. Identität ist die Überzeugung des Menschen, trotz Veränderung der Umwelt bzw. des eigenen Äußeren und der eigenen Weiterentwicklung ein und dieselbe Person zu bleiben.“13 Dasselbe kann über die Gruppenidentität gesagt werden. Wenn auch nur ein Minimum von den Merkmalen erhalten bleibt, wird eine Gruppe weiterhin als solche selbst- und fremdidentifiziert.
Da die Identifizierung über und durch Sprache verläuft, werden viele Aussiedler, die ethnisch und rechtlich gesehen Deutsche sind, als „Russen“ identifiziert. Hier findet man auch die Begründung des Wunsches mancher Migranten, möglichst schnell und restlos die Sprache als das stärkste Identifikationsmerkmal loszuwerden.
1.2.2. Sprachliche Identität
Für die in der Sowjetunion lebenden verschiedenen Völker war die russische Sprache mehr als eine lingua franca. Diese war die Sprache der primären Sozialisation im Kindergarten und die Bildungssprache in den meisten Regionen. Der deutschen Sprache14 wurde nur der Status einer Fremdsprache in der Schule und Hochschule zugeteilt. Die Dialekte wurden nur in den Familien gesprochen. „Deutsch war im Herkunftsland stigmatisiert und wurde im öffentlichen Sprachgebrauch nach Möglichkeit vermieden bzw. unauffällig verwendet.“15 Von einem Muttersprachunterricht war selbst in den Sprachinseln nicht die Rede, zumindest was die offizielle Bildung betrifft16. Die Religionsgemeinschaften konnten eine gute Grundlage und Stütze für den Erhalt der Sprache bilden, aber noch vor zwanzig Jahren durfte es offiziell keinen Gott geben. Die Glaubensgemeinden existierten mehr oder minder im Untergrund.
Es gab kaum eine Differenzierung der Funktionsbereiche der beiden Sprachen, das Russische ersetzte in vielen Situationen das Deutsche. Die Sprache verlor ihren Stellenwert, was nicht selten zum Sprachwechsel geführt hat.
Angesichts dessen sind die Ergebnisse der Untersuchung von N. Berend, die sie bei Aussiedlern durchgeführt hatte, nicht weiter verwunderlich: 64 Prozent der Befragten sind in einem deutschen Dialekt sozialisiert, aber nur 13 Prozent konnten kurz vor der Ausreise besser Deutsch sprechen als Russisch. Doch alle können Russisch lesen, sprechen und schreiben.17 Die deutsche Sprache als Indikator der Kulturzugehörigkeit und wichtigster Merkmal der Identität verlor nach und nach ihre Bedeutung. Somit wurde die deutsche Identität durch andere Eigenschaften bestimmt.
1.2.3. Kulturelle Identität
Der größte Teil dieser Menschen blieb außerhalb der oben erwähnten Sprachinseln. Verstreut in verschiedenen Orten wurden die Sowjetuniondeutschen „dem sozialen Zwang zur kulturellen Anpassung“18 an die neuen Lebensbedingungen ausgesetzt, was „ nicht selten eine Umgestaltung des bisherigen sozialen, kulturellen und persönlichen Identitätsprofils“19 zufolge hatte.
So ist es dazu gekommen, dass viele Deutsche in dreißig - vierzig Jahren nach dem Kriegsende nur wenige Bruchteile ihrer Sprache und Kultur bewahrt haben. Oft waren es nur der Name und die Nationalitätszugehörigkeit, welche in vielen behördlichen Unterlagen, auch in einem Klassebuch in der Schule eingetragen wurden. Das Bild des deutschen Feindes (für viele nichtdeutsche war der Unterschied zwischen Faschisten und Deutschen nicht bewusst) trug dazu bei, dass auch diese Erkennungszeichen durch Mischehen gern versteckt wurden.
Infolgedessen haben sich die meisten assimiliert, dies bedeutet, dass sie im gewissen Grade „die sozialen, kulturellen Werte, Normen und Verhaltensweisen übernahmen“20. Das soll nicht heißen, dass es keinen Einfluss der russischen oder einer anderen Kultur vor dem zweiten Weltkrieg gegeben hat, doch die oben beschriebenen Ereignisse haben diesen Prozess um das vielfache beschleunigt. Es soll auch nicht heißen, dass mit dem weitgehenden Verlust der Sprache auch die Identität verloren gegangen war. Außer der Sprache und dem Namen gab es bestimmte Kriterien, welche die Zugehörigkeit zur deutschen Nationalität kennzeichneten. Das Bild der Sowjetuniondeutschen kann man auf folgende Eigenschaften reduzieren: diese Menschen waren akkurat, sehr zuverlässig, gewissenhaft, reinlich, arbeitsam, sehr enthaltsam bezüglich des Alkoholkonsums. Die genannten Qualitäten sind sehr wahrscheinlich der früheren Religionszugehörigkeit entsprungen und trugen dazu bei, dass die meisten Deutschen relativ wohlhabend waren. Katharina Meng bringt es auf den Punkt: „Die Selbstidentifizierung als Deutsche beruht einerseits auf bestimmten kulturellen Traditionen des Arbeitsund Alltagslebens und andererseits auf Fremdidentifizierung durch deutsche und russische bzw. sowjetische Institutionen und Behörden.“21 Um die Gerechtigkeitswillen sei an dieser Stelle gesagt, dass solche Verhältnisse bei vielen Nationalitäten, die in der Sowjetunion lebten, die Norm waren.
1.3. Zwischenfazit
Es kann kein Kulturvakuum geben, oder wie es M. Kuhn-Lääs formuliert:
„Eine absolute kulturelle Entwurzelung ist nicht möglich, denn irgendeiner Kultur fühlen sich trotz identifikatorischer Ambivalenzsituationen (im Bezug auf die Dichotomie: Herkunftskultur / Umgebungskultur) eingewanderte Individuen zugehörig.“22 Auf dem Hintergrund der „Wenigbeachtung“ aller anderen Kulturen, außer russischen, welche „viele Völker und Kleinstaaten zu einer großen, starken, gerechten und Glück bringenden Macht zusammengeführt hat“23, ist es nicht weiter verwunderlich, dass die russische Sprache die einzige gründlich gelernte und injeder Sphäre des sowjetischen Lebens präsente war. „Nur eine gemeinsame Sprache kann soziale Bindungen und soziale Interaktionen zwischen den Individuen ermöglichen. Nur durch diese verbindende Funktion der Sprache ist die Übernahme des kulturellen Erbe der Vergangenheit und das Gefühl der kulturellen Zusammenhängigkeit in der Gegenwart möglich.“24 Diese Funktion des Deutschen wurde erfolgreich durch die russische Sprache übernommen. Was für viele unverständlich erscheint, war für ethnische Deutsche angesichts der Dialektenvielfalt, geographischen Zerstreutheit und antifaschistischen, sprich antideutschen, Einstellung in der Gesellschaft eine der wenigen Möglichkeiten ihre Kultur und relative Einheit zu bewahren.
Wenn man also Identitätsfindung als ein Prozess versteht, der in einer sozialen Umgebung stattfindet, und als dessen Grundlage Kommunikation, die zum Großteil sprachlich vermittelt ist, annimmt, dann bedeutet dieser Prozess das Hereinwachsen in die Symbolwelt einer Kultur, in der bestimmte Werte, Regeln, Symbole gelten25. Es soll daher unumstritten sein, dass in den Vielvölkerregionen wie Kasachstan diese Gruppe einiges von den Nachbarkulturen, die sich in der gleichen Situation befanden, aufgenommen hat. Auf diesem Hintergrund erscheint die Bezeichnung „русские немцы (russkije nemcy)“ - russische Deutschen statt „российские немцы (rossijskije nemcy)“ - Russlanddeutschen gar nicht so falsch.
2. Situation in Deutschland
In diesem Kapitel wird die Situation der Generation von jungen Aussiedlern erläutert, zu der die Eltern der in dieser Arbeit untersuchten Kinder zu zählen sind. Der geschichtliche Hintergrund ist für das Verständnis des gesamten Bildes sehr wichtig. Das Leben in Deutschland vor allem im Anfangsstadium istjedoch ausschlaggebend für die Einstellung zur russischen Sprache und Kultur.
Der Höhepunkt der Auswanderung aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland kommt auf die Mitte der 90-ger Jahre, von 1995 bis 1997. Sehr viele junge Menschen, die in der russischen Sprache und überwiegend in der russischen Kultur aufgewachsen sind, wanderten damals in die Bundesrepublik ein. Dass die wenigsten einigermaßen die deutsche Sprache beherrschten, wurde bereits besprochen. Dies stellte allerdings nur ein Teil der Schwierigkeiten dar, denn „nicht das Zusammentreffen zweier Sprachen [Sprachsysteme] das Hauptproblem darstellt; viel gravierender ist der Zusammenprall zweier Wirklichkeitsmodelle, die eng mit der Herkunfts- und mit der Zielsprache verbunden, ganz verschiedenen soziokulturellen Kontexten angehören. Wenn hier Spannungen auftreten, dann ist die Sprache daran zwar als Indikator und wohl wichtiges Vehikel, nicht aber ursachlich beteiligt.“26
2.1. Sprachliche Barriere
Sowohl die Aussiedler als auch die Mehrheit der einheimischen Bevölkerung hat alle Schwierigkeiten und Probleme der neuen Mitbürger in eine direkte Verbindung mit den Sprachkenntnissen gesetzt. „Aufgrund politischer Definitionen gelten sie hier als Deutsche und erleben auf Schritt und Tritt die Erwartung, sie müssten doch ihren russischen Anteil ablegen, vergessen, aufgeben und nur noch Deutsch sprechen. Dies gilt im gängigen Sinn als "Integration". Die Mehrheitskultur definiert "Deutsch" als positiv.“27 Aus fester Überzeugung, dass nur mit guten Kenntnissen der deutschen Sprache sie in der Gesellschaft akzeptiert werden, liefen die Einwanderer im Kreis. Denn, vereinfacht ausgedruckt, es gibt keinen Kontakt ohne Sprache. Andererseits ist es fast unmöglich ein ausreichendes Niveau der Sprache ohne Kontakt zu erreichen. Nichtjeder Ortsansässige war bereit das Fremde zu akzeptieren und sich bei der „Entzifferung“ des Gesagten anzustrengen. Denn, wie es bereits erwähnt wurde, entspringt die Andersartigkeit der Aussiedler weniger dem Sprachmangel, sondern viel mehr ihrer Lebensart, derer archaischen Zeichen der Angehörigkeit zur deutschen Kultur hier weder verstanden noch anerkannt wurden. „Die Mitgliedszuweisungen waren vielfach ausgrenzend, Russisch wurde in Deutschland negativ bewertet, seine Sprecher oft als 'Russen' kategorisiert. Das Zurückgeworfensein auf die Eigengruppe führte wieder zu einem verstärkten Gebrauch des identitätsstiftenden oder doch Mitgliedschaft anzeigenden Russischen.“28
Im Grunde genommen fand eine einfache Definition statt: spricht man Deutsch, wird man als solcher anerkannt, hat man nur sporadische oder gar keine Sprachkenntnisse, wird man nicht angenommen. Die Hundertjahre lange Geschichte der Deutschen außerhalb des Landes ist irrelevant. Darin steckt das größte Missverständnis zwischen Einheimischen und Aussiedlern. Dass Integration viel mehr beinhaltet als nur Sprachkenntnisse, ist vielen Menschen aufbeiden Seiten heute noch nicht bewusst.
2.2. Die Verhaltensmuster von Einwanderern
In über zehn Jahren seit 1995 hat sich in Deutschland Vieles verändert. Die meisten Deutschen wussten damals nicht, warum auf einmal so viele Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland kamen. Dementsprechend reagierten viele Einheimischen gestresst und ablehnend. „Die Fremdheit oder sogar die Unkenntnis dieses Wirklichkeitsmodels ist eine Ursache für die Entstehung des Gefühls der Distanziertheit sowie der emotionalen, psychosozialen Probleme, die aber irrtümlicherweise oft ausschließlich auf die Erwerbsschwierigkeiten einer zweiten Sprache zurückgeführt werden, vor allem, wenn Einwanderer eine zweite Sprache im Erwachsenenalter lernen müssen.“29 Die Situation der relativen Abgrenzung führte zu unterschiedlichen Strategien der Eingewöhnung an die neuen Lebensumstände. M. Kuhn-Lääs unterscheidet dabei zwei Arten der Motivation, die den einen oder den anderen Verhaltensmuster erklären. „Instrumentale“ Motivation impliziert den Wunsch die Sprache gut zu beherrschen, um einen Nutzen für seine soziale Fortentwicklung zu bekommen. Diejenigen Menschen, die eher daran interessiert sind sich in die „Zielgesellschaft“ zu integrieren und ein anerkanntes Mitglied dieser zu werden, sind durch „integrative“ Motivation bewegt30.
2.2.1. Die Assimilation
Auf „instrumentaler“ Motivation basierende und mit dem Begriff „Assimilation“ erfasste Taktik bedeutet eine starke Angleichung an die Zielgesellschaft sowohl in persönlicher als auch in sozialer Sphäre, „Identifikation mit der fremden Kultur und die Uminterpretation der ursprünglichen Identität“31. In diesem Fall kann es nicht die Rede von dem Erhalt der eigenen, mitgebrachten Sprache sein, denn sie wird nicht als eine Bereicherung, sondern als eine Behinderung verstanden. Der große Wunsch nach einer Assimilierung zwingt manche Eltern zum Gebrauch der weniger beherrschten Sprache auch in der Familie, was unter Umständen verheerende Folgen32 für allgemeine Entwicklung des Kindes haben kann. Man findet viele Belege für diese Einsicht in „Russlanddeutschen Sprachbiographien“ von K. Meng, die zeitlich in die Mitte der 90-ger passen und ein treffendes Bild der elterlichen Bestrebungen bezüglich der Zukunft ihrer Kinder geben. Diese Absichten sind in einem Satz zu formulieren: „Пусть учат немецкий язык, русский им здесь не нужен (Pusť ucat nemeckij jazyk, russkij im zdes' ne nužen.“ - „ Sie sollen besser Deutsch lernen, Russisch brauchen sie hier nicht.“33
2.2.2. Die Integration
Eine notwendige Anpassung an die Normen der aufnehmenden Gesellschaft „mit der gleichzeitigen Beibehaltung der ursprünglichen Kultur und Identität“34 wird als Integration bezeichnet. Im öffentlichen Leben passt sich die Gruppe den Normen und Gesetzen des Landes an, die Privatsphäre mit Sprache, bestimmten Traditionen bleibt weitgehend unverändert, das heißt, es findet keine kulturelle Anpassung statt. Dabei integriert „der Migrant in seiner Persönlichkeitsstruktur, also in sich selbst, die zwei Kulturen und Sprachen“35. Es ist offensichtlich, dass man in diesem Fall durch den integrativen Gedanken motiviert wird und keine Abneigung der eigenen Herkunft und Sprache gegenüber erlebt. Ein wichtiger Faktor ist dabei die Zugehörigkeit zu der Migrantengemeinschaft, welche durch bestimmte Merkmale wie z.B. Akzent manifestiert wird. Es hat seine Wurzeln und Auswirkungen, ob man sich dieser Zugehörigkeit schämt, oder sich als gleichberechtigtes Gesellschaftsmitglied mit dem Migrationhintergrund empfindet.
Die Ergebnisse der Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung 1/2009 lassen Aussiedler zu der bestintegrierten Einwanderergruppe zählen:
„Am besten integriert sind - kaum verwunderlich - Aussiedler und die Personen aus den Weiteren Ländern der EU-25 (ohne Südeuropa). Sie gehören zumeist zu der europaweiten Wanderungselite, die leicht Beschäftigung findet und sehr gut gebildet ist - sogar besser als der Durchschnitt der einheimischen Bevölkerung."36
Möglicherweise wurde es dadurch bedingt, dass die Aussiedler einerseits „mit einem ungewöhnlichen Anpassungswillen nach Deutschland kommen“37 und andererseits lebten sie die letzten 60-70 Jahre in einem Multivölkerstaat, wo das Zusammentreffen verschiedener Kulturen zur täglichen Erfahrung gehörte. Die ganze Entwicklung der Sowjetuniondeutschen nach dem zweiten Weltkrieg ist als Schule der Integration zu verstehen.
2.2.3. Die Isolation
Aus der Sicht des Aufnahmelandes haben die Sowjetuniondeutschen sich in den letzten Jahren gut in die Gesellschaft eingefügt, doch wird es von der anderen Seite auch so empfunden? Oder hat man sich nur an die gezwungene Halbtaubheit unter den Deutschsprachigen gewöhnt, hat „soviel Kontakt wie nötig und sowenig wie möglich“ und hofft dabei, dass die Kinder eine bessere Zukunft haben werden? Hier ist die Rede von Isolation, die sehr häufig Hausfrauen betrifft, welche ihrerseits für die Erziehung der Kinder zuständig sind. Die Sprachkontakte mit den 'Deutschen' oder Einheimischen werden auf das notwendige Minimum reduziert, was zur Abgrenzung in der sozialen Umgebung führt. Es ist allerdings fraglich, ob solche Situationen sich positiv auf die Russischkenntnisse der Kinder auswirken. Viele Familien leben in Ortschaften mit einem sehr hohen Aussiedleranteil der Bevölkerung, es führt zu Entstehung einer Gettosituation, was die Integration nicht gerade leicht macht. „Jeder vierte Einwohner von Cloppenburg ist Aussiedler. Bei Gewalt- und Drogendelikten liegen diejungen Russlanddeutschen vorn, bei der Integration aber oft hinten. Die meisten leben in einer Parallelgesellschaft.“38
2.2.4. Die Dissimilation
In diesem Teil handelt es sich um das Gegensatz von Assimilation. Die Dissimilation erfolgt nach bestimmten Stufen der Assimilation und impliziert u. a. die Wiederentdeckung der Heimatsprache und der kulturellen Muster der Herkunftskultur39. In den letzten fünf Jahren ist ein verstärktes Interesse an der russischen Sprache und Kultur zu beobachten. Viele Vereine bieten neben dem Russischunterricht für Kinder auch Literaturabende und Theateraufführungen mit und für die russischsprechende Gemeinschaft. „BcTpeua земляков“ (Vstreča zemljakov) - „Das Treffen der Landsleute“, wo sich Menschen aus den gleichen Regionen wieder sehen, über die Vergangenheit und Zukunft sprechen und feiern, ist keine Seltenheit. Unter anderem sind folgende Faktoren, die diese Entwicklung beeinflussen, zu benennen: die politische und ökonomische Stabilisierung des Herkunftslandes und die damit verbundene Aufwertung der eigenen Identität, was seinerseits ein verstärktes Selbstwertgefühl der Einwanderer projiziert, die sich ihrer Herkunft nicht zu schämen brauchen und „ihren russischen Anteil“ nicht ablegen müssen. Auch die gewachsene Toleranz und Offenheit in der deutschen Bevölkerung dem Fremden gegenüber trug dazu bei.
2.3. Zwischenfazit
Die in den oberen Kapiteln durchgeführte Strukturierung ist sehr hilfreich für das Verständnis des ganzen Themas, es istjedoch anzuzweifeln, dass es im wirklichen Leben derartig strikte Aufteilung möglich ist. Sicherlich können viele Menschen mit Migrationhintergrund in mehreren Taktiken gleichzeitig das eigene Tun erkennen. Für die vorliegende Arbeit ist es wichtig die Ursachen der unterschiedlichen Einstellungen zur eigenen Identität, welche sowohl die Sprache als auch kulturbedingte Handlungsmuster beinhaltet, zu klären. Da Kinder diese Taktiken nicht direkt selber anwenden, sondern in der „präparierten“, zweisprachigen und bikulturellen Umgebung (Familie/Außenwelt) sozialisiert werden, übernehmen sie erstmal die elterlichen Einstellungen. „Unabhängig davon, ob ausländische Kinder ihrer primären Sozialisation noch in ihrer Heimat erlebt haben oder bereits in Deutschland geboren wurden, ist der weitere Sozialisationsverlauf dieser Kinder als ein dauernder interkultureller Konflikt zu sehen.“40 Das Interesse an der Erhaltung der Sprache ist genau so unterschiedlich, wie die Strategien der Eingewöhnung an das neue Leben waren. Doch es ist möglich gewisse Parallelen zu ziehen. Die Russische Sprache ist unabhängig von der Einstellung der Eltern immer noch sehr stark präsent in welcher Form auch immer41, aus dem einfachen Grund: sie ist praktisch die Muttersprache und wird deswegen viel besser als Deutsch beherrscht. Die deutsche Sprache ist ebenso stark vertreten und wird bei den Kindern aller Wahrscheinlichkeit nach die wichtigere oder, um es mit dem linguistischen Terminus auszudrucken, dominante Sprache sein.
3. Sprachliche Situation der Migrantengemeinschaft
Die bisjetzt durchgeführte Argumentation liegt näher, dass in einer Aussiedlerfamilie beide Sprachen, sowohl Russisch als auch Deutsch im Gebrauch sind. Die Arbeit untersucht das Niveau der russischen Sprache bei Kindern. Deshalb ist zu klären, welche Funktionenjede der beiden Sprachen hat und in welchem Umfang sie in der Familie und Umgebung präsent sind. Zunächst wird die Umgebungssprache Deutsch untersucht.
3.1. Deutsch in einer Aussiedlerfamilie
Die meisten meiner Informantenfamilien leben seit ungefähr zehn Jahren in Deutschland und haben die „Schockwelle“ des ersten Kontakts mit der Kultur und Sprache längst hinter sich gelassen. Wenn auch die deutsche Sprache nicht sehr gut beherrscht wird, so versetzt sie nicht mehr in einen Stresszustand und ist zu einer Norm geworden. Das spiegelt sich innerhalb der Familie wieder indem die deutschen Ausdrücke und einzelne Lexemen oder Wörter im täglichen Leben oft gebraucht werden, was die Qualität der russischen Sprache beeinflusst. Denn in der Regel werden Gespräche zwischen Eheleuten oder Eltern und Großeltern, unabhängig von dem Beherrschungsgrad der deutschen Sprache, meistens auf Russisch geführt. „Trotz des Rückgangs des Gebrauchs des Russischen ist es immer noch die von den befragten Russlanddeutschen „am liebsten“ gesprochene Sprache, und die Sprache in der sie sich zum Zeitpunkt der Befragung immer noch am wohlsten fühlen (70 Prozent).“42 Es ist aber nicht nur das „Wohlfühlen“, was für den häufigeren Gebrauch des Russischen verantwortlich ist, sondern auch der relative „Gefrierzustand“ des Deutschen. Man hat eine bestimmte Stufe der Sprachkenntnisse, die für die Anwendung im Alltag ausreichend ist, erreicht und gibt sich damit zufrieden. Es soll nicht heißen, dass es überhaupt nichts mehr aufgenommen wird, doch im Verhältnis zu der Anfangsphase des Sprachlernens sind der Anteil des Neuen und der Wille bzw. die Notwendigkeit es zu erlernen sehr gering. Eine umgekehrte Entwicklung wird bei den Kindern beobachtet. Bei ihnen ist Deutsch zu einem gemeinsamen Mittel der Kommunikation geworden43. Sie sprechen nicht nur untereinander Deutsch, oft geben sie die Antworten in dieser Sprache, auch wenn sie auf Russisch angesprochen werden. Obwohl ihre Deutschkenntnisse nicht immer mit den der Muttersprachler zu vergleichen sind44, so ist es die meistgebrauchte Sprache. Sie bietet in sehr vielen Fällen größere Ausdrucksmöglichkeiten. Die Kinder im Grundschulalter, die im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen, verbringen täglich nicht sehr viel Zeit in einer Umgebung, wo eventuell Russisch gesprochen wird und auch diese Gespräche gehen selten aus dem Rahmen des Alltäglichen hinaus. In der Schule, bei Freizeitaktivitäten, beim Spielen mit den Freunden - überall wird Deutsch gesprochen. Die Erschließung der Wirklichkeit passiert in dieser Sprache.
3.2. Russisch der Aussiedler
Die Sprache ist ein lebender Organismus, der sich der Umgebung oder den Umständen anpassen kann. Deshalb muss zunächst einmal die Frage geklärt werden, was unter russischer Sprache in einer Migrantenfamilie verstanden wird.
3.2.1. Die mitgebrachte Sprache
Vorab istjedoch festzulegen, dass das mitgebrachte Russisch nicht zwingender weise einer Literaturnorm entspricht. Oder, wenn man die Klassifikation von E. Zemskaja45 übernimmt, die so genannte КЛЯ (KLJA) -kodificirovannyj literaturnyj jazyk. Viele Menschen kamen nach Deutschland mit unterschiedlichem Bildungsstand, was sich in der Sprache widerspiegelte. Sehr häufig beobachtet man eine Mischung mit den Elementen der Umgangssprache oder Prostorecja, die nach E. Zemskaja РЯ (RJA) - razgovornyjjazyk bezeichnet wird. Natürlich wurde man in der Literatursprache unterrichtet, doch die sämtlichen Unterschiede wurden nicht immer als falsch klassifiziert, wurden verstanden und waren parallel im Gebrauch46. Ein „kleiner“ Unterschied ist zu der Situation in Deutschland festzustellen: Kinder, die hier geboren sind oder im Kleinkindalter eingereist sind, haben sehr wenige Möglichkeiten mit der Literatursprache überhaupt in Kontakt zu treten, wenn sie zuhause nicht gesprochen wird.
[...]
1 Bundesverwaltungsamt (2008): Aussiedlerstatistik seit 1950.
2 Der Begriff „Russlanddeutsche“ ist fest in der Fachliteratur verankert, wobei korrekter wäre es, von den Sowjetuniondeutschen zu sprechen, denn Aussiedler kamen aus vielen Staaten der ehemaligen Sowjetunion.
3 Der Unterschied zwischen diesen Begriffen ist für diese Arbeit nicht von Bedeutung, deswegen werden Begriffe „Aussiedler“, „Sowjetuniondeutsche“ und „Russlanddeutsche“ synonym verwendet.
4 Berend, N., Sprachliche Anpassung. Eine soziolinguistisch-dialektologische Untersuchung zum Russlanddeutschen. Tübingen 1998.
5 Vgl.: Meng, K., Russlanddeutsche Sprachbiographien, Tübingen 2000, S. 474.
6 Protasova, E., Russkij jazyk i deti, Chel'sinki 1996.
7 Zemskaja, E., Jazyk russkogo zarubežja: Itogi i prespektivy issledovanija, in: Russkij jazyk v naucnom osvešcenii, № 1, Moskva 2001.
8 Müller, N., / Kupisch, T., Einführung in die Mehrsprachigkeitsforschung, Tübingen 2007.
9 Kuhn-Lääs, M., Zweisprachigkeit und kulturelle Identität. Psychosoziale Probleme von eingewanderten sprachlichen Minderheiten. S. 20.
10 Berend, N., S. 8.
11 Vgl.: ebd., S. 18.
12 Berend, N., S. 20.
13 Berlinska, D., Oberschlesische Identität, in: Die Grenzen der Nationen: Identitätenwandel in Oberschlesien in der Neuzeit, Ther P./Struve K. (Hg), Marburg 2002, S. 315.
14 Hier ist Hochdeutsch gemeint.
15 Berend, N., S. 49.
16 Es ist nicht auszuschließen, dass in einigen Familien die Versuche unternommen wurden.
17 Vgl.: ebd., S. 47.
18 Kuhn-Lääs, M., S. 68.
19 Ebd.
20 Oskar, E. hat die Verhaltensdomänen von Einwanderern im Aufnahmeland 1984 ausgearbeitet. Zitiert nach Kuhn- Lääs, M., S. 75.
21 Meng, K., S. 442.
22 Kuhn-Lääs, M., S.81.
23 Diese Bemerkung soll nur die Richtlinien der sowjetischen Bildungs- und Kulturpolitik wiedergeben.
24 Kuhn-Lääs, M., S. 27.
25 Vgl.: Kuhn-Lääs, M., S. 23ff.
28 Hoffmann, L., http://home.edo.uni-dortmund.de/~hoffmann/ABC. Kleines ABC: Migration und Mehrsprachigkeit. Identität.
29 Kuhn-Lääs, M., S. 62f.
30 Vgl.: ebd., S. 74ff.
31 Ebd., S. 75.
32 Siehe dazu „Doppelhalbsprachigkeit“ bei Aleemi, J., Zur sozialen und psychischen Situation von Bilingualen, S. 69. Der Begriff an sich ist umstritten, doch weitere Ausführungen zu diesem Thema gehören nicht in diese Arbeit.
33 Vgl.: Meng, K.,S. 370.
34 Kuhn-Lääs, M., S. 64.
35 Ebd.
36 Zitiert nach Hoffmann, L., Kleines ABC: Migration und Mehrsprachigkeit. Integration, siehe auch: Migranten in Deutschland, ZDF-Bericht vom 26.01.09, Download unter: http://www.sueddeutsche.de/politik/426/456096/text/.
37 Berend, N., S. 234.
38 Schröder, A., Die Russen von Cloppenburg, Spiegel - online vom 01.04.05.
39 Vgl.: Kuhn-Lääs, M., S. 76.
40 Thiel, T., zitiert nach Aleemi, J., S. 52.
41 Das Thema der Sprachmischungen wird in weiteren Kapiteln erörtert.
44 Viele Wissenschaftler warnen vor solchen Vergleichen, was viele Kindergärtner/innen und Lehrer/innen aber nicht stört.
45 Zemskaja, E., S. 115.
46 Vgl. dazu: Zemskaja, E., Meng, K., Protasova, E., Leksiceskije osobennosti russkojazycnoj pressy v Germanii, in: Izvestija AN. Serija literatury i jazyka, Band 59, № 4, 2000, S. 49-60.
Häufig gestellte Fragen
Warum sprechen viele Aussiedlerkinder schlecht Russisch?
Das Niveau hängt stark von der elterlichen Einstellung zur russischen Kultur, den Integrationsbemühungen in Deutschland und dem Grad der sprachlichen Assimilation ab.
Was ist "Aussiedlerrussisch"?
Es bezeichnet eine Varietät des Russischen, die durch starke Interferenzen aus dem Deutschen geprägt ist, etwa durch Lehnwörter oder veränderte grammatikalische Strukturen.
Welche Verhaltensmuster zeigen Einwanderer bezüglich ihrer Sprache?
Man unterscheidet Assimilation (völlige Anpassung), Integration (Zweisprachigkeit), Isolation (Festhalten am Russischen) und Dissimilation.
Wie beeinflusst die Geschichte der Sowjetuniondeutschen ihre Identität?
In der UdSSR wurden sie als "Deutsche" diskriminiert; in Deutschland werden sie oft als "Russen" wahrgenommen, was zu einer komplexen und manchmal gespaltenen Identität führt.
Ist Zweisprachigkeit bei Aussiedlern staatlich gewollt?
Die Arbeit untersucht die staatliche Sprachpolitik und stellt fest, dass die Förderung der Herkunftssprache oft hinter der Forderung nach schneller deutscher Integration zurücksteht.
- Quote paper
- Julia Alert (Author), 2009, Welche Sprache ist meine Muttersprache? Gründe für das Niveau der russischen Sprachbeherrschung bei Aussiedlerkindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210417