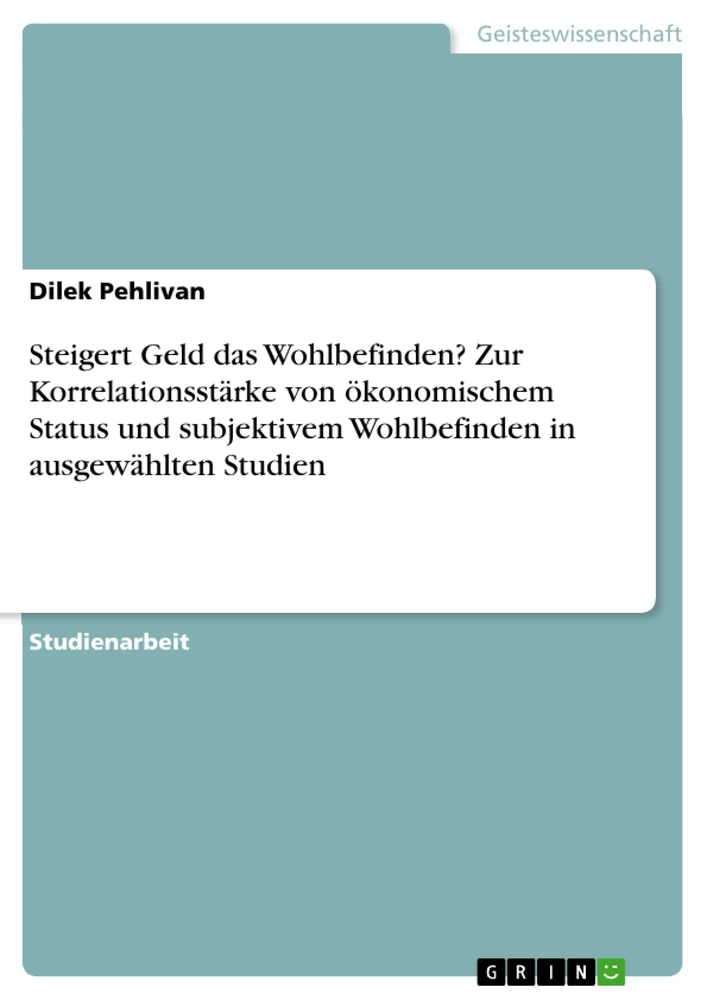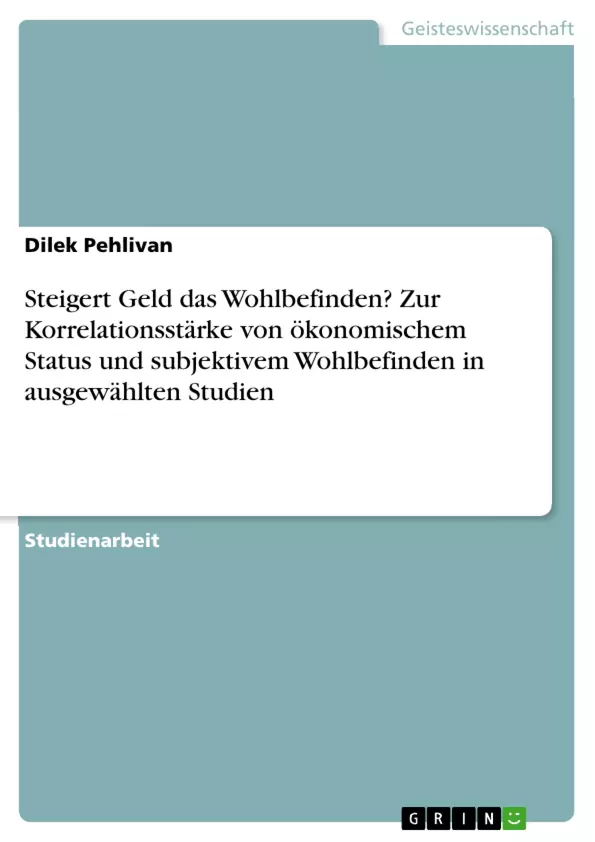Steigert Geld das Wohlbefinden? Wie ist der Zusammenhang zwischen ökonomischem Status und subjektivem Wohlbefinden? Diesen Fragen widmet sich die vorliegende Arbeit und versucht, sie anhand von zwei ausgewählten Studien zu beantworten.Während sich die Studie „Income and well-being: How big is the gap between the rich and the poor?“ von Lucas und Schimmack (2009) mit den Differenzen in der Korrelationsstärke unter verschiedenen Einkommensgruppen beschäftigt, untersucht die Studie „The Relation of Economic Status to Subjective Well-Being in Developing Countries: A Meta-Analysis“ von Howell und Howell (2008) die Korrelation von Einkommen und Wohlbefinden in Entwicklungsländern. Die Ergebnisse machen deutlich: ökonomischer Status korreliert stark mit subjektivem Wohlbefinden, wenn Geld als Wohlhaben und subjektives Wohlbefinden als Lebenszufriedenheit verstanden wird. Unter diesen Bedingungen ist die Korrelation zwischen ökonomischem Status in Entwicklungsländern und in einkommensschwachen Gruppen signifikant stark. Geld steigert also das Wohlbefinden, ja, jedoch gilt es, die Hintergründe und Konstrukte gut zu verstehen und zu definieren.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretischer Hintergrund: Warum es sich lohnt, den Zusammenhang zwischen ökonomischem Status und subjektivem Wohlbefinden zu untersuchen
3. Empirische Auseinandersetzung mit dem Zusammenhang zwischen Geld und Wohlbefinden
3.1. „Income and well-being: How big is the gap between the rich and the poor?“ von Richard E. Lucas und Ulrich Schimmack
3.1.1. Inhalte, Fragestellungen und Ziele
3.1.2. Methoden
3.1.3. Interpretation und Ausblick
3.2. „The Relation of Economic Status to Subjective Well-Being in Developing Countries: A Meta- Analysis“ von Ryan T. Howell und Collen J. Howell
3.2.1. Inhalte, Fragestellungen und Ziele
3.2.2. Methoden 12 3.2.3. Interpretation und Ausblick
4. Schlussfolgerung
5. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Macht Geld wirklich glücklich?
Studien zeigen, dass ökonomischer Status stark mit subjektivem Wohlbefinden korreliert, besonders wenn Wohlbefinden als Lebenszufriedenheit definiert wird.
Gibt es Unterschiede zwischen armen und reichen Ländern?
In Entwicklungsländern ist die Korrelation zwischen Einkommen und Wohlbefinden oft signifikanter, da Geld dort grundlegende Bedürfnisse sichert.
Was untersuchten Lucas und Schimmack (2009)?
Sie analysierten die Unterschiede in der Korrelationsstärke zwischen Einkommen und Wohlbefinden innerhalb verschiedener Einkommensgruppen.
Wie hängen Lebenszufriedenheit und Einkommen zusammen?
Die Forschung deutet darauf hin, dass ein höherer ökonomischer Status die allgemeine Einschätzung des eigenen Lebens positiv beeinflusst.
Was ist das Ergebnis der Meta-Analyse von Howell und Howell (2008)?
Die Studie belegt eine signifikant starke Korrelation zwischen ökonomischem Status und Wohlbefinden in Entwicklungsländern.
- Arbeit zitieren
- Dilek Pehlivan (Autor:in), 2012, Steigert Geld das Wohlbefinden? Zur Korrelationsstärke von ökonomischem Status und subjektivem Wohlbefinden in ausgewählten Studien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210440