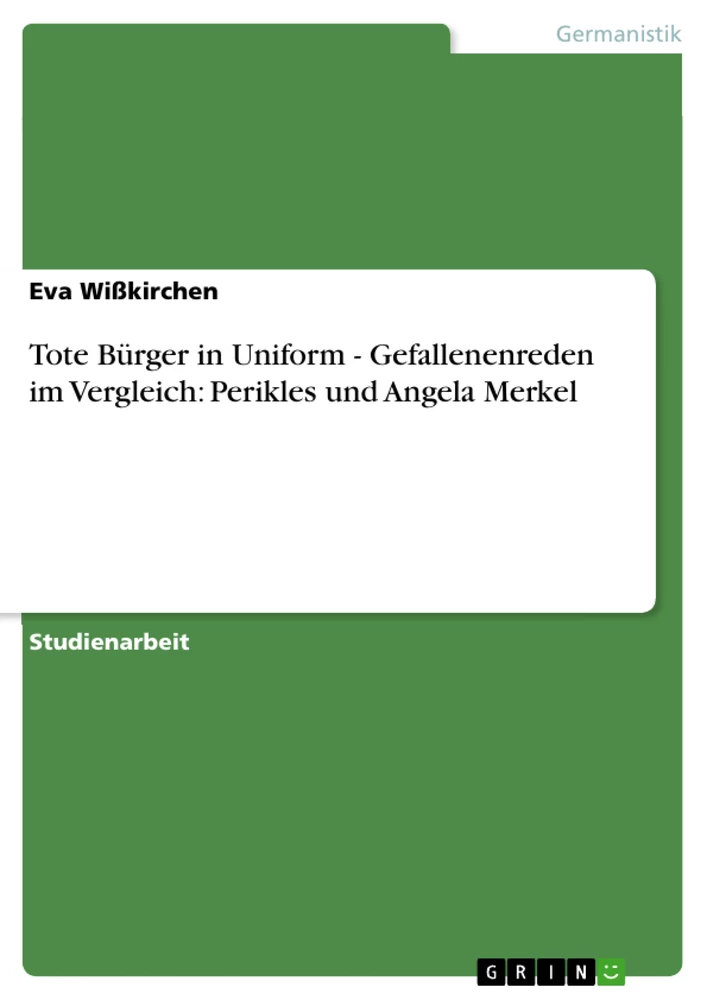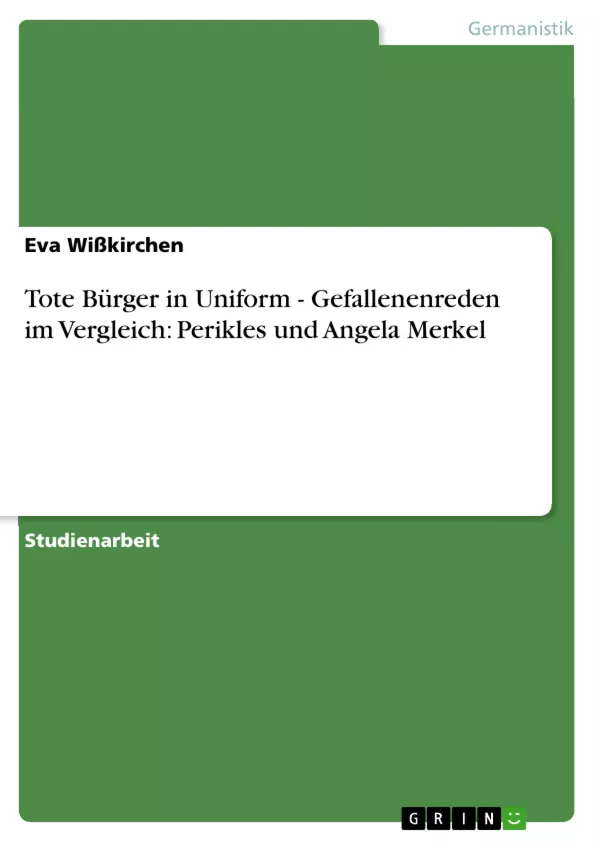Die Gefallenenrede des Perikles aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. hat eine lange Geschichte der Okkupation hinter sich: in den unterschiedlichsten Situationen und Systemen wurde sie als Vorlage und Rechtfertigung verwendet, je nach Standpunkt könnte man auch sagen: missbraucht. Angela Merkel stellte sich am 9. April 2010 bei der Trauerfeier für die in Afghanistan gefallenen Bundeswehrsoldaten zwar nicht in diese Tradition, dennoch scheint es ergiebig, diese zweieinhalb Jahrtausende auseinander liegenden Reden zusammen zu lesen; in der Hoffnung, die Rede Angela Merkels jenseits rein inhaltlicher Analysen zu erhellen.
Gemeinsamkeiten fallen hierbei ebenso schnell auf wie Unterschiede: Beide Reden sind Gefallenenreden, doch die Anzahl der Gefallenen und die Inszenierung der Bestattung unterscheiden sich erheblich. Beide wurden in Demokratien gehalten, doch in manchen Punkten unterscheiden sich athenische und (post)moderne Demokratie. Nichtsdestotrotz sind die Soldaten in beiden Fällen „Staatsbürger in Uniform“ und keine geheuerten Söldner.
Die einzige Quelle für die Rede des Perikles ist die „Geschichte des Peloponnesischen Kriegs“ von Thukydides, die Rede Angela Merkels ist jederzeit in Bild, Ton und Schrift über Internet abrufbar . Die Rede des Perikles steht in einer Tradition von Gefallenenreden und ist Teil eines etablierten Begräbnisritus, wohingegen sich eine solche Tradition in der Bundesrepublik aufgrund der historischen Begebenheiten erst herausbildet.
Die genannten Unterschiede und Gemeinsamkeiten hinsichtlich der historischen, politischen, sozialen und medialen Situation sollen im Folgenden genauer dargestellt und in Beziehung gesetzt werden zu den Unterschieden und Gemeinsamkeiten hinsichtlich der rhetorischen Strategien der Reden. Besondere Aufmerksamkeit wird hierbei der Bedeutung des Einzelnen für das Gemeinwesen sowie der Frage der Glaubwürdigkeit zuteil werden.
Aufgrund des geringen Umfangs der Arbeit wird allerdings darauf verzichtet, eine Geschichte des peloponnesischen sowie des Afghanistan-Krieges nachzuerzählen. Auf derartige Einzelheiten soll nur verwiesen werden, wo es für die Analyse der Reden hilfreich ist.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Hauptteil
Tradition, Inszenierung und Medialisierung
Der Einzelne in der Gemeinschaft
Die Gemeinschaft und die Anderen
Glaubwürdigkeit der Rede – Glaubwürdigkeit des Redners
Was glaubwürdig erscheinen soll und warum
Abschlussbetrachtung
Häufig gestellte Fragen
Was ist der zentrale Gegenstand des Vergleichs in dieser Arbeit?
Die Arbeit vergleicht die Gefallenenrede des Perikles aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. mit der Rede von Angela Merkel aus dem Jahr 2010, die sie anlässlich der Trauerfeier für in Afghanistan gefallene Bundeswehrsoldaten hielt.
Welche Gemeinsamkeiten weisen die Reden von Perikles und Angela Merkel auf?
Beide sind klassische Gefallenenreden, die in einem demokratischen System gehalten wurden. Zudem werden die Soldaten in beiden Fällen als „Staatsbürger in Uniform“ und nicht als Söldner betrachtet.
Worin liegen die wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Reden?
Unterschiede bestehen in der Anzahl der Gefallenen, der Inszenierung der Bestattungsriten sowie der medialen Verfügbarkeit. Während Perikles' Rede Teil eines etablierten Ritus war, bildet sich eine solche Tradition in der Bundesrepublik erst noch heraus.
Welche Quellen wurden für die Analyse herangezogen?
Die einzige Quelle für die Rede des Perikles ist Thukydides' „Geschichte des Peloponnesischen Kriegs“. Die Rede von Angela Merkel ist hingegen in Bild, Ton und Schrift über das Internet abrufbar.
Welche rhetorischen Aspekte werden besonders untersucht?
Besondere Aufmerksamkeit gilt den rhetorischen Strategien, der Bedeutung des Einzelnen für das Gemeinwesen sowie der Frage der Glaubwürdigkeit der Redner.
Wird in der Arbeit die Geschichte der Kriege detailliert nacherzählt?
Nein, auf eine detaillierte Nacherzählung des Peloponnesischen Krieges oder des Afghanistan-Krieges wird verzichtet; historische Einzelheiten werden nur dort angeführt, wo sie für die rhetorische Analyse relevant sind.
- Quote paper
- Eva Wißkirchen (Author), 2011, Tote Bürger in Uniform - Gefallenenreden im Vergleich: Perikles und Angela Merkel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210506