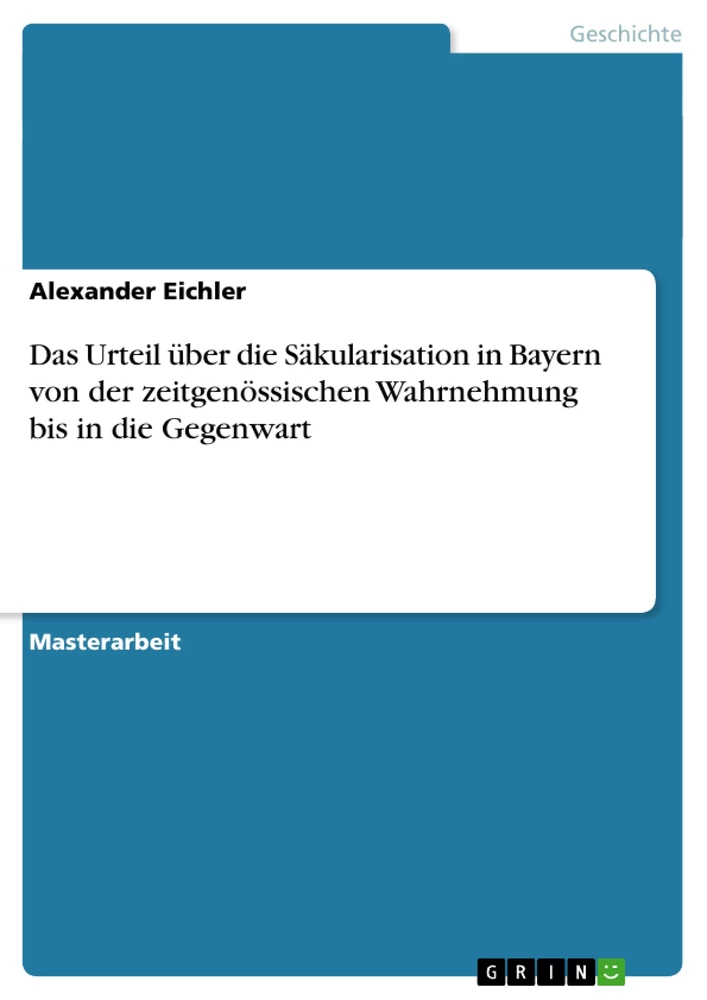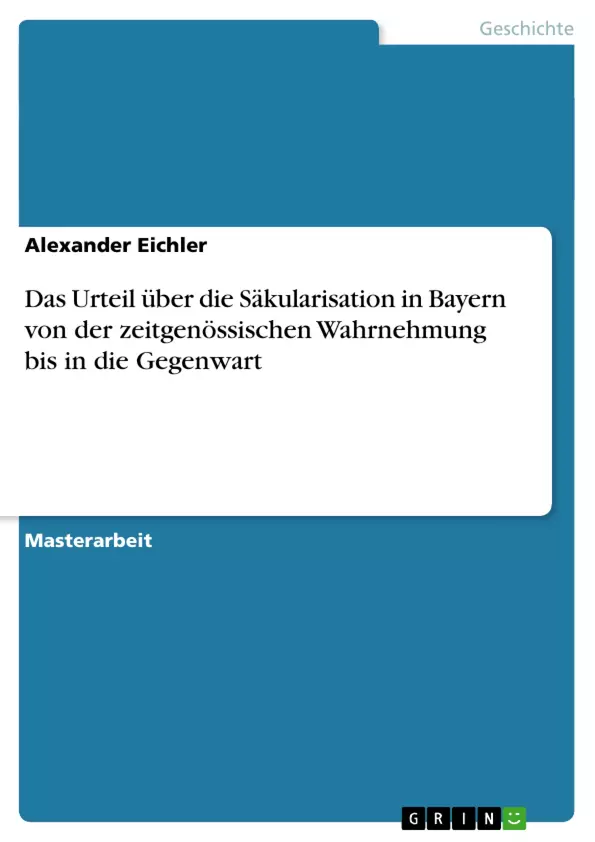Die Säkularisation von 1803 war ein Prozess mit dauerhaften Folgen, die selbst über 200 Jahre danach noch immer kontrovers diskutiert werden. Durch den Reichsdeputationshauptschluss vom 25. Februar 1803, der Ende April des Jahres durch kaiserliche Ratifikation in Kraft trat , begann die revolutionäre Umgestaltung der traditionellen, territorialen und politischen Strukturen. Die Paragraphen 35 und 36 bildeten die rechtliche Grundlage für die „in Rastatt und Lunéville getroffenen Vorentscheidungen“ für die bis dahin größte territoriale Umwälzung in Deutschland. 112 rechtsrheinische Reichsstände, 19 Reichsbistümer, 44 Reichsabteien, 41 Reichsstädte, viele hundert landsässige Abteien, Stifte und Klöster sowie alle Reichsdörfer wurden in der Folge mediatisiert und gingen in hoheits- und eigentumsrechtlicher Hinsicht an weltliche Fürsten. Insgesamt wechselte eine Fläche von etwa 73.000 Quadratkilometern geistlichen Staatsgebiets, wovon Bayern fast 10.000 Quadratkilometer ausmachte, in die Herrschaft weltlicher Territorialstaaten. Natürlich waren von dieser Herrschaftsumschichtung, die sich bis 1806 hinzog, beachtliche Teile der Bevölkerung des Deutschen Reichs betroffen. Nach Franz Quarthal wechselten ungefähr 3,2 Millionen Menschen von den rund 21 Millionen Einwohnern des Reiches die Staatsangehörigkeit und eine noch höhere Zahl war von der Mediatisierung betroffen.
Die Säkularisation läutete damit das Ende der reichischen „Kleinstaaterei“ ein und bereitete der nationalen Einigung den Weg. Auf der anderen Seite gehörte die über Jahrhunderte gewachsene, vom Adel geprägte, aristokratische Ordnung der Reichskirche ab der Niederlegung der Kaiserkrone im August 1806 nun der Vergangenheit an und schwächte den Reichsgedanken.
Die Hauptentscheidungsträger waren der am 20. Februar 1799 zum Kurfürst von Bayern ernannte Maximilian IV. Joseph und sein Außenminister Maximilian von Montgelas. Letzterer sollte jedoch die treibende Kraft bei der Vorbereitung und Durchführung der Säkularisation werden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Problemstellung und Zielsetzung
1.2. Methodisches Vorgehen
1.3. Quellenlage
1.4. Aufbau der Arbeit
2. Begriffsgeschichtliche Entwicklungen
2.1. DerBegriff Säkularisation
2.2. Der Begriff Säkularisierung
3. Rechtswissenschaftliche Beurteilung der Säkularisation in Bayern von 1803 bis in die Gegenwart
4. Historisch-politische Beurteilung der Säkularisation von 1803 in Bayern
4.1. Zeitgenössische Beurteilung des Reichsdeputationshauptschlusses und der Säkularisation bis zum Ende des 19. Jahrhunderts
4.1.1. Beurteilung in der Geschichtswissenschaft
4.1.2. Beurteilung aus kirchlicher und staatlicher Sicht
4.2. 100 Jahre Reichsdeputationshauptschluss - Das Urteil über die Säkularisation im 20. Jahrhundert
4.2.1. Beurteilung in der Geschichtswissenschaft
4.2.2. Beurteilung aus kirchlicher und staatlicher Sicht
4.2.3. Die Auseinandersetzung der Augsburger Postzeitung mit der Münchner Allgemeinen Zeitung
4.3. 200 Jahre Reichsdeputationshauptschluss - Wie wird die Säkularisation heute beurteilt?
4.3.1. Beurteilung in der Geschichtswissenschaft
4.3.2. Beurteilung aus kirchlicher und staatlicher Sicht
5. Verlauf und Wertung der Beurteilungen über die Säkularisation von der zeitgenössischen Wahrnehmung bis in die Gegenwart
5.1. Verlauf der Beurteilungen in der Geschichtswissenschaft
5.2. Verlauf der Beurteilungen der katholischen Kirche und des Staates
5.3. Wertung der Beurteilungen
6. Zusammenfassung
Quellenverzeichnis
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die Säkularisation1 von 1803 war ein Prozess mit dauerhaften Folgen, die selbst über 200 Jahre danach noch immer kontrovers diskutiert werden. Durch den Reichsdeputationshauptschluss vom 25. Februar 1803, der Ende April des Jahres durch kaiserliche Ratifikation in Kraft trat2, begann die revolutionäre Umgestaltung der traditionellen, territorialen und politischen Strukturen. Die Paragraphen 35 und 36 bildeten die rechtliche Grundlage für die „in Rastatt und Lunéville getroffenen Vorentscheidungen“3 für die bis dahin größte territoriale Umwälzung in Deutschland. 112 rechtsrheinische Reichsstände, 19 Reichsbistümer, 44 Reichsabteien, 41 Reichsstädte, viele hundert landsässige Abteien, Stifte und Klöster sowie alle Reichsdörfer wurden in der Folge mediatisiert4 und gingen in hoheitsund eigentumsrechtlicher Hinsicht an weltliche Fürsten.5 Insgesamt wechselte eine Fläche von etwa 73.000 Q uadratkilometern geistlichen Staatsgebiets, wovon Bayern fast 10.000 Quadratkilometer ausmachte, in die Herrschaft weltlicher Territorialstaaten. Natürlich waren von dieser Herrschaftsumschichtung, die sich bis 1806hinzog, beachtliche Teile der Bevölkerung des Deutschen Reichs betroffen. Nach Franz Quarthal wechselten ungefähr 3,2 Millionen6 Menschen von den rund 21 Millionen Einwohnern des Reiches die Staatsangehörigkeit und eine noch höhere Zahl war von der Mediatisierung7 betroffen.8 Die Säkularisation läutete damit das Ende der reichischen „Kleinstaaterei“ ein und bereitete der nationalen Einigung den Weg.9 Auf der anderen Seite gehörte die über Jahrhunderte gewachsene, vom Adel geprägte, aristokratische Ordnung der Reichskirche ab der Niederlegung der Kaiserkrone im August 1806 nun der Vergangenheit an und schwächte den Reichsgedanken.
Die Hauptentscheidungsträger waren der am 20.F ebruar 1799 z um Kurfürst vonBayern ernannte Maximilian IV. Joseph und s ein Außenminister Maximilian von M ontgelas. Letzterer sollte jedoch die treibende Kraft bei der Vorbereitung und Durchführung der Säkularisation werden. Er sprach von vo rnherein der Mehrheit der Prälatenklöster ihre Gemeinnützigkeit ab, wobei seine persönliche Ideologie stark dem Einfluss geistesgeschichtlicher Ideen der Aufklärung unterworfen war.10 Im Nachbarland Österreich begannen die Aufhebungen der Bettelorden bereits zwei Jahrzehnte zuvor, weshalb es nahe liegt, dass Montgelas sich diese Säkularisationen zum Vorbild nahm, als er 1802die Beseitigung der Bettelorden und den Abbruch erster Kirchenbauten, wie dem Kloster Taxa, veranlasste.
Das eigentliche Säkularisationsjahr 1803 wurde durch Verbote gegen die Volksfrömmigkeit wie Bittgänge, Prozessionen und Wallfahrten eingeleitet.11 Es kam zu Zerstörungen von Feldkreuzen und W egkapellen sowie einem generellen Beicht- und Predigtverbot für Bettelorden. Grundsätzlich war die politische Macht in geistlicher Hand durch die Emanzipation der Politik von de r Religion fragwürdig geworden. Hinzu kam die Last der Koalitionskriege, wodurch sich das Staatsdefizit erhöhte undman in erheblicher Finanznot steckte. Da es laut Karin Feuerstein-Praßer „[nirgendwo in Deutschland so viele und s o reiche Klöster wie in Bayern [gab]“12, tauchte seit dem Westfälischen Frieden immer wieder der Gedanke auf, sich dieser Reichtümer zu bemächtigen, was durch den Reichsdeputationshauptschluss letztendlich auch geschah. Daraus ergibt sich, dass die Säkularisation in Bayern als fiskalpolitische Notwendigkeit betrachtet werden kann, die nicht zuletzt wie die politische und kirchliche Neuordnung Deutschlands unter dem Spannungsfeld napoleonischer Politik stand.13 Ein weiterer Grund für die Säkularisation war dementsprechend die Rolle Frankreichs. Durch die Expansion am Rhein und de m damit verbundenen Verlust ertragreicher Gebiete wurden die Reichsfürsten auf Kosten der Kirche entschädigt und berechtigt Enteignungen vorzunehmen.14 Dabei glich der Zugewinn durch die Mediatisierung der reichsunmittelbaren geistlichen undw eltlichen Stände den Schwund an Territorien und Bevölkerung auf der linken Rheinseite annährend aus. Pfalz-Bayern konnte sich durch den Zugewinn Frankens, Schwabens und de r Hochstifte Bamberg, Würzburg, Augsburg, Freising und Passau territorial erheblich festigen und w urde zum drittgrößten deutschen Staat.
Außerdem hatte die Säkularisation erhebliche Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Reichstags, die Verfassung und das Leben der Menschen. Beispielsweise wurde die Feudalherrschaft durch den aufgeklärten Absolutismus ersetzt und es kam zu einer Vereinheitlichung des Staatsrechts und zentralistischen Verwaltungen der Länder. Da die Klöster als Zentren der Wissenschaft, Bildung und sozialen Fürsorge verschwanden, waren speziell die kurz- und mittelfristigen Folgen gravierend. So entstand ein Bildungsvakuum in den katholischen Gegenden und vielerorts verarmten die Menschen, weil mit den kirchlichen Einrichtungen ihre Arbeitgeber wegfielen. Auf der anderen Seite wirkte sich die Zentralisierung unzähliger Kulturgüter positiv auf den Ausbau Münchens zu einer europäischen Metropole aus, da die Klosterbestände in den Besitz staatlicher Sammlungen, Galerien und Archive übergingen. Zusätzlich erreichte man die Parität der Konfessionen, wodurch Bayern nun e in katholisch-protestantischer Staat war, der neben Preußen sehr modern regiert wurde und den Weg vom Staatenbund zum heutigen Bundesstaat einleitete.
1.1. Problemstellung und Zielsetzung
,,[D]as Spätere [ist] nur unter der Voraussetzung des ihm vorgegebenen Früheren möglich und verständlich.“15
Dieses Zitat des Philosophen Hans Blumenberg spiegelt sehr schön das Wesen der Geschichte wider. Vergangene Ereignisse beeinflussen aufgrund ihrer Verbindungslinien die Gegenwart und Zukunft, womit sie ebenfalls in gewisser Art und W eise die Erklärungen dafür liefern, warum etwas geschehen ist. Projiziert man dies auf die Säkularisation von 1803 in Bayern, so kann man sagen, dass sie offenbar die heutige Gesellschaft und das Staatswesen ermöglichte und gleichzeitig als Einfluss für sämtliche nach ihr folgenden Geschehnisse fungiert. Walter Demel, Professor an der Universität der Bundeswehr in München, meinte dazu, dass ,,[v]on allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland Bayern sicherlich zu denjenigen gehört, die durch die Säkularisation von 1802/ 03 am meisten geprägt wurden.“16 Hält man sich vor Augen, dass hier mehr als 1.000 Jahre eine ausgeprägte Klosterkultur ansässig war, die im 18. Jahrhundert ihre letzte Blütezeit erfuhr, wobei die Klöster unter anderem als Zentren aufgeklärter Wissenschaftspflege und i nnovativer Landwirtschaft das Leben der Menschen bereicherten, erhält man einen ungefähren Eindruck, was die Beseitigung dieser Einrichtungen für das Land und die „Bavaria sancta“ bedeutete.
Das Problem liegt folglich in der Beurteilung der Säkularisation, wobei zwei Sichtweisen vorherrschen:
Zum einen kann man die Entmachtung und Enteignung der römischen Kirche als legitimen Akt der Vernunft interpretieren, der den Auftakt zur geistigen Befreiung und wirtschaftlichen Verbesserung darstellte und zum anderen aber auch als scheinlegalen Umsturz, der legitime Obrigkeiten beseitigte und das Ende für bewährte Sozialformen, gottgegebene Ordnung und blühende kirchliche Kultur bedeutete.17
Dies zeigt, wie gegensätzlich man den Vorgang der „umstrittenen Umwälzung“ bewerten kann, wobei von d er zeitgenössischen Wahrnehmung bis heute durchaus Unterschiede bestehen. Mit der Zeit kam es nämlich zunehmend auch auf lokalgeschichtlicher Ebene zur Beschäftigung mit d er Säkularisation in Bayern. Dies ermöglichte differenziertere Betrachtungen der Folgen, als dies auf der Makroebene allein möglich gewesen wäre. In Anlehnung an den von A lois Schmid herausgegebenen Sammelband “Säkularisation in Bayern. Kulturbruch oder Modernisierung?“18 wird das Forschungsproblem der Thematik deutlich. Wie wurde und w ird die Säkularisation beurteilt? Hierbei stehen natürlich die unterschiedlichen Wahrnehmungen von kirchlichen und staatlichen Vertretern im Fokus, aber auch die Bewertungen der Geschichtswissenschaft helfen dabei, einen Überblick zu erlangen. Wie in vielen Bereichen der Geschichte muss jedoch zwischen älterer und neuerer Literatur sowie den damit verbundenen unterschiedlichen Beurteilungen differenziert werden. Gerade bei der Auseinandersetzung mit der Säkularisation ist es daher wichtig, immer nach der emotionalen Bindung des jeweiligen Autors zu fragen, da zwischen der rationalen und emotionalen Ebene keine Beziehungen bestehen sollten. Maximilian Köchl stellte dabei treffend fest, dass bisher „der Geschichtsforschung die Erstellung einer objektiven Gesamtbilanz der bayerischen Säkularisation nicht gelungen [ist].“19
In der vorliegenden Arbeit soll das Erkenntnisinteresse nicht auf einer solchen Gesamtbilanz, sondern schwerpunktmäßig auf dem Wandel der Wahrnehmungen über die Säkularisation liegen, denn bei der Beurteilung eines geschichtlichen Ereignisses gibt es bekanntermaßen häufig Veränderungen in den Bewertungenje größer der zeitliche Abstand ist.
1.2. Methodisches Vorgehen
Geht man der Frage nach, ob s ich das Urteil über die Säkularisation in Bayern von de r zeitgenössischen Wahrnehmung bis heute geändert hat, ist es notwendig, die Meinungen und Erfahrungen der Menschen aus verschiedenen zeitlichen Epochen zu untersuchen. Dabei gilt es, sowohl die Beurteilungen von Publizistik, Politik, Geschichtsforschung, als auch die der Kirche zu betrachten. Es zeigt sich damit, dass man interdisziplinär forschen muss, wenn man Unterschiede und Gemeinsamkeiten identifizieren möchte. Mittels einer komparatistischen Methodik wird aus diesem Grund versucht, von de n zeitgenössischen Quellen und dem damaligen Stand der Debatte bis zu den aktuellen Forschungsergebnissen eine Antwort zu finden. Den Fokus der vergleichenden Analyse bilden hierbei die drei Bereiche Geschichtswissenschaft, Kirche und Staat.
1.3. Quellenlage
Das Thema Säkularisation ist ein quellenmäßig sehr weites und höchst differenziertes Feld, wobei die Quellenlage bezüglich der Reaktionen von Z eitgenossen relativ schlecht ist. Vielfach hat man daher den Eindruck, dass die herrschaftlichen Veränderungen einfach so hingenommen wurden, weil sich kaum Äußerungen finden lassen.20 Auf der anderen Seite zeigt sich aber auch ein kaum überschaubares Quellenmaterial der Archive und Bibliotheken, weshalb es schwer ist, gezielt Beurteilungen ausfindig zu machen. Häufig gibt es nur Einzelbeobachtungen, die aus den vielen regionalen und ortsbezogenen Studien stammen.
In den 1970er Jahren kam es vermehrt zu Forschungen, die sich mit den wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Säkularisation beschäftigt haben, aber auch hier handelte es sich um regional spezialisierte Abhandlungen oder um mentalitätsgeschichtliche Fragen. Im Zuge des Jubiläumsjahres 2003 erschien hauptsächlich eine Flut vonArbeiten, die sich vorrangig mit der Neubewertung der Folgen für Staat, Kirche und Bevölkerung beschäftigten. Daneben bewertete man die Vorgeschichte des Reichsdeputationshauptschlusses, die Rolle Frankreichs sowie die wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen neu, weswegen Winfried Schulze die Forschungslage seit dem als sehr gut einschätzte, wenn auch ein übergreifendes Gesamturteil durch die vielen verschiedenen Meinungen erschwert wurde.21
Für die Untersuchung der Säkularisationsbeurteilung gibt es jedoch kaum verwertbare Literatur, beziehungsweise kann man sie an zwei Händen abzählen. In diesem bisher kaum bearbeiteten Feld sind vor allem die Vorarbeiten vonKatharina Weigand22 und Rudolfine Oer23 am hilfreichsten. Beide zeigen auf, wie die Wahrnehmung der Säkularisation im Laufe der Zeit einem Wandel unterworfen war, jedoch fehlt neben der Sicht auf das 200-jährige Gedenkjahr oftmals ein umfassender Blick auf die zeitgenössischen Einschätzungen, was wiederum der mangelhaften Quellenlage zuzurechnen ist.
1.4. Aufbau der Arbeit
Wie beschrieben, beschäftigt sich die vorliegende Arbeit damit, inwiefern es Differenzierungen in den Beurteilungen der Säkularisation von 1803 gibt und wie sich die Wahrnehmung dieses bedeutenden Ereignisses gewandelt hat. Um jedoch den Begriff „Säkularisation“ zu definieren, dessen geschichtliche Wurzeln aufzuzeigen und i hn von „Säkularisierung“ abzugrenzen, werden zunächst die begriffsgeschichtlichen Entwicklungen untersucht, damit in der Folge ein einheitliches Begriffsverständnis vorausgesetzt werden kann. Im Zentrum steht hierbei die Frage nach Veränderungen in den Bedeutungen der Termini.
Daran anschließend folgt im dritten Kapitel die rechtswissenschaftliche Wahrnehmung der Säkularisation seit dem Jahr 1803. Handelt es sich aus Sicht der Rechtswissenschaftler bei der Umwälzung um einen Rechtsbruch, oder war die Durchführung der Säkularisation ein rechtmäßiger staatlicher Akt? Zur Klärung dieser Frage sollen von den zeitgenössischen Urteilen bis zur aktuellen Studie von Ingo Knecht24 verschiedene Meinungen angeführt werden.
Das historisch-politische Kapitel 4 bildet den Schwerpunkt der Untersuchung, wobei es in drei zeitliche Bereiche unterteilt ist, welche wiederum in je zwei unterschiedliche Themenfelder, Beurteilung der Geschichtswissenschaft und Beurteilung aus kirchlicher und staatlicher Sicht gegliedert sind. Im ersten Abschnitt geht es um die zeitgenössischen Beurteilungen des Reichsdeputationshauptschlusses und der Säkularisation bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. In 4.2. steht das 100-jährige Jubiläum des Reichsdeputationshauptschlusses und das Urteil über die Säkularisation im 20. Jahrhundert im Fokus. Dieser Abschnitt enthält unter 4.2.3. auch ein Beispiel für die emotionale Auseinandersetzung über die Säkularisation im Jahr 1903, de nn es wird die „Artikelschlacht“ der Augsburger Postzeitung mit der Münchener Allgemeinen Zeitung analysiert. Der letzte Abschnitt des vierten Kapitels beinhaltet letztendlich das 200-jährige Jubiläum und di e gegenwärtige Wahrnehmung der Säkularisation. Auch hier werden erneut die Beurteilungen der Geschichtswissenschaftler sowie die von Kirche und Staat vorgestellt.
Den Abschluss der Untersuchung verkörpert Kapitel 5. Basierend auf den Ergebnissen des vorangegangenen Kapitels werden hier die Verläufe der jeweiligen Beurteilungen zusammenhängend skizziert und daran anschließend bewertet.
Eine Zusammenfassung erfolgt in Kapitel 6 am Ende dieser Arbeit, die sich im Großen und Ganzen in begriffsgeschichtliche, rechtswissenschaftliche und historisch-politische Themenbereiche unterteilt, mit d eren Hilfe die aufgeworfene Fragestellung erfolgreich beantwortet wird.
2. Begriffsgeschichtliche Entwicklungen
Begriffsgeschichtliche Entwicklungen spielen bei der Beurteilung von hi storischen Ereignissen eine wichtige Rolle. Besonders der Sinngehalt eines Begriffs und dessen möglicher Wandel sagen viel über die Wahrnehmung des Untersuchungsgegenstandes aus. Für die Geschichtswissenschaft, deren hauptsächliches Erkenntnisinteresse in der Vergangenheit liegt, ist die Bedeutung eines Begriffs das „Resultat der Geschichte seines Gebrauchs.“25 Im Laufe der Zeit kommt es jedoch häufig dazu, dass weder ein einheitlicher Terminus, noch das notwendige Wissen über den Ursprung und Wandel der Begriffe vorliegt. Dadurch können bei der Verwendung von Begriffen unterschiedliche Reaktionen und auch Assoziationen hervorgerufen werden, die eine wissenschaftliche Auseinandersetzung erschweren. Um den „chaotisch gewordenen Fachwort-Gebrauch neu unter Regeln zu zwingen“26 hat die Forschung daher die Aufgabe, einen Begriff wieder praktikabel zu machen, indem sie in historischer Aufarbeitung seiner Genesis ihn auf diejenige Definition festzulegen empfiehlt, die seine Entwicklung und gegenwärtige Bedeutung widerspiegelt.27 Fragt man nach den Veränderungen der Bedeutung von „Säkularisation“ als Terminus und Assoziationen, die der Begriff mit sich bringt, so muss, wie gerade beschrieben, vom Ursprung der Begriffsentwicklung beginnend bis zum gegenwärtigen Verständnis und Sinn geforscht werden. Hierbei sollten emotionalen und affektiven Nebenbedeutungen ebenfalls Beachtung geschenkt werden, da kritisch wahrgenommene Ereignisse immer Konnotationen hervorrufen. In der deutschen Sprache findet man eine Trennung der Begriffe „Säkularisation“ und „Säkularisierung“, wobei die semantische Nähe gleichzeitig auch die Verbindung beider Begriffe verdeutlicht. Laut Peter Blickle wäre die „Säkularisation“ nicht erklärbar, ließe sie sich nicht „in einen umfassenderen Vorgang der Säkularisierung einbetten.“28 Da auch Eberhard Weis den Begriff „Säkularisation“ von „Säkularisierung“ abgrenzt29, scheint es daher angebracht in den folgenden zwei Abschnitten beide Begriffe getrennt voneinander näher zu beleuchten, damit einerseits die Entwicklung der Termini veranschaulicht und andererseits von e inem einheitlichen Begriffsverständnis ausgegangen werden kann.
2.1. Der Begriff Säkularisation
Der Begriff „Säkularisation“ hat eine sehr lange Tradition im deutschen Sprachgebrauch, denn seine Wurzeln reichen bis in das 8. Jahrhundert zurück.30 Nach Hans Maier wurde das Wort zunächst als Ausdruck für die Zahlung von Geldern zugunsten päpstlicher Bullen verwendet31, wobei diese Bedeutung kaum etwas mit der heutigen gemein hat. Der Terminus, wie wir ihn kennen, wurde zum ersten Mal 1648 in Münster während der Verhandlungen zum Westfälischen Frieden durch den französischen Gesandten Longueville32 benutzt.33 Das französische Wort meinte dabei ursprünglich „die Überführung eines Ordensgeistlichen in den weltlichen Status.“34 Es wurde vom lateinischen Begriff „saecularizatio“35 abgeleitet, welcher die Bezeichnung für den Entzug oder die Entlassung einer Sache, eines Territoriums oder einer Institution aus kirchlich-geistlicher Observanz war. Somit stammt der Primärbegriff „Säkularisation“ aus dem Kirchenrecht und s eine historische und r echtliche Dimension schien relativ eindeutig durch die erlaubte Rückkehr eines Geistlichen aus der Ordensgenossenschaft in die weltliche Gesellschaft definiert.36 37 Der sogenannte saecularis31, war aber nundur ch diesen Vorgang vonbe stimmten Ämtern, Würden undB enefizien ausgeschlossen, weshalb man sagen kann, dass der Bruch mit dem geistlichen Leben die Säkularisierten in gewissem Maße disqualifizierte.38 Warum es nicht möglich war, gänzlich mit dem kirchlichen Glauben zu brechen, schildert Axel von C ampenhausen, denn in der Frühmoderne galt „[d]er Status des Dissidenten, der keinem Bekenntnis angehört und sich für den Nichtglauben entscheidet, [...] [als] rechtlich nicht zugelassen.“39 Für die kanonischrechtliche Bedeutung des Primärbegriffs „Säkularisation“ kann man zusätzlich festhalten, dass sie „ursprünglich gegen das Urteil der Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit offen“40 war und keinen automatischen Rechtsbruch implizierte. Somit konnte auch die Kirche Säkularisationen zu ihrem eigenen Vorteil verfügen.
Neben dem durch Neutralität gekennzeichneten kirchenrechtlichen Begriff gibt es den historisch-politischen Begriff, der mit dem eben beschriebenen Terminus zwar in Verbindung steht, von diesem aber wohl nicht weiter geprägt wurde. Wie bereits angeklungen war das Wort „Säkularisation“ ein seit dem Westfälischen Frieden verwendeter Begriff des Reichsrechts, wobei in der historisch-politischen Dimension seine Bedeutung ausgeweitet und das neutrale Verständnis abgelegt wurde. Allgemein bezeichnete „Säkularisation“ „die (rechtmäßige oder widerrechtliche) Überführung geistlicher Hoheitsrechte oder kirchlichen Eigentums in weltliche Hände“41, denn immer häufiger kam es vor, dass „reiche und mächtige Klöster - und geistliche Territorien überhaupt! - die begehrlichen Blicke der Herrscher auf sich gezogen [hatten] - vor allem, wenn diese in akuten Geldnöten waren.“42 Somit weckte der Begriff um 1800 einerseits Assoziationen mit einer schlechten Regierungsführung in den kirchlichen Staaten, wobei angebliche skandalöse Zustände in den Klöstern und S tiften angeklagt wurden undauch das Argument der Vermögensanhäufung in der „toten Hand“ musste als Legitimation für Säkularisationen herhalten. Andererseits schwang bei der Verwendung des Wortes auch der Kirchenhass aufklärerischer Modernisierer mit, sowie die „unberechtigte Aufhebung geistlicher Institute und E inziehung von K irchengut durch den Staat.“43
Zur besonderen Auseinandersetzung über das Ereignis und den Begriff „Säkularisation“ kam es im 19. Jahrhundert in Wissenschaft und Politik. Hier wurde der heutige Rechtsbegriff, wie er im staats- oder kirchenrechtlichen Sinn verstanden wird, durch eine geschichtsphilosophische und kulturdiagnostische Komponente ergänzt. Grundsätzlich war das Wort um 1803 allgemein bekannt undve rbreitet, weshalb die durch Aufklärung und Französische Revolution ausgelöste Welle von S äkularisationen auch vom einfachen Volk nachvollzogen werden konnte.44 Doch wie wurde der Begriff im Jahrhundert des Reichsdeputationshauptschlusses verstanden? Gemäß dem Wörterbuch des Christentums bezeichnet „Säkularisation“ im Reichsdeputationshauptschluss „die Konfiskation und Überführung kirchl. Güter in staatl. Verfügungsgewalt oder deren Verwendung zu profanen, kirchl. nicht gebilligten Zwecken.“45 Es gibt demnach zwei mögliche Verständnisse, die je nach Sichtweise von einer rechtmäßigen oder widerrechtlichen Überführung geistlicher Hoheitsrechte und Eigentums in weltliche Hände sprechen. Erstaunlich sind dabei die mitunter verschiedenen lexikalischen Definitionen, die teilweise enorme Kraft zur Provokation aufweisen, obwohl sie doch eigentlich seriöse objektive Informationsquellen sein sollten. Viele solcher Nachschlagewerke betonen beispielsweise die Eigenschaft der Illegitimität der Säkularisation und die antikatholische Haltung des Staates. Andere sprechen von den unermesslichen Verlusten an Kulturgütern und dem schweren Eingriff in die Rechte der primär betroffenen katholischen Kirche. Säkularisationsbefürwortende Deutungen hingegen heben die Entwicklung zum deutschen nationalen Gesamtstaat, moderner Gesellschaftsformen und die Besinnung der Kirche auf ihre spirituelle Kraft hervor. Für sie war die Zeit der alten Staatsformen vorbei und Montgelas machte durch die Umsetzung der Säkularisation den Weg zum modernen bayerischen Staat frei. Auch während des Kulturkampfs fungierte der Begriff „Säkularisation“ als Parole im Streit zwischen Nationalliberalen und Ultramontanen, weshalb sich an den Standpunkten im 19. Jahrhundert kaum etwas änderte. Im Lexikon religiöser Grundbegriffe wird dieser Umstand sehr passend folgendermaßen beschrieben:
„Umstritten ist nämlich, wie diese historische Entwicklung näherhin zu deuten ist, wobei die Bandbreite der antreffbaren Interpretationen von der Verfalls- bis hin zur Emanzipationsgeschichte reicht. Damit wird zugleich deutlich, daß mit der Verwendung dieses Begriffs in den meisten Fällen auch eine dezidierte Parteinahme im Streit um die Stellung des Christentums bzw. der Kirche in der modernen Gesellschaft einhergeht.“46
Nachdem über viele Jahrzehnte die emotionale Auseinandersetzung festgefahren zu sein schien, zeigte sich seit den 1950er Jahren, dass mit wachsendem zeitlichen Abstand eine beiderseitige Entemotionalisierung imUrteil über die Säkularisation Einzug erhielt, obwohl die alten Fronten noch immer sporadisch vorhanden waren. Von nun an erschienen auch differenziertere Definitionen, die sich an den historischen Ereignissen von 1803 und an der Verwendung des Begriffs im Reichsdeputationshauptschluss selbst orientierten.47 Ohne eine wertende Beurteilung vorzunehmen, hieß es nun beispielsweise, dass die Säkularisation „die Enteignung und ^Verweltlichung' von geistlichen Gütern und Herrschaften zu Beginn des 19. Jahrhunderts“48 sei. Trotzdem besaß das Wort „Säkularisation“ weiterhin im Sprachgebrauch der Menschen eine politisch-drohende und e motionale Komponente, die das Verhältnis zwischen weltlichen und geistlichen Gewalten schilderte.49 Man konnte mit dem Begriff den unrechtmäßigen, gewaltsamen und räuberischen Zugriff des Staates auf geistliches Gut assoziieren, der gleichzeitig eine gewisse Kirchen- und Religionsfeindlichkeit implizierte, die zu einem folgenreichen Kultur- und Traditionsbruch führte. Bis in die 1960er Jahre und darüber hinaus blieb deshalb, trotz der differenzierten wissenschaftlichen Forschungen in der Umgangssprache sowie in Politik und Publizistik, ein semantisches Spannungsfeld zwischen Modernisierung und Kulturbruch erhalten.
Speziell für Bayern muss man außerdem anfügen, dass der Begriff „Säkularisation“ eng mit der Person des Grafen Montgelas in Verbindung gebracht wird. Er war es, der die territoriale und machtpolitische Umwälzung akribisch vorbereitete und durchsetzen ließ. Aufgrund der Tatsache, dass vielerorts auch Unrecht durch die Säkularisationsbeamten verbreitet wurde, spaltet Montgelas bis zum heutigen Tag die Massen in ihrer Beurteilung. Auf der einen Seite fordern seine Anhänger die Errichtung eines Denkmals in München, um die Wertschätzung seiner Leistungen für den bayerischen Staat auszudrücken und auf der anderen Seite empören sich seine Gegner über solche Anregungen, da er hauptverantwortlich für die katholische Inferiorität und Zurückdrängung der Kirche sei. Bezüglich dieser Persönlichkeit muss man also ebenfalls konstatieren, dass die Emotionen nach wie vor vorhanden sind.
Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Terminus „Säkularisation“ wie dargestellt als ein Sammelbegriff für Staatenbildung, Herrschaftsübergang und M achtverlust der Kirche verwendet. Er ist damit umgangssprachlich eng mit den Geschehnissen von 1802/ 03 verbunden, obwohl es auch schon zuvor Säkularisationen gab. Neben diesem Verständnis existiert in der Wissenschaft jedoch eine Ausdifferenzierung des Begriffs, da die Säkularisation mehr umfasste, als im umgangssprachlichen Kontext suggeriert wird. Nach Eberhard Weis bezeichnet das Wort „Säkularisation“ zwei rechtlich verschiedene Vorgänge, die man beide auseinanderhalten muss. Diese Unterscheidung entspricht der heute üblichen klassischen Trennung von Herrschafts- und Vermögenssäkularisation. Erstere beinhaltet die durch den Reichsdeputationshauptschluss ermächtigte Aufhebung nahezu aller geistlichen Fürstentümer im Reich, sowie die Mediatisierung dieser Territorien unter den weltlichen Reichsständen. Herrschaftssäkularisation bedeutet aber nicht nur Neuverteilung der Gebiete, sondern auch den Übergang kirchlicher Herrschaftsrechte, wodurch die Prälatengruppe, die als Nebengewalt im System des Staatsabsolutismus nicht mehr geduldet wurde, gänzlich verschwand.50 Als Vermögenssäkularisation wiederum bezeichnet man die Aufhebung sämtlicher landsässiger Stifte und К löster innerhalb der deutschen Staaten. Besonders die nicht reichsunmittelbaren katholischen Klöster besaßen große Flächen Land, weshalb die Einziehung ihres Besitzes zur freien Verfügung der weltlichen Fürsten vorwiegend in katholischen Gegenden Anwendung fand.51 Neben Weis nimmt auch Hans-Ulrich Wehler die eben aufgezeigte Differenzierung vor, denn er schrieb:
„Der Begriff Säkularisation deckte damals zwei grundverschiedene Bedeutungen ab: Einmal bezeichnete er eine konfiskatorische Vermögenssequestration, wenn Klöster und Kirchenland in weltlichen Besitz überführt werden; zum andern meinte er Herrschaftsaneignung undL andannexion, wenn Geistliche Territorien von weltlichen aufgesogen wurden.“52
Für die Beurteilung der Säkularisation ist diese Unterscheidung besonders wichtig, da beide Vorgänge häufig unterschiedlich in Wissenschaft und P ublizistik bewertet werden. Mit anderen Worten hilft die Trennung des Begriffs in zwei Vorgänge, die Hauptaspekte der Auseinandersetzung zu identifizieren, wodurch man letztendlich auch in die Lage versetzt wird, konkrete Aussagen über die Wahrnehmung der Säkularisation zu treffen.
Abgesehen von de r Entemotionalisierung und V erwissenschaftlichung des Begriffs, meint zum Beispiel Reinhart Koselleck, dass „Säkularisation heute ein weitgreifendes und diffuses Schlagwort geworden [sei], über dessen Gebrauch kaum Einigkeit zu erzielen ist.“53 Wie in Kapitel 3 gezeigt werden wird, stehen weiterhin die Argumente der rechtlichen Fragwürdigkeit und di e antikatholische Stoßrichtung des Vorgangs im Zentrum der Säkularisationsgegner.54 Somit muss man einerseits feststellen, dass „Säkularisation“ im rechtlich-politischen Sprachgebrauch bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts und teilweise auch noch heute größtenteils mit einer negativen Bedeutungskomponente versehen ist, wobei man andererseits auch bilanzieren kann, dass bis 2003 be i der Verwendung des Begriffs ein deutlich kritischerer Vorbehalt gegen die geschichtlichen Vorgänge vorlag und gegenwärtig der Begriff eher neutral und objektiv gebraucht wird.55 Dies zeigt sich unter anderem daran, dass auch die katholische Seite nundie positiven Auswirkungen der Säkularisation, wie die Befreiung von der Dominanz des Adels und ihrer weltlichen Verpflichtungen, bejahte. Man kann dementsprechend durchaus vonp eriodisierbaren Veränderungen in der Begriffsentwicklung sprechen, da ab Mitte des 20. Jahrhunderts von den subjektiv-wertenden Urteilen zu einer faktischen Darstellung übergegangen wurde und im Laufe der Zeit bis zum Jahr 2003 die Emotionen durch objektive Beurteilungen ersetzt wurden. Dennoch bedarf der begriffsgeschichtliche Befund einer neuen Analyse, damit die Objektivierung und Neutralisierung des Begriffs nicht nur in der Forschungswelt, sondern auch im allgemeinen Sprachgebrauch Einzug erhält. Dadurch könnten letzte Assoziationen zum ehemaligen Kampfbegriff beseitigt und trotzdem der ursprüngliche kirchenrechtliche Kern bewahrt werden.56
Zum Schluss der Untersuchung von ,, Säkularisation“ soll nicht unerwähnt bleiben, dass der Begriff seit 1803 in unterschiedlicher Art undWeise geschrieben wurde. So verwendete man „Säcularisation“ in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, um die Verwandlung vonetwas Geistlichen in etwas Weltliches auszudrücken. Hierbei waren sowohl Personen als auch Gegenstände gemeint, während ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der heutige Ausdruck ,,Säkularisation“ überwiegend gebraucht wurde. Weiterhin finden sich Schreibweisen wie ,,Secularisation“ und ,,Sekularisation“, die jedoch nur selten zur Anwendung kamen.
2.2. Der Begriff Säkularisierung
Da für Hans Maier heutzutage die Bedeutung von „Säkularisation“ im B egriff „Säkularisierung“ aufgegangen ist, versucht dieser Abschnitt letztgenannten Terminus zu analysieren, wobei lediglich ein kurzer Fokus auf die gemeinsamen Verbindungslinien gelegt und hauptsächlich eine Abgrenzung beider Wörter angestrebt wird.57 „Säkularisierung“ kommt vom lateinischen Wort „saeculum“, was so viel wie Zeitalter bedeutet. In unserem Sprachgebrauch verwendet man „Säkularisierung“ aber nicht, um eine „Verzeitlichung“ auszudrücken. Vielmehr fungiert der Begriff als Parole kultureller Emanzipation und Verweltlichung.58 Genau wie auch „Säkularisation“ meinte der Begriff laut Alois Hahn und Richard Schröder anfangs den Übergang einer Person oder Sache von der geistlichen in die weltliche Sphäre, wobei das Wort „saecularisatio“59 laut vieler Quellen erstmals beim Westfälischen Frieden gefallen war. Nach übereinstimmender wissenschaftlicher Meinung gehen aber auch die beiden genannten Historiker davon aus, dass der Begriff viel älter ist. Ursprünglich bezeichnete „saecularisatio“ nämlich einen kirchenrechtlichen Akt, bei dem ein Ordensgeistlicher zum Weltgeistlichenstand wechselte. Hierbei ist wichtig darauf zu verweisen, dass sich das Wort damals noch nicht auf Gegenstände, sondern einzig auf Personen bezog. Erst seit 1646 wurde auch entfremdetes Kirchengut unter dem Begriff subsumiert. Dementsprechend besitzt „Säkularisierung“ wie auch „Säkularisation“ einen kirchenrechtlichen Kern und wurde erst später zu einem staatsrechtlichen Begriff.60 Identisch sind ebenfalls die bei diesem Terminus mitschwingenden wertenden Bezüge und negativen Assoziationen, die allerdings je nach Konfession und Einstellung auch vollkommen wertfrei sein können.61
Bis zum Ersten Weltkrieg blieb die Verwendung von „Säkularisierung“ als kulturpolitischer oder geistiger Begriff üblich, während er heutzutage vermehrt als ein geschichtsphilosophischer Begriff der modernen Entchristlichung Anwendung findet.62 Er beschreibt den Prozess des Schwundes religiöser Bindungen und transzendenter Einstellungen, was dadurch zum Ausdruck kommt, dass sich bestimmte gesellschaftliche Gruppen von d er Kirche distanzieren. Gleichzeitig treibt dieser Prozess die Relativierung kirchlicher Normen und Institutionen voran, weshalb man durchaus von einem Schwund der christlichen Prägekraft in unserer Gesellschaft sprechen kann.
Schon seit Beginn der Neuzeit ist der Staat also zunehmend säkular geworden, aber trotzdem verdeutlichen die aktuellen Diskussionen bezüglich der Verweltlichung den Gegenwartsbezug des Vorgangs. Häufig wird angeführt, dass besonders „die traditionell kirchentreuen unteren sozialen Schichten“63 in wachsendem Maße dem Einfluss der Kirchenmänner entgleiten. Es entspricht aber anscheinend wohl eher einer Tatsache, dass sogar ein Großteil der Menschen die angesprochenen Formen der Verweltlichung als selbstverständlich hinnimmt, ohne darüber zu reflektieren, weshalb man zu dem Schluss kommen kann, dass die Verwendung des Ausdrucks keine eindeutige Wertung mehr impliziert.64 Sowohl Kritiker als auch Befürworter agieren mit relativer Gelassenheit, wenn das Thema in der Öffentlichkeit diskutiert wird.65 Dies mag, wie Hermann Lübbe schreibt, daran liegen, dass „statt Religionsschwund, Transformationen der Religion in Reaktion auf Prozesse kultureller, sozialer undpolitischer Modernisierung“66 stattfinden. Mit anderen Worten sehen gerade die Historiker die Verweltlichung nicht als quantitativen Schwund, sondern als qualitativen Wandel an. Fraglich ist auch, ob für die wachsende Entfremdung von der Kirche allein das Individuum Verantwortung trägt, dessen sozialer und geistiger Wandel ohne Zweifel nachweisbar ist. Es scheint nämlich auch an den Reaktionen der Kirche zu liegen, dass viele Menschen ihr den Rücken kehren, weil sie sich nicht mehr durch sie repräsentiert fühlen. Die Beantwortung dieser These liegt jedoch außerhalb der hier zu untersuchenden Fragestellung, weshalb auch nicht näher darauf eingegangen wird.
Es war das Ziel in diesem zweiten Kapitel die Begriffe „Säkularisation“ und „Säkularisierung“ vonihren Ursprüngen bis zum heutigen Verständnis vorzustellen. Hierbei sollte besonders der Bedeutungswandel in den Fokus gerückt werden, damit die heutige Wahrnehmung der Termini besser in einen großen Kontext eingeordnet werden kann. Nach diesem begriffsgeschichtlichen Zugang zur Säkularisation wird im nun folgenden dritten Kapitel eine rechtswissenschaftliche Analyse angestellt.
3. Rechtswissenschaftliche Beurteilung der Säkularisation in Bayern von 1803 bis in die Gegenwart
Durch den Reichsdeputationshauptschluss vom 25.F ebruar 1803 wurde der Begriff „Säkularisation“ in die vorherrschende deutsche Gesetzessprache als juristischer Begriff aufgenommen.67 Wie bereits angeklungen, setzte man die Bedeutung des Wortes als allgemein bekannt voraus, weil keinerlei Definition oder Erläuterung an das Gesetz angefügt wurde. Trotzdem sorgten die Ermächtigung zur Aufhebung geistlicher Fürstentümer und die Einziehung ihrer Besitzungen aus rechtswissenschaftlicher Sicht für kontroverse Diskussionen undA useinandersetzungen. Noch bis heute kursieren unterschiedlichste Bewertungen, was die Rechtmäßigkeit und Rechtswirksamkeit des Reichsdeputationshauptschlusses und der Säkularisation angeht, weshalb in diesem Kapitel ein genauerer Blick auf die verschiedenen Beurteilungen geworfen werden soll. Dabei erscheint es als besonders wichtig, für diesen rechtswissenschaftlichen Zugang den Verlauf der Wahrnehmungen sowie den aktuellen Forschungsstand zu skizzieren.68
Der Reichsdeputationshauptschluss war die förmliche Rechtsgrundlage zur Säkularisation. Trotzdem begann der bayerische Staat „noch ohne reichsrechtliche Legitimation seit 1801 damit, Säkularisationsmaßnahmen faktisch in die Wege zu leiten.“69 Nicht zuletzt dieser Umstand sorgte nach 1803 für eine heftige rechtliche Kontroverse in Publizistik und Politik.
Auf der einen Seite waren die Gegner der Säkularisation. Zu ihnen kann man hauptsächlich Reichspublizisten, Juristen und natürlich Kirchenvertreter zählen. Sie argumentierten, dass die Besitzgarantien durch den Staat verletzt wurden und e s sich um einen klaren Rechtsbruch handelte. Dem gegenüber standen die Befürworter aus dem Bildungsbürgertum und der Politik, welche die normative Kraft aus der Faktizität des Geschehenen ableiteten undbe tonten, dass die Säkularisation eine legale Revolutionierung sei.70
An erster Stelle aufseiten der Säkularisationskritiker ist der Regensburger Domvikar Alfons Maria Scheglmann zu nennen. Um das Jahr 1903 versuchte er vehement, die Vorurteile und Gerüchte über skandalöse Zustände in den Klöstern richtigzustellen. Für ihn war die Säkularisation von 18 03 „juridisch eine illegitime Anmaßung [und] politisch ein Hochverrat“71. Der deutsche Staatsrechtler Ernst Rudolf Huber und auch der Historiker Hans- Ulrich Wehler sahen später im Reichsdeputationshauptschluss ebenfalls eine Verletzung der institutionellen und existenziellen Garantie, wie sie allen Territorien zuerkannt wurde.72
„Selbst in einem Bundesstaat wie dem Bismarckschen Reich war anerkannt, daß e ine Existenzgarantie für die Gliedstaaten bestehe, daß das Reich also nicht berechtigt sei, und zwar auch nicht auf dem Weg der Verfassungsänderung, in den Bestand der einzelnen Gliedstaaten einzugreifen; erst recht mußte das unter den alten Reichsverhältnissen gelten. “73
Für Huber bedeutete die Aufhebung der geistlichen Fürstentümer dennoch eine politische Notwendigkeit, die sich letztendlich durchgesetzt habe, weil die geistliche Herrschaft ein „Relikt einer nicht mehr zeitgemäßen Ordnung“74 war. Auch Heinrich von Treitschke und Georg Gottfried Gervinus, die sowohl Historiker als auch Politiker in der Zeit der Säkularisation waren, besaßen eine grundsätzliche Sympathie für den Vorgang. Ersterer stellte zwar heraus, dass die Säkularisation ein „ungeheurer Rechtsbruch“ war, aber wie später Huber betonte Treitschke die „große Nothwendigkeit“75 der Fürstenrevolution. Gervinus sprach derweil von „ wohlthätigen Gewaltsamkeiten“76, die ebenfalls auf gewisse Notwendigkeiten hindeuten. In der Allgemeinen deutschen Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände von 1824 war sogar zu lesen, dass „die Säkularisation [...], aus rechtlichen Gesichtspunkten betrachtet, durchaus nichts Ungerechtes [enthielt], da die geistlichen Regenten nicht durch den Willen der von ihnen regierten Völker, sondern durch bloße Anmaßung zu ihrer Herrschaft gelangt waren, mithin kein wohlerworbenes Recht (lus quaesitum) hatten.“77 Die Säkularisation wurde damit also teilweise als Rechtsbruch und gleichzeitig oftmals als „legale Revolution“ aufgrund eines gewissen Erfordernisses verstanden, welches im 19.J ahrhundert in vielen staatsrechtlichen undpol itischen Diskussionen immer wieder als Ursache und rechtliche Legitimierung des Reichsdeputationshauptschlusses Anerkennung fand.78
Nach den starken Auseinandersetzungen im 19.J ahrhundert folgten Jahrzehnte einer distanzierten Zurückhaltung in beiden Lagern. Aus Sicht von Reinhart Koselleck herrschte eine weitverbreitete Einigkeit beim Eingeständnis des Rechtsbruches durch die Säkularisation.79 Auch der Kirchenrechtler Axel von Campenhausen sah im Reichsdeputationshauptschluss von 1803 e inen revolutionären Vorgang, der jedoch darüber hinaus noch immer Auswirkungen auf die Gegenwart habe. So betrachtet er den §35 de s Reichsdeputationshauptschlusses als klassische Begründung der heutigen Staatsleistungen an die Kirche.80 Der gleichen Meinung ist Manfred Weitlauff, für den §35 noch heute enorme Bedeutung zu haben scheint, denn dieser Paragraph sei die Verpflichtung aller Staaten und Länder, ,,die durch die Säkularisation Kirchengut an s ich genommen haben [...] zum Unterhalt der Bischofsstühle, der Domkapitel, der Priesterseminarien sowie der früheren Stifts- oder Klosterpfarreien.81 Allerdings gibt es auch in diesem Bereich noch heutzutage rechtliche Unstimmigkeiten, beispielsweise bezüglich der Baulasten für Kirchengebäude und welche Kosten dabei der Staat tragen muss. Grundsätzlich sind die Baupflichtrichtlinien stark von der Säkularisation geprägt und ebenso ist das Denkmalschutzrecht derart geregelt, dass Kosten für Denkmalpflege zur Hälfte durch staatliche Zuschüsse abgedeckt werden, doch wie Frank Wittich meint, bedürfen diese Gesetze einer Erneuerung und angemessener Lösungen, um fragliche Anspruchs- und Verpflichtungsbestimmungen eindeutig zu klären.82 Insgesamt überwiegt bei der rechtlichen Bewertung des Reichsdeputationshauptschlusses neuerdings eine abwägende Ambivalenz, die so etwas wie einen Kompromiss der widersprüchlichen Beurteilungen darstellt.83 Es wird mit gebremster Leidenschaft miteinander gesprochen undrelativ sachlich über die Rechtmäßigkeit der Säkularisation gestritten. Der Rechtswissenschaftler Hans-Jürgen Becker fällt mit seiner Aussage: ,,Formal und verfahrensrechtlich hatten Reichsdeputation undR eichstag ihre Beschlüsse korrekt und einmütig gefasst, so dass ander Verbindlichkeit des Reichsdeputationshauptschlusses wohl nicht zu zweifeln ist“84 in diese Kategorie. Bei der Rechtswirksamkeit wird ferner anerkannt, dass der Reichsdeputationshauptschluss das 1806untergegangene Alte Reich überlebte und bis heute Bestand hat. Damit bildet er bis in die Gegenwart einen wichtigen Teil des Staatskirchenrechts, was sich wie gezeigt darin äußert, dass der Staat immer noch verpflichtet ist, für die Ausstattung und B esoldung der hohen Geistlichkeit zu sorgen. Problematisch empfindet Wittich aber den Umstand, dass mit zunehmendem zeitlichen Abstand die Erinnerung an historische Ereignisse, wie die Säkularisation, schwindet und gesetzlich geregelte Maßnahmen angezweifelt werden. Er meint hierzu, dass ,,[j]e weiter die Zeit voranschreitet, desto schwieriger wird es, Rechtsgrundsätze aus vergangenen Jahrhunderten nachzuvollziehen.“85 Bei vielen Bürgern sei aus diesem Grund die Tatsache, dass der Freistaat Bayern als Rechtsnachfolger der Klöster und Stifte noch in deren Schuld steht, nicht mehr im allgemeinen Gedächtnis verankert. In die gleiche Richtung argumentierte 2011 der ehemalige Generaldirektor der Staatlichen Archive Bayerns Hermann Rumschöttel, der die Kirche vor dem Laizismus warnte, welcher dazu führen könnte, dass die Staatsleistungen eines Tages hinterfragt und womöglich gestoppt werden.86
Durch diese Aussagen werden die Folgen der Säkularisation für die rechtliche Ordnung des Staat-Kirchen-Verhältnisses deutlich. Nach Hans-Wolfgang Strätz habe die Säkularisation „den entscheidenden Anstoß für die Entwicklung der charakteristischen Merkmale des heutigen Staatskirchenrechts gegeben.“87 Neben den Staatsleistungen an die Kirchen wurde das kirchliche Besteuerungsrecht, das Selbstverwaltungsrecht und der Status einer öffentlichrechtlichen Körperschaft eingeführt, was gleichbedeutend mit einer Kompetenzabgabe des Reiches war. Dennoch verzichtete der Staat nicht auf zentrale Regelungen, wie das heutige Grundgesetz zeigt. So garantiert er zum Beispiel die individuelle Glaubensfreiheit.88 Dabei ist anzumerken, dass das Grundrecht der Religionsfreiheit aber nicht nur die Abstinenz von der Religion, sondern auch deren Ausübung schützt. Zeitgenössisch hatte es lange Zeit den antireligiösen Sinn als Abwehrrecht gegen konfessionelle Vereinnahmung und der positive Aspekt, das Recht auf Entfaltung der religiösen Überzeugung, gewann erst mit zunehmender Säkularisierung der Gesellschaft an Bedeutung. Es ist dementsprechend nach heutigem Verständnis ein individuelles und kollektives Recht geworden, das zwar erst in der Weimarer Reichsverfassung 1919 zur vollen Entfaltung gekommen ist, aber durch die Säkularisation in die Wege geleitet wurde.89
Daneben gilt die grundsätzliche Gleichbehandlung aller Religionen als weiterer großer Verdienst der Säkularisation.90 Die Politik hatte damals erkannt, dass bei einer religiösen Begründung des Staates eine volkseigene Geschlossenheit nicht möglich sein kann, da die Bevölkerung keine religiöse Einheit bildete. Aus diesem Beweggrund verlor die Konfessionszugehörigkeit der Bürger im 19. Jahrhundert ihre normative Bedeutung für die staatliche Integration.91 Trotzdem darf nicht vergessen werden, dass die Religionsfreiheit dadurch eingeschränkt wurde, indem der Fortbestand der Ordensgemeinschaften allein von der politischen Opportunität abhängig war.92 Dies wertete man zeitgenössisch ungeachtet der rechtlichen Fortschritte als Kirchenhass und Bevormundung durch den Staat.93 Nachdem bis hierher vermehrt rechtliche Wahrnehmungen zeitgenössischer und gegenwärtiger Natur angeführt wurden, soll nun a nhand einer der neuesten und umfassendsten rechtswissenschaftlichen Analysen zum Reichsdeputationshauptschluss konkret dessen aktuelle wissenschaftliche Beurteilung beleuchtet werden. Vorgelegt wurde diese im Jahr 2007 von Ingo Knecht. Auch er bewertet die Rechtmäßigkeit des Gesetzes in formeller und materieller Hinsicht als problematisch. Um seine Untersuchung aber nachvollziehen zu können, muss ein kurzer Exkurs in die Rahmenbedingungen des Reichsdeputationshauptschlusses unternommen werden:
Es ist allgemein bekannt, dass der Hauptschluss der außerordentlichen Reichsdeputation während der letzten Sitzung des Reichstages am 25. Februar 1803 in Regensburg einstimmig verabschiedet wurde und nach der kaiserlichen Ratifikation am 27. April 1803 in Kraft trat. Weniger bekannt ist dagegen, dass bereits Ende des Jahres 1802 viele geistliche Fürsten auf ihre weltlichen Herrschaftsrechte und damit auch auf ihren Sitz im Reichstag verzichteten, um nicht über ihre Zukunft abstimmen zu müssen. Es entspricht aber wohl auch der Wahrheit, dass viele geistliche Gebiete bereits militärisch besetzt waren und die Resignation im Reichstag einerseits als Zeichen der Machtlosigkeit, sowie andererseits als fehlende Bereitschaft zum Protest angesehen werden kann. Hieraus ergibt sich, dass das letzte bedeutende Gesetz des Heiligen Römischen Reiches94 zwar einstimmig, aber nicht durch Zustimmung aller Reichsstände zustande kam, weshalb es verständlich ist, wenn viele die Rechtmäßigkeit des Beschlusses anzweifeln.
Knecht erklärt in seiner Abhandlung den Reichsdeputationshauptschluss für formell rechtmäßig, weil er konform mit der alten Reichsverfassung durch Reichstagsbeschluss und Ratifizierung des Kaisers, zustande kam. Zwar nahmen die aufzulösenden Reichsstände nicht am Beschluss teil, jedoch blieben sie freiwillig und ohne Zwang von der Abstimmung fern.95 Auch wenn die Kirchenvertreter demnach nicht direkt zustimmten, stelle dies kein Verstoß gegen das Reichsverfassungsrecht dar, denn gewohnheitsrechtlich galt das Fernbleiben als Zustimmung zum Abstimmungsgegenstand. Trotz des formal rechtmäßigen Beschlusses sind materielle Rechtmäßigkeit und Rechtswirksamkeit aber umstritten, wie Knecht weiterhin verdeutlicht.96
Die materielle Rechtmäßigkeit verneint er, weil seiner Meinung nach das Heilige Römische Reich Deutscher Nation als Bundesstaat zu qualifizieren ist, in dem jeder Gliedstaat aufgrund des Grundsatzes der Existenzgarantie im Verfassungsrecht geschützt war. Folglich hätten die geistlichen Fürstentümer ihrer Auflösung zustimmen müssen, weshalb ihr freiwilliges Fernbleiben für die materielle Rechtmäßigkeit nicht ausreicht.97 Zusätzlich sei die Vermögenssäkularisation materiell rechtswidrig, weil Eigentum eine geschützte Rechtsposition gewesen ist, „die für Reich und Territorien grundsätzlich unangreifbar war.“98 Selbst die Ansicht des 19. Jahrhunderts, dass der Reichsdeputationshauptschluss durch einen Staatsnotstand gerechtfertigt sei, weist er entschieden zurück, weil das Gesetz für ihn nicht die letzte Möglichkeit war, den Bestand des Staates zu sichern.
Am Ende seiner Analyse kommt Knecht somit zu dem Schluss, dass der Reichsdeputationshauptschluss zwar rechtswidrig, aber dennoch rechtswirksam aufgrund der „normativen Kraft des Faktischen“99 sei. Das neue Recht wurde durch keine Revolution geschaffen, da sämtliche Kompetenzen der Reichsorgane bestehen blieben. Zusätzlich führt er an, dass der Reichsdeputationshauptschluss ein allgemein zur Kenntnis genommener Zustand gewesen ist, der größtenteils akzeptiert wurde, auch wenn er rechtswidrig entstanden war. Er begünstigte ganz entscheidend die Bildung der modernen Mittelstaaten, welche wiederum die Grundlage für den heutigen Föderalismus darstellten und auch die Entwicklung der Grundrechte wurde erst durch die sozial-gesellschaftlichen Veränderungen ermöglicht.100
Als Abschluss dieses rechtswissenschaftlichen Zugangs wird nochmals darauf verwiesen, dass der Reichsdeputationshauptschluss bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation in Kraft blieb unddanach im Landesrecht fortbestand. Er beendete die jahrhundertealte Tradition kirchlicher Herrschaftsgebiete, was anhand der vielschichtigen Auswirkungen, wie gebietsrechtliche Veränderungen, Einflüsse auf Wirtschaft und Gesellschaft und Zerstörung der Reichsstruktur101 rückblickend als Traditionsbruch, aber auch als Modernisierungsschub betrachtet werden kann. Für Knecht überwiegt das Positive, denn nach seiner Ansicht gab der Reichsdeputationshauptschluss die Richtung für die Weiterentwicklung zum Nationalstaat, der sich durch konfessionelle Neutralität auszeichnete, vor.102 Damit schließt sich letztendlich auch der Kreis zu dem eingangs des Kapitels zitierten Campenhausen, für den ,,[d]ie Bestimmungen des Grundgesetzes [...] der vorläufige Schlußpunkt einer jahrhundertealten Entwicklung des Zusammenspiels von Staat, Kirche und Gesellschaft [sind].“103
4. Historisch-politische Beurteilung der Säkularisation von 1803 in Bayern
Dieses Kapitel bildet den eigentlichen Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit. Um das Urteil über die Säkularisation in Bayern von d er zeitgenössischen Wahrnehmung bis in die Gegenwart zu analysieren, bedarf es nämlich neben den bereits untersuchten begrifflichen und rechtswissenschaftlichen Beurteilungen zweifellos eines historisch-politischen Zugangs. Gerade die gesetzliche Grundlage für die Säkularisation, der Reichsdeputationshauptschluss, verkörpert einen der Vorgänge der deutschen Geschichte, dessen historische undpol itische Einordnungen stark von den religiösen Standpunkten abweichen. In der Rezeptionsgeschichte zeigen dabei besonders die markanten, teilweise polemischen Urteile die Deutungsvielfalt des Reichsdeputationshauptschlusses auf.104 Da die Säkularisation scheinbar sogar bis heute ambivalent betrachtet wird, was selbstverständlich auch den Reiz am Thema ausmacht, werden gezielt die Beurteilungen der Geschichtswissenschaft, der Kirche und des Staates vorgestellt. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Ausführungen wird hierbei allerdings verstärkt chronologisch vorgegangen, um in einem weiteren Schritt, den zeitlichen Verlauf der Urteile bewerten zu können. Dies impliziert auch, dass an dieser Stelle keinerlei Kritik oder Würdigung der Beurteilungen erfolgt und lediglich in Form von Z itaten die Wahrnehmungen über die Säkularisation geschildert werden.
Bekanntermaßen helfen verschiedenste historische Quellen, wie Tagebücher, Briefe aber auch Biografien, um Wahrnehmungen undB eurteilungen zu identifizieren, wobei es leider so zu sein scheint, dass gerade die Quellenlage über die zeitgenössischen Urteile sehr ungünstig beschaffen oder nur ungenügend aufbereitet worden ist. Im Gegensatz zu der Vielzahl an Material, was über die heutige Wahrnehmung der Säkularisation zu finden ist, wird aus diesem Grund die zeitgenössische Beurteilung weniger angemessen behandelt als die Gegenwärtige.105 Der Nachteil dieses Umstandes liegt ebenfalls auf der Hand, denn das geschichtliche Gesamtbild kann nicht ganz gleichwertig dargestellt werden. Nichtsdestotrotz wird versucht, einen umfassenden und l etztendlich für die Fragestellung gewinnbringenden Überblick zu schaffen.
[...]
1 Der Begriff ist Ende des 16. Jahrhunderts im Französischen aufgekommen und meinte zunächst die Überführung eines Ordensgeistlichen in den weltlichen Status. Seit dem Westfalischen Frieden von 1648 steht er für die Überführung von Kirchengütern in weltliche Herrschaft. Säkularisation dient auch der christlichen oder antichristlichen Kulturkritik und erlangt hierbei eine geschichtsphilosophische Dimension. Siehe dazu die Ausführungen in Kapitel 2.
2 Vgl. Weitlauff, Manfred: Der Staat greift nach der Kirche. Die Säkularisation von 1802/03 und ihre Folgen, in: Weitlauff, Manfred (Hrsg.): Kirche im 19. Jahrhundert, Regensburg 1998, S. 32.
3 Oer, Rudolfine: Die Säkularisation von 1803 - Durchführung und Auswirkungen, in: Langner, Albrecht (Hrsg.): Säkularisation und Säkularisierung im 19. Jahrhundert, Paderborn 1978, S. 14.
4 Vgl. Hanschmidt, Alwin: Die Säkularisation von 1803 nach 200 Jahren. Eine Umschau in der Literatur zu einem „Mega-Ereignis“ historischen Gedenkens, in: Brechenmacher, Thomas/ Damberg, Wilhelm/ Felten, Franz-Josef u.a.: Historisches Jahrbuch 129, München 2009, S. 411.
5 Die Säkularisation verschonte aber das Eigentum der Pfarreien und bis 1809 auch den Malteser- und Deutschorden. Siehe dazu: Hausberger, Karl/ Hubensteiner, Benno: Bayerische Kirchengeschichte, München 1985, S. 275.
6 Die Zahlen variieren bei vielen Autoren, wobei häufig von etwa drei Millionen Menschen gesprochen wird. Siehe auch: Hanschmidt, Alwin: Die Säkularisation von 1803 nach 200 Jahren, S. 412.
7 Ist die Aufhebung der Reichsunmittelbarkeit eines weltlichen Reichsstandes.
8 Vgl. Quarthal, Franz: Die Mediatisierung des Adels in Oberschwaben, in: Blickle, Peter/ Schlögl, Rudolf (Hrsg.): Die Säkularisation im Prozess der Säkularisierung Europas, Epfendorf 2005, S. 352.
9 Vgl. Weitlauf, Manfred: Der Staat greift nach der Kirche, S. 44.
10 Vgl. Weis, Eberhard: Die Säkularisation der bayerischen Klöster 1802/03. Neue Forschungen zu Vorgeschichte und Ergebnissen, München 1983, S. 55.
11 Vgl. Outis: Die Säkularisation in Bayern, in: Augsburger Postzeitung, Nr. 48 vom 28. Februar 1903, S. 2.
12 Feuerstein-Praßer, Karin: Klostersturm, in: Geschichte mit Pfiff, Nr. 10, Nürnberg 2000, S. 30.
13 Vgl. Hausberger, Karl: Staat und Kirche nach der Säkularisation. Zur bayerischen Konkordatspolitik im frühen 19. Jahrhundert, St. Ottilien 1983, S.23.
14 Vgl. Blessing, Werner Karl: Verödung oder Fortschritt? Zu den gesellschaftlichen Folgen der Säkularisation, in: Schmid, Alois (Hrsg.): Die Säkularisation in Bayern 1803. Kulturbruch oder Modernisierung?, München 2003, S. 335-337.
15 Blumenberg, Hans: Säkularisierung und Selbstbehauptung. Erweiterte und überarbeitete Neuausgabe von »Die Legitimität der Neuzeit«, erster und zweiter Teil, Frankfurt am Main 1974, S. 10.
16 Demel, Walter: Bayern, der Reichsdeputationshauptschluß und die Säkularisation, in: Klueting, Harm (Hrsg.): 200 Jahre Reichsdeputationshauptschluß. Säkularisation, Mediatisierung und Modernisierung zwischen Altem Reich und neuer Staatlichkeit, Münster 2005, S. 115.
17 Vgl. Blessing, Werner Karl: Verödung oder Fortschritt?, S. 335.
18 Vgl. Schmid, Alois (Hrsg.): Die Säkularisation in Bayern 1803. Kulturbruch oder Modernisierung?, München 2003.
19 Köchl, Maximilian: Die Säkularisation in Bayern von 1803 - ein Rückblick. Teil III: Die Folgen - Versuch einer Bilanz, in: Köchl, Dietlinde: Streifzüge durch unsere Geschichte, Aying 2008, S. 105.
20 Vgl. Pötzl, Walter: Reaktionen der Bevölkerung, in: Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns (Hrsg.): Bayern ohne Klöster? Die Säkularisation 1802/03 und die Folgen, München 2003, S. 431.
21 Vgl. Schulze, Winfried: Die Säkularisation als Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, in: Blickle, Peter/ Schlögl, Rudolf (Hrsg.): Die Säkularisation im Prozess der Säkularisierung Europas, Epfendorf 2005, S. 341f.
22 Vgl. Weigand, Katharina: Der Streit um die Säkularisation. Zu den Auseinandersetzungen in Wissenschaft und Öffentlichkeit im 19. und 20. Jahrhundert, in: Schmid, Alois (Hrsg.): Die Säkularisation in Bayern 1803. Kulturbruch oder Modernisierung?, München 2003.
23 Vgl. Oer, Rudolfine: Zur Beurteilung der Säkularisation von 1803, in: Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts für Geschichte (Hrsg.): Festschrift für Hermann Heimpel zum 70. Geburtstag am 19. September 1971, Göttingen 1971, S. 511-521.
24 Vgl. Knecht, Ingo: Der Reichsdeputationshauptschluss vom 25. Februar 1803. Rechtmäßigkeit, Rechtswirksamkeit und verfassungsgeschichtliche Bedeutung, Berlin 2007.
25 Lübbe, Hermann: Säkularisierung. Geschichte eines ideenpolitischen Begriffs, München 2003, S. 12.
26 Lübbe, Hermann: Säkularisierung, S. 13f.
27 Vgl. Lübbe, Hermann: Säkularisierung, S. 14.
28 Blickle, Peter/ Schlögl, Rudolf (Hrsg.): Die Säkularisation im Prozess der Säkularisierung Europas, Epfendorf 2005, S. 16.
29 Vgl. Weis, Eberhard: Montgelas. Der Architekt des modernen bayerischen Staates 1799-1838, Band 2, München 2005, S. 149.
30 Vgl. Cabick, Hubert/ Gladigow, Burkhard/Kohl, Karl-Heinz (Hrsg.): Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe, Band 5, Stuttgart 2001, S. 10.
31 Vgl. Maier, Hans: Säkularisation. Schicksale eines Rechtsbegriffs im neuzeitlichen Europa, in: Schmid, Alois (Hrsg.): Die Säkularisation in Bayern 1803. Kulturbruch oder Modernisierung?, München 2003, S. 14.
32 Auch bekannt als Henri II. d’Orléans.
33 Vgl. Lübbe, Hermann: Säkularisierung, S. 23.
34 Koselleck, Reinhart: Zeitgeschichten. Studien zur Historik, Frankfurt am Main 2000, S. 180.
35 Lübbe, Hermann: Säkularisierung, S. 25.
36 Vgl. Kirmeier, Josef: Einzug von Kirchengut und Säkularisation. Die Begriffe und ihre Geschichte bis zur Französischen Revolution, in: Kirmeier, Josef/ Treml, Manfred (Hrsg.): Glanz und Ende der alten Klöster. Säkularisation im bayerischen Oberland 1803, München 1991, S. 23.
37 Lateinisches Wort für Weltgeistlicher.
38 Vgl. Lübbe, Hermann: Säkularisierung, S. 27.
39 Campenhausen, Axel: Religionsfreiheit. Oekumenische Bestandsaufnahme nach dem II. Vatikanischen Konzil, Göttingen 1971, S. 14.
40 Lübbe, Hermann: Säkularisierung, S. 24.
41 Conze, Werner/ Strätz, Hans-Wolfgang/ Zabel, Hermann: Art. Säkularisation, Säkularisierung, in: Brunner, Otto/ Conce, Werner/ Koselleck, Reinhart (Hrsg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart 1984, S. 790.
42 Maier, Hans: Säkularisation, S. 15.
43 Kastner, Karl: Die große Säkularisation in Deutschland, Paderborn 1925, S. 3.
44 Vgl. Koselleck, Reinhart: Zeitgeschichten, S. 181.
45 Drehsen, Volker/ Häring, Hermann/ Kuschel, Karl-Josefu.a. (Hrsg.): Wörterbuch des Christentums, Gütersloh 1988, S. 1108.
46 Khoury, Adel Theodor (Hrsg.): Lexikon religiöser Grundbegriffe. Judentum, Christentum, Islam, Graz 1987,
S. 939.
47 Vgl. Rumschöttel, Hermann: Die Debatte um die Säkularisation von der zeitgenössischen Wahrnehmung bis in die Gegenwart, (Unveröffentlichtes Manuskript), Vortrag in der Abtei St. Bonifaz am Mittwoch, 27. Juli 2011, 20.00 Uhr im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Das Ende der Bavaria Sancta. Die Säkularisation von 1803 und ihre Folgen“.
48 Khoury, Adel Theodor (Hrsg.): Lexikon religiöser Grundbegriffe, S. 938.
49 Vgl. Rumschöttel, Hermann: Die Debatte um die Säkularisation von der zeitgenössischen Wahrnehmung bis in die Gegenwart.
50 Vgl. Weis, Eberhard: Die politischen Rahmenbedingungen zur Zeit der Säkularisation, in: Kirmeier, Josef/ Treml, Manfred (Hrsg.): Glanz und Ende der alten Klöster. Säkularisation im bayerischen Oberland 1803, München 1991, S. 28.
51 Vgl. Weis, Eberhard: Die politischen Rahmenbedingungen zur Zeit der Säkularisation, S. 28. Siehe auch: Weigand, Katharina: Der Streit um die Säkularisation, S. 367.
52 Wehler, Hans-Ulrich: Deutsche Gesellschaftsgeschichte, München 2006, S. 363.
53 Koselleck, Reinhart: Zeitgeschichten, S. 179.
54 Vgl. Schulze, Winfried: Die Säkularisation als Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation,
S. 339.
55 Vgl. Rumschöttel, Hermann: Die Debatte um die Säkularisation von der zeitgenössischen Wahrnehmung bis in die Gegenwart.
56 Vgl. Koselleck, Reinhart: Zeitgeschichten, S. 181.
57 Vgl. Maier, Hans: Säkularisation, S.21.
58 Vgl. Lübbe, Hermann: Säkularisierung, S.41. Siehe auch: Schröder, Richard: Säkularisierung: Ursprung und Entwicklung eines umstrittenen Begriffs, in: Braun, Christina von/Grab, Wilhelm/ Zachhuber, Johannes (Hrsg.): Säkularisierung. Bilanz und Perspektiven einer umstrittenen These, Berlin 2007, S. 61.
59 Im Gegensatz zu Hermann Lübbe bei Richard Schröder mit einem „s“ statt einem „z“ geschrieben.
60 Vgl. Schröder, Richard: Säkularisierung, S. 62f.
61 Vgl. Hahn, Alois: Religion und der Verlust der Sinngebung. Identitätsprobleme in der modernen Gesellschaft, Frankfurt am Main 1974, S. 24f. Siehe auch: Schröder, Richard: Säkularisierung, S. 61.
62 Vgl. Kirmeier, Josef: Einzug von Kirchengut und Säkularisation, S. 23.
63 Marbach, Rainer: Säkularisierung und sozialer Wandel im 19. Jahrhundert. Die Stellung von Geistlichen zu Entkirchlichung und Entchristlichung in einem Bezirk der hannoverschen Landeskirche, Göttingen 1978,
S. 173.
64 Vgl. Blumenberg, Hans: Säkularisierung und Selbstbehauptung, S. 9.
65 Vgl. Blumenberg, Hans: Säkularisierung und Selbstbehauptung, S. 10.
66 Lübbe, Hermann: Säkularisierung, S. IX.
67 Vgl. Cabick, Hubert/ Gladigow, Burkhard/Kohl, Karl-Heinz (Hrsg.): Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe, S. 9.
68 Vgl. Strätz, Hans-Wolfgang: Die Säkularisation und ihre nächsten staatskirchenrechtlichen Folgen, in:
Langner, Albrecht (Hrsg.): Säkularisationund Säkularisierung im 19. Jahrhundert, Paderborn 1978, S. 32f.
69 Strätz, Hans-Wolfgang: Die Säkularisation und ihre nächsten staatskirchenrechtlichen Folgen, S. 36.
70 Vgl. Härter, Karl: Der Hauptschluß der außerordentlichen Reichsdeputation vom 25. Februar 1803: Genese, Dynamik und Ambivalenz der legalen „Revolutionierung“ des Alten Reiches, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 54 (2003), S. 484-500.
71 Scheglmann, Alfons Maria: Geschichte der Säkularisation im rechtsrheinischen Bayern, Band 3, Zweiter Teil, Regensburg 1908, S. 263.
72 Vgl. Wehler, Hans-Ulrich: Deutsche Gesellschaftsgeschichte, S. 364.
73 Huber, Ernst-Rudolf: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Stuttgart 1967, S. 46.
74 Huber, Ernst-Rudolf: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, S. 46.
75 Treitschke, Heinrich von: Deutsche Geschichte im Neunzehnten Jahrhundert, Berlin 1879, S. 186.
76 Gervinus, Georg Gottfried: Einleitung in die Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts, Leipzig 1853, S. 144.
77 Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände. Conversations-Lexikon, 6. Auflage, Band 8, Leipzig 1824, S. 542.
78 Vgl. Rumschöttel, Hermann: Die Debatte um die Säkularisation von der zeitgenössischen Wahrnehmung bis in die Gegenwart.
79 Vgl. Koselleck, Reinhart/ Vierhaus, Rudolf (Hrsg.): Die Säkularisation 1803 - Vorbereitung - Diskussion - Durchführung, Göttingen 1970, S. 8.
80 Ingo Knecht hingegen meint, dass sich unmittelbar aus §35 Reichsdeputationshauptschluss keine Ansprüche der Kirchen auf Unterstützungszahlungen ergaben und erst durch spätere konkretere Gesetze dies geschah.
Vgl. dazu: Knecht, Ingo: Der Reichsdeputationshauptschluss vom 25. Februar 1803, S. 276.
81 Weitlauff, Manfred: Der Staat greift nach der Kirche, S. 35.
82 Vgl. Wittich, Frank: Die Verpflichtungen des Staates als Rechtsnachfolger der Klöster und Stifte, in: Kirmeier, Josef/ Treml, Manfred (Hrsg.): Glanz und Ende der alten Klöster. Säkularisation im bayerischen Oberland 1803, München 1991, S. 118-121.
83 Vgl. Rumschöttel, Hermann: Die Debatte um die Säkularisation von der zeitgenössischen Wahrnehmung bis in die Gegenwart.
84 Becker, Hans-Jürgen: Umbruch in Europa. Der Reichsdeputationshauptschluss von 1803, in: Schmid, Peter/ Unger, Klemens (Hrsg.): 1803 Wende in Europas Mitte. Vom feudalen zum bürgerlichen Zeitalter,
Regensburg 2003, S.31.
85 Wittich, Frank: Die Verpflichtungen des Staates als Rechtsnachfolger der Klöster und Stifte, S. 120.
86 Vgl. Rumschöttel, Hermann: Die Debatte um die Säkularisation von der zeitgenössischen Wahrnehmung bis in die Gegenwart.
87 Strätz, Hans-Wolfgang: Die Säkularisation und ihre nächsten staatskirchenrechtlichen Folgen, S.31.
88 Vgl. Strätz, Hans-Wolfgang: Die Säkularisation und ihre nächsten staatskirchenrechtlichen Folgen, S. 43-49.
23
89 Vgl. Campenhausen, Axel: Staat und Kirche unter dem Grundgesetz. Eine Orientierung, Hannover 1994, S. 26.
90 Vgl. Campenhausen, Axel: Religionsfreiheit, S. 7.
91 Vgl. Campenhausen, Axel: Staat und Kirche unter dem Grundgesetz, S. 27.
92 Der Eintritt in ein Kloster benötigte die staatliche Zustimmung.
93 Vgl. Strätz, Hans-Wolfgang: Die Säkularisation und ihre nächsten staatskirchenrechtlichen Folgen, S. 50f.
94 Hat den Charakter des letzten Grundgesetzes des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.
95 Vgl. Knecht, Ingo: Der Reichsdeputationshauptschluss vom 25. Februar 1803, S. 276.
96 Vgl. Hanschmidt, Alwin: Die Säkularisation von 1803 nach 200 Jahren, S. 395.
97 Vgl. Knecht, Ingo: Der Reichsdeputationshauptschluss vom 25. Februar 1803, S. 277.
98 Knecht, Ingo: Der Reichsdeputationshauptschluss vom 25. Februar 1803, S. 277.
99 Knecht, Ingo: Der Reichsdeputationshauptschluss vom 25. Februar 1803, S. 278.
100 Vgl. Knecht, Ingo: Der Reichsdeputationshauptschluss vom 25. Februar 1803, S. 278.
101 Vgl. Knecht, Ingo: Der Reichsdeputationshauptschluss vom 25. Februar 1803, S. 235.
102 Vgl. Knecht, Ingo: Der Reichsdeputationshauptschluss vom 25. Februar 1803, S. 242.
103 Campenhausen, Axel: Staat und Kirche unter dem Grundgesetz, S. 10.
104 Vgl. Koppetsch, Axel: Das „schimpflichste, ungerechteste und unglücklichste Werk“ der deutschen Geschichte oder wohltuendes „Auslüften der Mottenkiste des Heiligen Römischen Reiches“? Der Reichsdeputationshauptschluß im Urteil der Nachwelt, in: Gärtner, Ulrike, Koppetsch, Judith (Hrsg.): Klostersturm und Fürstenrevolution, Bönen 2003, S. 302.
105 Vgl. Koselleck, Reinhart/ Vierhaus, Rudolf (Hrsg.): Die Säkularisation 1803 - Vorbereitung - Diskussion - Durchführung, S.7.
- Quote paper
- Master of Arts Alexander Eichler (Author), 2012, Das Urteil über die Säkularisation in Bayern von der zeitgenössischen Wahrnehmung bis in die Gegenwart, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210562