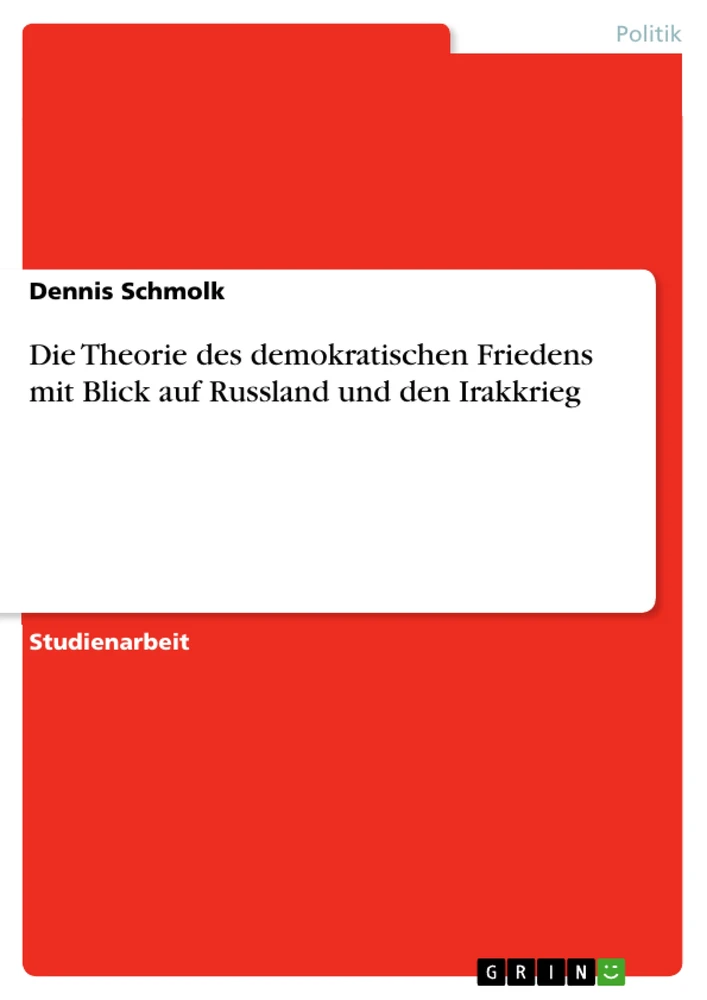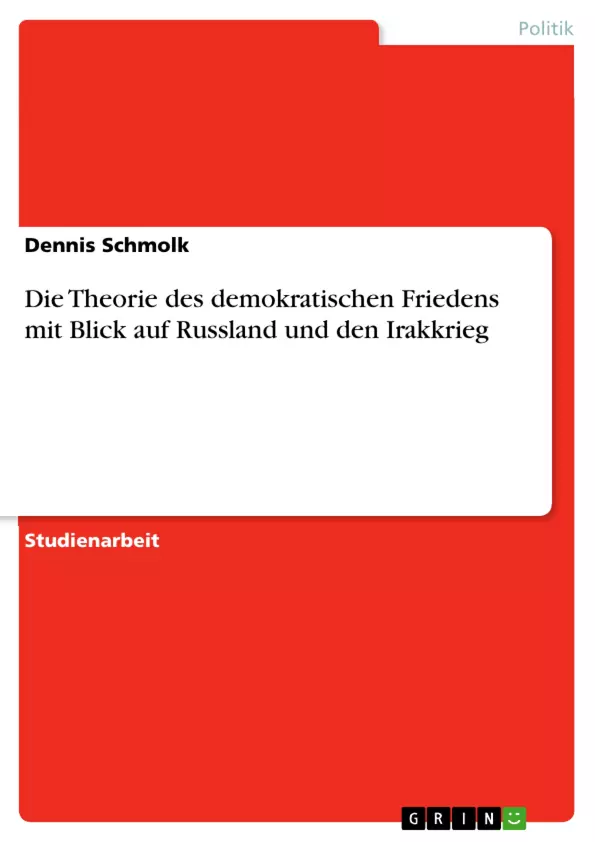Auch heute ist die globalisierte Welt keineswegs davor gefeit, zum Schauplatz von Kriegen und anderen gewaltsamen Auseinandersetzungen zu werden. Im Gegenteil: Die Wikipedia listet für das 21. Jahrhundert bereits jetzt sechs andauernde bzw. neu entstandene Kriege auf. Hinzu kommen zahllose weltweite Konflikte, die aufgrund ihrer Größe, ihrer internationalen Bedeutung oder einzelner Interessenslagen nicht als Kriege erfasst werden, wohl aber mit denselben verhehrenden Folgen einhergehen. Auch steht nicht zu erwarten, dass das gerade angebrochene Jahrhundert ein friedliches werden wird: In Iran und Nordkorea forschen autoritäre Staaten an Atomwaffen; in Irak und Afghanistan versagen klassische Einsatzkräfte – darunter die deutsche Bundeswehr – im Kampf gegen asymmetrische Gegner; große Teile des afrikanischen Kontinents sind Brandherde von ethnischen und religiösen Völkerkriegen. Krieg scheint – trotz aller Regime, internationaler Organisationen und pazifistischer Ideologien – unausrottbar. Im Zuge der Globalisierung und Technisierung entstehen sogar neue Kriegsformen, die jener eben erwähnten Asymmetrisierung der Konfliktparteien entstammen.3
Ein fundiertes Verstäandnis von den Entstehungsbedingungen von Kriegen zwischen modernen, technologisch fortgeschrittenen Staaten unserer Zeit ist daher offensichtlich ein unverzichtberer Bestandteil der Internationalen Beziehungen. Im Folgenden soll anhand der (liberalen) Theorie des demokratischen Friedens dargestellt werden, wie Konfliktvermeidung und -lösung zwischen Demokratien funktioniert und weshalb sie gegenüber Autokratien scheitert. Kriege von Autokratien untereinander sind nicht Gegenstand der Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Die aktuelle Gefahrenlage in der Welt
- Der Demokratische Frieden oder: Warum führen Demokratien keinen Krieg gegeneinander?
- Entstehung einer Theorie
- Exkurs: Liberale Theorien in den Internationalen Beziehungen
- Der liberale Charakter der Theorie des demokratischen Friedens
- Zwei Theoriestränge
- Rückführung auf das Politische System
- Rückführung auf die politische Kultur
- Beispiel 1: Friedliche Lösung von Konflikten zwischen Demokratien: Russland und Europa
- Konfliktfelder
- Konfliktvermeidung und -klärung
- Erklärung der Beziehung anhand der Theorie des demokratischen Friedens
- Kein Sicherheitsdilemma
- Kosten eines Kriegsfalles
- Beispiel 2: Der Krieg der amerikanischen Demokratie gegen den autokratischen Irak unter Saddam Hussein
- Situation im Irak unter Saddam Hussein
- Spekulation über die Kriegsgründe
- Erklärung der amerikanischen Invasion anhand der Theorie des demokratischen Friedens
- Grenzen und weitere Perspektiven der Theorie
- Warum überhaupt Krieg?
- Erklärungskraft bzgl. „Neuer Kriege“
- Verbreitung von Werten?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Theorie des demokratischen Friedens, indem sie analysiert, warum Demokratien seltener Kriege gegeneinander führen als gegen nicht-demokratische Staaten. Die Arbeit fokussiert auf die Entstehung der Theorie, ihre liberale Grundlage und ihre empirische Basis. Ziel ist es, die Theorie zu erläutern und anhand zweier Beispiele, des Verhältnisses zwischen Russland und Europa sowie des Irakkrieges, zu illustrieren.
- Die Entstehung und Entwicklung der Theorie des demokratischen Friedens
- Die liberale Grundlage der Theorie
- Die empirische Evidenz der Theorie
- Die Anwendung der Theorie auf konkrete Konflikte
- Die Grenzen und Schwächen der Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel stellt die aktuelle Gefahrenlage in der Welt dar, die von Kriegen und Gewalt geprägt ist. Es wird argumentiert, dass ein fundiertes Verständnis der Entstehungsbedingungen von Kriegen ein unverzichtbarer Bestandteil der Internationalen Beziehungen ist.
- Das zweite Kapitel widmet sich der Theorie des demokratischen Friedens. Es werden die Entstehung der Theorie, ihre liberale Grundlage und die beiden wichtigsten Theoriestränge, die auf das politische System bzw. die politische Kultur zurückführen, erläutert.
- Das dritte Kapitel beleuchtet das Beispiel der Beziehung zwischen Russland und Europa. Es werden die Konfliktfelder, die Konfliktvermeidung und -klärung sowie die Erklärung dieser Beziehung anhand der Theorie des demokratischen Friedens untersucht.
- Das vierte Kapitel analysiert den Irakkrieg unter der Perspektive der Theorie des demokratischen Friedens. Die Situation im Irak unter Saddam Hussein, die Kriegsgründe und die Erklärung der amerikanischen Invasion werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen und Begriffe dieser Arbeit sind: Theorie des demokratischen Friedens, liberale Theorien, Internationale Beziehungen, Konfliktvermeidung, Krieg, Demokratie, Autokratie, Russland, Europa, Irak, Sicherheitsdilemma.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Theorie des demokratischen Friedens?
Die Theorie besagt, dass Demokratien fast nie Kriege gegeneinander führen, da sie Konflikte eher durch diplomatische und kulturelle Mechanismen lösen.
Warum führen Demokratien trotzdem Kriege gegen Autokratien?
Die Arbeit erklärt dies damit, dass die friedensfördernden Mechanismen (wie Gewaltenteilung oder politische Kultur) gegenüber autokratischen Systemen oft nicht greifen.
Welche Rolle spielt Russland in dieser Analyse?
Russland dient als Beispiel für die Untersuchung von Konfliktvermeidung und -lösung im Verhältnis zu Europa unter der Perspektive des demokratischen Friedens.
Wie wird der Irakkrieg von 2003 in der Arbeit eingeordnet?
Die Invasion der USA im Irak wird als Beispiel für den Krieg einer Demokratie gegen eine Autokratie analysiert, um die Logik der Theorie zu illustrieren.
Was ist das „Sicherheitsdilemma“?
Es beschreibt die Situation, in der die Aufrüstung eines Staates zur Verunsicherung anderer führt. Die Theorie untersucht, warum dies zwischen Demokratien seltener auftritt.
Gibt es Kritik an der Theorie des demokratischen Friedens?
Ja, die Arbeit diskutiert auch die Grenzen der Theorie, insbesondere ihre Erklärungskraft bei sogenannten „Neuen Kriegen“ und asymmetrischen Konflikten.
- Quote paper
- Dennis Schmolk (Author), 2008, Die Theorie des demokratischen Friedens mit Blick auf Russland und den Irakkrieg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210597