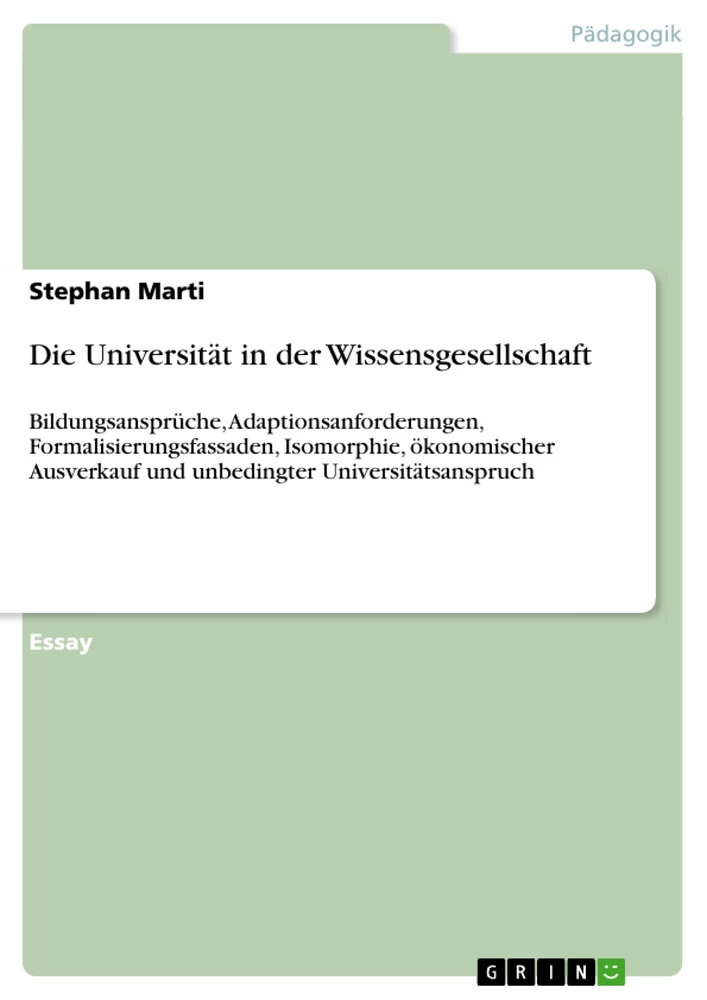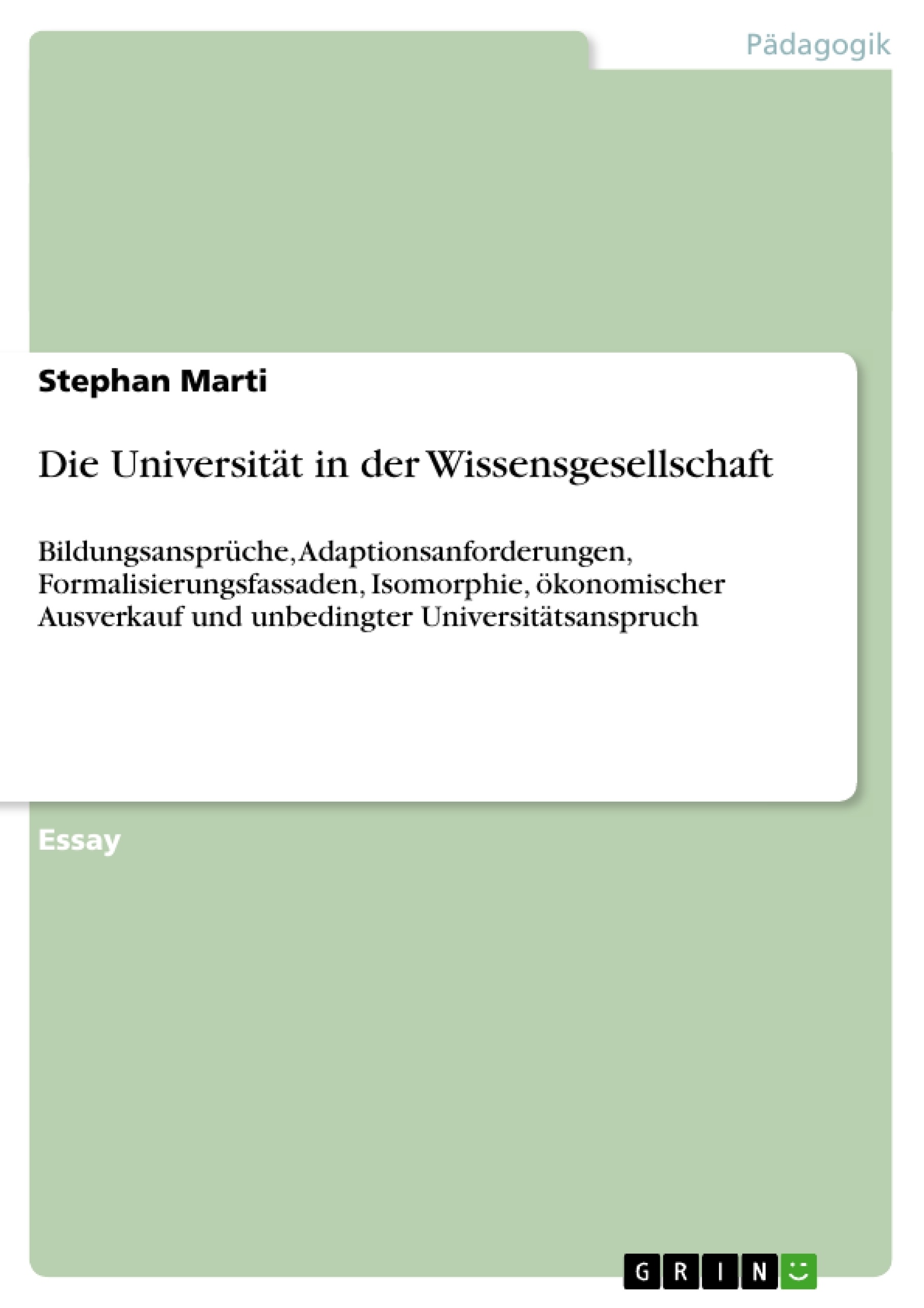Das Essay erörtert die Transformation der Universität im Kontext der Wissensgesellschaft hin zur "marktwirtschaftlichen Universität". In Abgrenzung dessen wird die "marktwirtschaftliche Universität" dem Konzept der "unbegingten Universität" gegenübergestellt.
Die Universität zwischen Bildungsansprüchen, Adaptionsanforderungen, Formalisierungsfassaden, Isomorphie, ökonomischem Ausverkauf und unbedingtem Universitätsanspruch
Marti Stephan
"Eine Falltür, ein Spiegel... wir müssen fast am Ziel sein." (Der Name der Rose)
Die Universität als gesellschaftliche Institution unterliegt heute und unterlag schon immer den vorherrschenden historischen Gegebenheiten. Die Einwirkung auf diese Institution ist und war geprägt durch die gesellschaftlichen Bildungsmächte (vgl. Weniger 1952). Was es heute bedeutet und schon immer bedeutete, im jeweils historisch-gesellschaftlich vorherrschenden Kontext die Idee, vielleicht sogar den Anspruch, der 'unbedingten Universität' zu bewahren zu versuchen, soll als Leitfrage durch dieses Essay führen.
Erich Ode nimmt das zehnjährige Jubiläum der Bologna-Reform zum Anlass einer kritischen Rückschau und der Klärung grundsätzlicher Fragen im Zusammenhang mit der Universität. Im derridaischen Verständnis bedient er sich dem bedingungslosen Recht zu hinterfragen und kommt zum Schluss, dass Humboldts Idee der Universität als Ort der Bildung und Freiheit tot sei (vgl. Ode 2012, S. 6). Die 'moderne Universität' ordnete sich seiner Meinung nach seit dem EU-Programm zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit (Lissabon 2000) „einer übergeordneten wirtschaftlichen Strategie“ (ebd., S. 2) unter, nämlich der Bologna-Reform. Was daraus folgte sei bekannt: Bachelor, Master, der Modularisierungsversuch von Wissen, der Verbuchung studentischer Leistung nach Zeitaufwand statt Qualität, die Einführung einer punkteorientierten Zahlungsinstanz und der Erwerb vordefinierter Kompetenzen (vgl., ebd.). Zu ergänzen wäre an dieser Stelle der daraus resultierende 'Abarbeiterstolz' statt einem 'Urheberstolz' bei den Studierenden und die schale Erkenntnis bei Dozierenden und Professoren, dass es mit dem Erwerb vorgefertigter Kompetenzen nicht so ganz klappen will. Zudem scheinen weder die Kernziele der Reform nicht realisiert worden zu sein, noch hat sich die Studiendauer verkürzt oder die direkte Berufsqualifizierung verbessert. Eine Erhöhung der Studierendenmobilität wurde gemäss Ode ebenfalls verfehlt (ebd.). Der traditionelle Bildungsanspruch der Schulen und insbesondere der Universität, den es vielleicht so gar nie gegeben haben mag, denn Humboldts Idee wurde bekanntlich nie realisiert, wurde über PISA und Bologna an die Wirtschaft gekoppelt, wobei ein unternehmerisches Selbstverständnis, sowie eine Anpassung an die Erfordernisse des (Arbeit)Marktes installiert wurde. Kants Idee von einer Universität, welche die Suche nach der Wahrheit verfolgt, diesen gefundenen Wahrheitsgehalt kritisch betrachtet und hinterfragt - dies in völliger Unabhängigkeit von Staat und Obrigkeit - wurde vom Nützlichkeitsdogmatismus abgelöst (vgl., ebd.). Die Universität lasse sich in die Dienste äusserer Zwecke nehmen. Die hier bei Kant skizzierten Wesensmerkmale der akademischen Freiheit und Selbstbestimmung schwanden in den letzten 20 Jahren im Zuge oben genannter Zusammenführung von Wirtschaft und Wissenschaft, was zu den ebenfalls aufgezeigten Adaptionsforderungen und Adaptionsvollzügen geführt hat. Rationale Methoden der Organisationsforschung hielten vor allem in der letzten Dekade Einzug in die Universitäten und fragten dort, in erster Linie bei den Geisteswissenschaften, nach deren Legitimation. Gerade in den USA kam es zu einer Transformation der universitären Landschaft in Folge des wirtschaftlichen Drucks durch die Marktorientierung. Geboren war die 'Market-Model University' (vgl. Engell, Dangerfield 1998). Es folgte eine globale Hochschulexpansion, welche „increasingly extends into the furthest reaches of daily life, spreading universalized understandings of all aspects of nature and every social institution worldwide” (Meyer, Frank 2007, S. 289). Diese Expansion erfolgte nach Engell / Dangerfield jedoch eindeutig auf Kosten der Geisteswissenschaften und deren Vernachlässigung.
[...]
- Arbeit zitieren
- MA Educational Sciences und MA Educational Sciences Stephan Marti (Autor:in), 2012, Die Universität in der Wissensgesellschaft, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210630