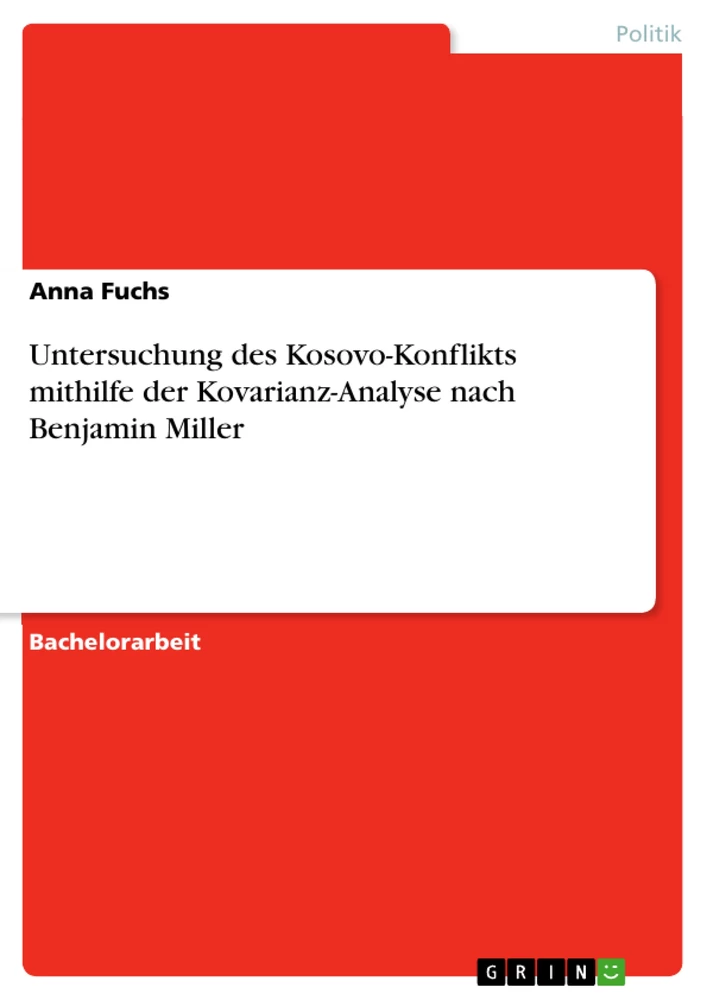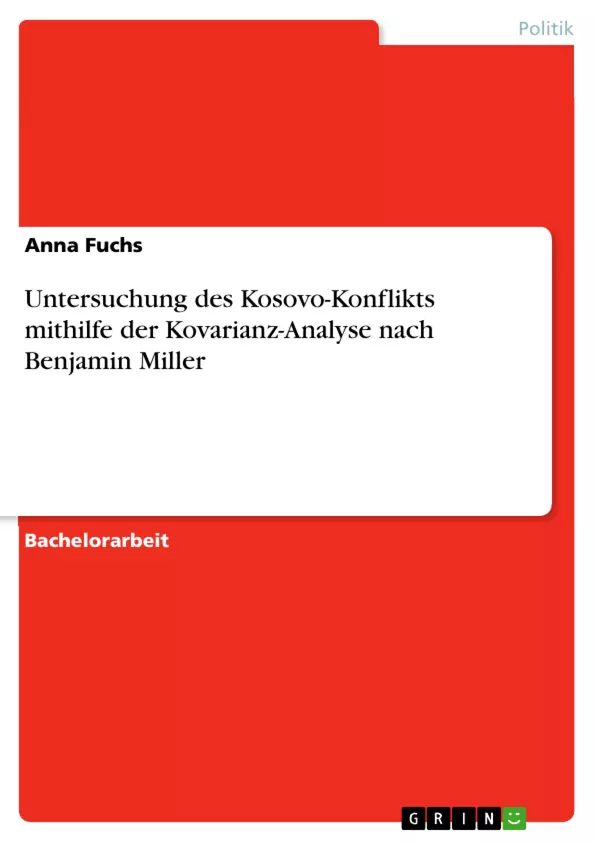Seit dem 10. September 2012 ist der Kosovo vollständig souverän. Acht Jahre nach der Erklärung der Unabhängigkeit von Serbien am 17. Februar 2008 erlangte die Republik Kosovo ihre Selbstständigkeit – zuvor hatte die ehemalige serbische Provinz noch unter „Beaufsichtigung“ durch die internationale Gemeinschaft gestanden, externe Akteure konnten über den Kosovo-Beauftragten Gesetze und Entscheidungen der Regierung korrigieren. Doch obwohl der Kosovo-Krieg schon seit mehr als zehn Jahren beendet ist und die Mehrheit der Staaten seine Unabhängigkeit von Serbien anerkennt, kommt der junge Staat nicht zur Ruhe. Immer wieder kommt es zu Konflikten mit Serbien und/oder der serbischen Minderheit im Land. Sowohl Serbien als auch die Kosovo-Albaner erhe- ben Anspruch auf das Gebiet des Kosovo: Für Serbien ist der Kosovo ein integraler Be- standteil seines Territoriums und die Unabhängigkeit der Provinz eine Verletzung der serbischen Souveränität. Für die Kosovo-Albaner hingegen ist die Unabhängigkeit ihres Staates eine teuer bezahlte Errungenschaft, für die sie jahrzehntelang gekämpft haben, und die sie nicht wieder aufgeben möchten. Der Kosovo ist ihr Staat, seine Unabhängigkeit Ausdruck ihres Rechts auf Selbstbestimmung. Seit mehreren Jahrhunderten streiten sich in diesem Konflikt die beiden ethnischen Gruppen um das selbe Territorium, das für beide Gruppen Hauptausdruck ihrer nationalen Identität ist.
Benjamin Miller erklärt solche Konflikte mit seiner state-to-nation balance-Theorie: Er argumentiert, dass eine state-to-nation imbalance, also der Mangel an Übereinstimmung zwischen den Grenzen einer Region und den nationalen Zugehörigkeiten und der politischen Identifizierung der Bevölkerung mit den regionalen Staaten, die Hauptursache für regionale Konflikte sei.
Mit dieser Theorie lässt sich erklären, warum der Kosovo-Konflikt nach so langer Zeit noch immer nicht gelöst ist.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. „A Theory of Regional War and Peace“
2.1. Die s tate-to-nation balance als regionaler/innenpolitischer Faktor (UV1)
2.2. Das regionale Engagement von Großmächten als globaler Faktor (UV2)
2.3. Die liberale Kompatibilität einer Region (IV)
2.4. Faktoren, welche die state-to-nation balance beeinflussen (BV1, 2, 3)
2.5. Die Art des regionalen Friedens bzw. Kriegs (AV)
2.5.1. Die vier Arten regionaler Ordnung nach Miller
2.5.2. Die Kriegsanfälligkeit einer Region
3. Der Kosovo-Konflikt: Fallbeschreibung
4. Kovarianz-Analyse: Die Ursachen des Kosovo-Konflikts
4.1. Die interne Inkongruenz Serbiens (BV1)
4.2. Serbien/Jugoslawien – Ein schwacher Staat (BV2)
4.3. Die hohe state-to-nation incongruence (UV1)
4.4. Die Kooperation der Großmächte (UV2)
4.5. Das Resultat: Kalter Frieden (AV)
5. Fazit
6. Annex
6.1. Tabellenverzeichnis
6.1.1. Tabelle 1: Vier Typen von Staaten und ihre Auswirkungen auf die regionale state-to-nation balance
6.1.2. Tabelle 2: Vier Kategorien regionaler Ordnung
6.1.3. Tabelle 3: regionale Kriegsanfälligkeit
6.2. Dokumente
6.2.1. Das Dayton-Abkommen
6.2.2. Das Holbrooke-Milošević-Abkommen
6.2.3. Der Ahtisaari-Plan
7. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale These der state-to-nation balance-Theorie?
Benjamin Miller argumentiert, dass ein Mangel an Übereinstimmung zwischen Staatsgrenzen und der nationalen Identität der Bevölkerung (state-to-nation imbalance) die Hauptursache für regionale Konflikte ist.
Wann wurde der Kosovo vollständig souverän?
Der Kosovo ist seit dem 10. September 2012 vollständig souverän, nachdem die Phase der internationalen Beaufsichtigung endete.
Warum ist der Kosovo-Konflikt so schwer zu lösen?
Beide ethnischen Gruppen (Serben und Kosovo-Albaner) erheben Anspruch auf dasselbe Territorium, das für beide ein zentraler Bestandteil ihrer nationalen Identität ist.
Welche Rolle spielen Großmächte im Kosovo-Konflikt laut Miller?
Das regionale Engagement von Großmächten wird als globaler Faktor (unabhängige Variable) betrachtet, der die Art des regionalen Friedens oder Krieges maßgeblich beeinflusst.
Was versteht Miller unter "Kaltem Frieden" im Kontext des Kosovo?
Kalter Frieden beschreibt einen Zustand, in dem zwar keine aktiven Kampfhandlungen stattfinden, die tieferliegenden Ursachen des Konflikts jedoch ungelöst bleiben und Spannungen fortbestehen.
Welche historischen Abkommen werden in der Analyse erwähnt?
Die Arbeit bezieht sich unter anderem auf das Dayton-Abkommen, das Holbrooke-Milošević-Abkommen und den Ahtisaari-Plan.
- Citar trabajo
- Anna Fuchs (Autor), 2012, Untersuchung des Kosovo-Konflikts mithilfe der Kovarianz-Analyse nach Benjamin Miller, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210632