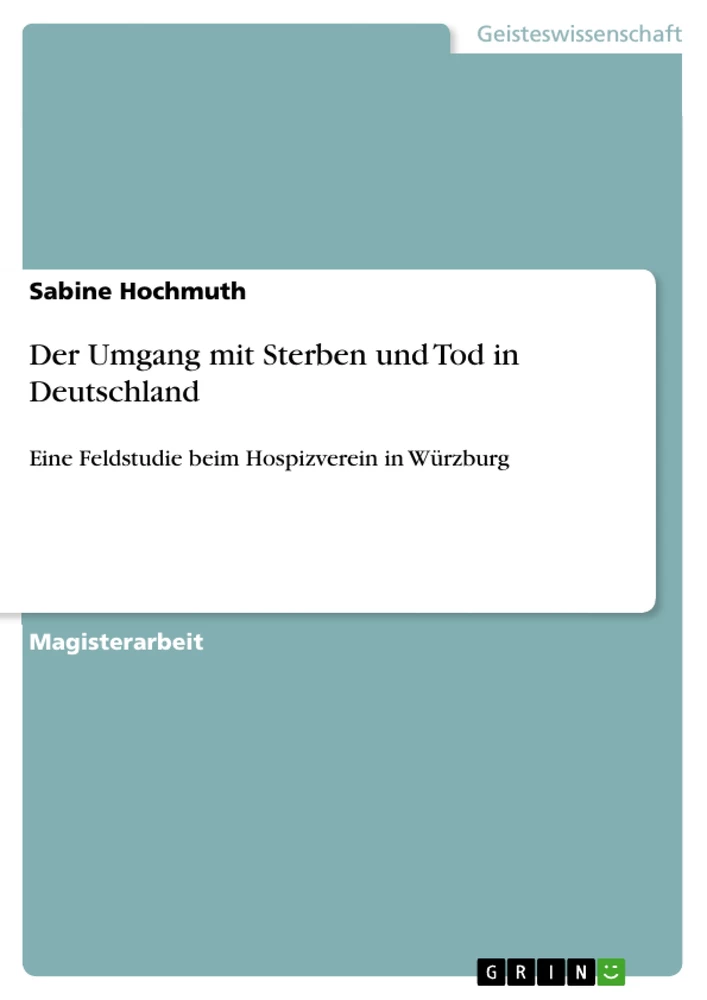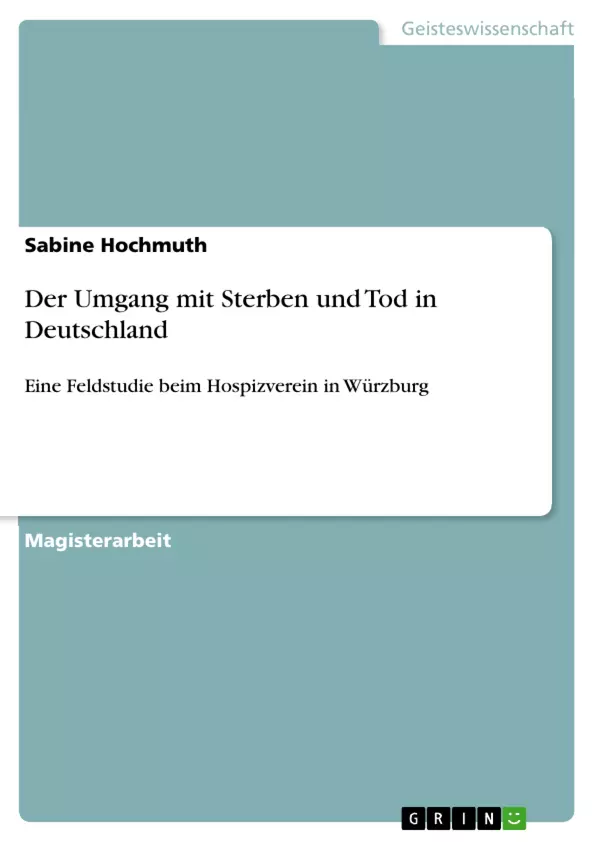In der Literatur über Sterben und Tod findet sich häufig die Überzeugung, daß der Umgang mit diesen in der neuzeitlichen, westlichen Industriegesellschaft durch Angst und Verdrängung geprägt sei. Das ist kein neues Phänomen. Es wird allerdings angenommen, daß der Tod sowohl in anderen Gesellschaften als auch in der europäischen Vergangenheit als ein 'natürlicher' Teil des Lebens betrachtet wurde; zum Teil sogar, daß der Umgang mit ihm auf einem angeborenen Instinktverhalten beruhe.
Voraussetzung für das Verständnis des heutigen Umgangs mit Sterben und Tod ist die Bestandsaufnahme der kulturellen Ausdrucksformen, Vorstellungen und der Verhaltensmuster im Zusammenhang mit Sterben und Tod in der Vergangenheit und Neuzeit der deutschen und anderer Gesellschaften: Wo und wie wird gestorben, was bedeutet der Tod sowohl für die von ihm betroffene Gemeinschaft als auch den Einzelnen, wie wird der Leichnam behandelt, wie wird getrauert, was hat sich im Vergleich zu früher geändert?
Dies geschieht auch unter der Fragestellung, ob die stetige Veränderung der Sozialstruktur, die zwangsläufig bei einer zunehmenden Industrialisierung und Individuation eintreten muß, zu einer spezifischen Haltung gegenüber dem Phänomen des Sterbens und des Todes führt. In diesem Zusammenhang wird einerseits ein Exkurs zu den indigenen Völkern, ihrem Umgang und insbesondere deren Rituale um Sterben und Tod und andererseits in die Vergangenheit der deutschen Gesellschaft notwendig sein.
Heute sind solche Rituale weitgehend in Vergessenheit geraten. Dem modernen Menschen bietet sich darüber hinaus kaum noch die Möglichkeit, Erfahrungen durch das unmittelbare Erleben von Sterben und Tod zu sammeln. Dies hat zur Folge, daß er ohne durch die Gesellschaft vorgegebene Verhaltensmuster zur Kanalisierung seiner Emotionen mit einer ungewohnten Situation konfrontiert ist. Neben anderen Determinanten führt das Fehlen einer Sterbe- und Todeskultur in der gegenwärtigen deutschen Gesellschaft zu Unsicherheit im Umgang mit Sterben und Tod.
Nicht nur die Veränderung der Sozialstruktur, sondern auch die normative, kulturelle, ökonomische und medizinisch-technische Entwicklung der deutschen Gesellschaft zog eine veränderte Sicht und folglich einen anderen Umgang mit Sterben und Tod nach sich. Durch diesen umfangreichen Wandel verlor der Tod seine existenzielle Bedeutung sowohl für die Gemeinschaft insgesamt als auch für das Individuum.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Vorstellungen über das Sterben und den Tod
- 2.1. Definitionen von Sterben und Tod und deren inhaltliche Bedeutung
- 2.2. Das Ritual als Manifestation einer Vorstellung
- 2.2.1. Das Strukturmodell der Riten nach Van Gennep
- 2.3. Vergleich der Vorstellungen in verschiedenen Gesellschaften
- 2.4. Kollektive und individuelle Sterbe- und Todesvorstellungen
- 2.5. Das Verhältnis zwischen der Vorstellung von Zeit, Sterben und Tod
- 2.6. Vorstellungen über Sterben und Tod in der modernen Gesellschaft
- 3. Der Umgang mit Sterben und Tod
- 3.1. Geschichtliche Entwicklung des Umgangs mit Sterben und Tod
- 3.2. Der Umgang mit Sterben und Tod in der Vergangenheit
- 3.3. Der Umgang mit Sterben und Tod in der Gegenwart
- 3.3.1. Todesanzeigen
- 3.3.2. Bestattung
- 3.3.3. Trauer
- 3.4. Faktoren, die den Umgang mit Sterben und Tod determinieren
- 4. Survey
- 4.1. Demoskopische Daten
- 4.2. Hospizbewegung
- 4.2.1. Deutsche Hospiz Stiftung
- 4.2.2. Der Hospizverein Würzburg
- 5. Feldstudie
- 5.1. Methode der Inhaltsanalyse
- 5.2. Inhaltsanalyse
- 6. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Umgang mit Sterben und Tod in der gegenwärtigen deutschen Gesellschaft. Ziel ist nicht die Entwicklung einer neuen Theorie, sondern die Beschreibung und Analyse der Ursachen und Prozesse dieses Umgangs unter Einbezug bestehender Theorien. Die Arbeit hinterfragt die weit verbreitete Annahme, dass Angst und Verdrängung den Umgang mit Sterben und Tod in der modernen westlichen Gesellschaft prägen.
- Geschichtliche Entwicklung des Umgangs mit Sterben und Tod
- Vergleichende Betrachtung von Sterbe- und Todesvorstellungen in verschiedenen Gesellschaften
- Einfluss von Sozialstruktur, Kultur und Technologie auf den Umgang mit Sterben und Tod
- Analyse von Riten und Ritualen im Zusammenhang mit Sterben und Tod
- Die Rolle von Emotionen im Umgang mit Sterben und Tod
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt die Forschungsfrage: Wie wird mit Sterben und Tod in der heutigen deutschen Gesellschaft umgegangen und welche Faktoren prägen diesen Umgang? Sie stellt die Hypothese der Verdrängung in Frage und kündigt einen interdisziplinären Forschungsansatz an, der ethnologische, historische, soziologische und psychologische Perspektiven einbezieht. Die Arbeit verspricht eine umfassende Analyse, die sowohl kulturelle Ausdrucksformen als auch Verhaltensmuster beleuchtet.
2. Vorstellungen über das Sterben und den Tod: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Vorstellungen über Sterben und Tod, sowohl in der modernen Gesellschaft als auch in anderen Kulturen und historischen Epochen. Es analysiert Definitionen von Sterben und Tod und deren Bedeutung, sowie die Rolle von Ritualen als Manifestation von Vorstellungen. Vergleichende Studien verschiedener Gesellschaften werden vorgestellt, um die Bandbreite der individuellen und kollektiven Auffassungen zu verdeutlichen. Das Verhältnis zwischen Zeitvorstellungen, Sterben und Tod wird ebenfalls untersucht.
3. Der Umgang mit Sterben und Tod: Dieses Kapitel befasst sich mit der geschichtlichen Entwicklung des Umgangs mit Sterben und Tod in Deutschland und anderen Gesellschaften. Es analysiert den Wandel des Umgangs mit Sterben und Tod von der Vergangenheit bis zur Gegenwart, inklusive der Behandlung von Todesanzeigen, Bestattungen und Trauer. Es untersucht Faktoren wie Gesellschaftsordnung, Kultur, Wirtschaft, Religion und Medizintechnik, die diesen Umgang prägen. Es werden auch die Konsequenzen des Verlustes einer traditionellen Sterbe- und Todeskultur diskutiert.
4. Survey: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik und Ergebnisse einer umfassenden Studie, welche demografische Daten erfasst und den Einfluss der Hospizbewegung auf den Umgang mit Sterben und Tod analysiert. Sowohl die Deutsche Hospiz Stiftung als auch der Hospizverein Würzburg werden im Detail untersucht. Die Daten und Methoden des Surveys liefern wichtige empirische Grundlage für die weiteren Kapitel.
5. Feldstudie: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse einer Feldstudie, die qualitative Methoden wie Inhaltsanalyse und teilnehmende Beobachtung einsetzt. Es beschreibt im Detail die eingesetzte Methodik und interpretiert die gewonnenen Daten im Kontext des gesamten Forschungsprojekts. Der Fokus liegt auf der Analyse der Ergebnisse und ihrer Relevanz für die zentrale Forschungsfrage.
Schlüsselwörter
Sterben, Tod, Trauer, Rituale, Hospizbewegung, Deutschland, Moderne Gesellschaft, Kultur, Geschichte, Sozialstruktur, Ethnologie, qualitative Sozialforschung, Verdrängung, individuelle und kollektive Vorstellungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Umgang mit Sterben und Tod in der gegenwärtigen deutschen Gesellschaft
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht den Umgang mit Sterben und Tod in der heutigen deutschen Gesellschaft. Sie analysiert die Ursachen und Prozesse dieses Umgangs und hinterfragt die Annahme, dass Angst und Verdrängung den Umgang prägen.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Ziel ist nicht die Entwicklung einer neuen Theorie, sondern die Beschreibung und Analyse des Umgangs mit Sterben und Tod unter Einbezug bestehender Theorien. Die Arbeit verwendet einen interdisziplinären Ansatz, der ethnologische, historische, soziologische und psychologische Perspektiven einbezieht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der geschichtlichen Entwicklung des Umgangs mit Sterben und Tod, vergleicht Sterbe- und Todesvorstellungen in verschiedenen Gesellschaften, analysiert den Einfluss von Sozialstruktur, Kultur und Technologie, untersucht Rituale im Zusammenhang mit Sterben und Tod und beleuchtet die Rolle von Emotionen.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit und worum geht es darin?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung (Einführung in die Thematik und Forschungsfrage), Vorstellungen über Sterben und Tod (Analyse verschiedener Vorstellungen in verschiedenen Kulturen und Epochen), Umgang mit Sterben und Tod (geschichtliche Entwicklung und gegenwärtige Praktiken), Survey (Beschreibung einer Studie mit demografischen Daten und Analyse der Hospizbewegung), Feldstudie (Präsentation der Ergebnisse einer qualitativen Feldstudie mit Inhaltsanalyse) und Zusammenfassung und Ausblick (Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick auf zukünftige Forschung).
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet sowohl quantitative Methoden (Survey mit demografischen Daten) als auch qualitative Methoden (Inhaltsanalyse und teilnehmende Beobachtung in der Feldstudie). Die Deutsche Hospiz Stiftung und der Hospizverein Würzburg werden als Fallbeispiele untersucht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sterben, Tod, Trauer, Rituale, Hospizbewegung, Deutschland, Moderne Gesellschaft, Kultur, Geschichte, Sozialstruktur, Ethnologie, qualitative Sozialforschung, Verdrängung, individuelle und kollektive Vorstellungen.
Welche Hypothese wird in der Arbeit geprüft?
Die Arbeit hinterfragt die weit verbreitete Annahme, dass Angst und Verdrängung den Umgang mit Sterben und Tod in der modernen westlichen Gesellschaft prägen.
Welche Quellen werden in der Arbeit herangezogen?
Die Arbeit bezieht sich auf ethnologische, historische, soziologische und psychologische Perspektiven und verwendet Daten aus einem Survey und einer Feldstudie. Genaueres zu den verwendeten Quellen ist im Literaturverzeichnis der vollständigen Arbeit aufgeführt.
- Quote paper
- Sabine Hochmuth (Author), 1999, Der Umgang mit Sterben und Tod in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210641