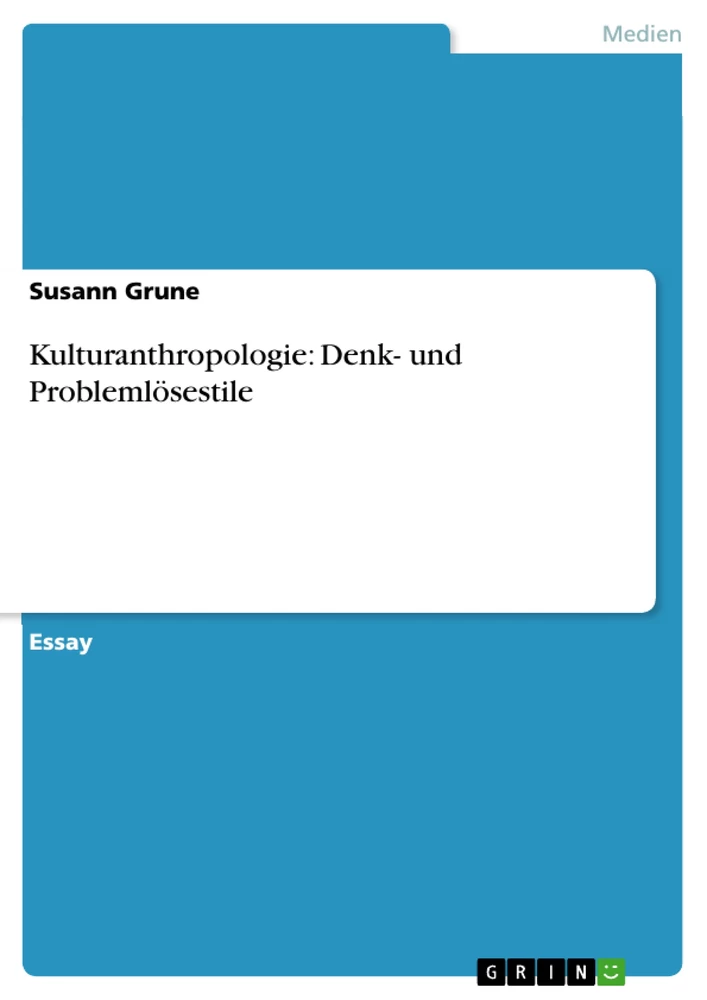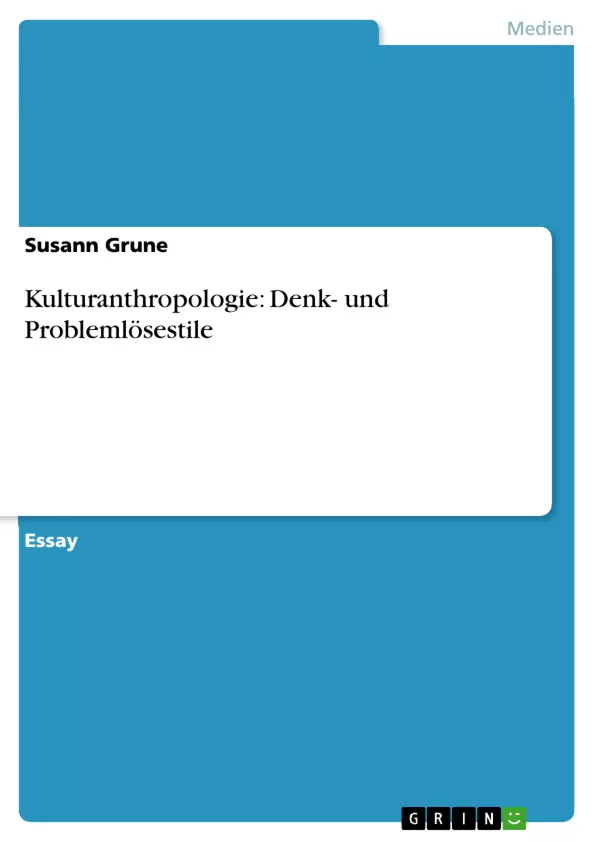In der folgenden Niederschrift wird eine ausführliche thematische Auseinandersetzung des Referats mit dem Titel 'Denk- und Problemlösestile' im Rahmen des Seminars 'Kulturanthropologie' vorgenommen. Einleitend ist erwähnenswert, dass Denken und Problemlösen als Fähigkeiten des Individuums nach Dörner “Werkzeuge des psychischen Apparates zur Reduktion von Unbestimmtheit (...)” sind. Was aber zeichnet Unbestimmtheit aus? Dieser Zustand von Unsicherheit tritt mehrmals täglich, oft unbewusst und in unterschiedlicher Intensität auf, weil darunter ebenso außerplanmäßige Verkehrsausfälle wie komplexe Fragen der Zukunfts- und Berufsplanung fallen. Letztlich ist die im Zitat aufgeworfene Reduktion von Unbestimmtheit nicht denkbar ohne die Kultur selbst, weil diese für eine gewisse Routine im Sinne eines 'Automatismus' beiträgt.
1. Einleitung
In der folgenden Niederschrift wird eine ausführliche thematische Auseinandersetzung des Referats mit dem Titel 'Denk- und Problemlösestile' im Rahmen des Seminars 'Kulturanthropologie' vorgenommen. Einleitend ist erwähnenswert, dass Denken und Problemlösen als Fähigkeiten des Individuums nach Dörner “Werkzeuge des psychischen Apparates zur Reduktion von Unbestimmtheit (...)” sind[l]. Was aber zeichnet Unbestimmtheit aus? Dieser Zustand von Unsicherheit tritt mehrmals täglich, oft unbe-wusst und in unterschiedlicher Intensität auf, weil darunter ebenso außerplanmäßige Verkehrsausfälle wie komplexe Fragen der Zukunfts- und Berufsplanung fallen. Letztlich ist die im Zitat aufgeworfene Reduktion von Unbestimmtheit nicht denkbar ohne die Kultur selbst, weil diese für eine gewisse Routine im Sinne eines 'Automatismus' beiträgt. Erst dadurch wird das Denken des Individuums entlastet und sein Überleben gesichert. Die Ausarbeitung basiert ergo auf der Grundannahme, dass nicht nur individuelle Faktoren, sondern auch kulturelle Aspekte das menschliche Handeln, Denken und Problemlösen in der Art der Umsetzung
– nicht aber als Fähigkeit per se – beeinflussen und verändern können. Demnach werden menschliche Handlungen sozusagen durch ein strategisches Modell determiniert, welches eine Planerstellung begünstigt, wodurch Entscheidungen abgeleitet werden können. Diese Entscheidungen sind optimalerweise 'funktionsäquivalent', weil sie zum jeweiligen kulturellen Umfeld passen müssen.[2]
Ist nun die unterschiedliche Verwendung von Denkstilen eine stichhaltige Erklärung für das Entstehen von Konflikten und Missverständnissen im interpersonalen und interkul- turellen Verhältnis? Um eine Sensibilisierung für diese Problematik zu erreichen, ist eine Analyse von Entscheidungen für bestimmte Maßnahmen unabdingbar. Folglich dient der erste Teil der Schaffung einer theoretischen Basis, wobei zunächst eine Konzentration auf die Analyse von Denkprozessen innerhalb der deutschen Nation erfolgen soll. Im Rahmen dieses zentralen Bestandteils des Problemlöseprozesses wurden verschiedene Entscheidungsmuster beispielsweise für statische und für komplexe Probleme sowie für die Wahrnehmung von Ästhetik und Sprache festgestellt. Elementar wichtig für das Verständnis dieser Differenzen ist die Trennung in deduktiv- analytischer und in induktiv-essayistischer Denkweise, wobei die Berücksichtigung übergeordneter Denksysteme für die Interpretation des asiatischen Denk- und
Problemlösens enormes Gewicht besitzt. Aus diesem Grund wird im Anschluss an diese Theorie der Denkweisen in der ost- und west-deutschen Kultur eine theoretische Erklärung zum asiatischen Denken vorgenommen. Analog zur eher theoretischen Auseinandersetzung mit Unterschieden im Denkverhalten der deutschen und der asiatischen Kultur im Rahmen dieser Textteile sollen diese Beson-derheiten im zweiten und letzten Bearbeitungsabschnitt anhand eines Beispiels dargelegt werden. Die besondere Intensität des folgenden Satzes, „Kultur greift tief in die 'Programmierung' eines Menschen ein“[3], wird verstärkt beim Verhalten mehrkultureller Teams am Arbeitsplatz gegenüber Problemen deutlich. Ergo wird die Sammlung von kulturbedingten Unterschieden innerhalb einer deutsch-amerikanischen Unternehmens- kooperation auf dem Gebiet der Elektrotechnik der Ausarbeitung zum Thema “Denk- und Problemlösestile” eine gewisse praxisnahe Anwendung offerieren.
2. Unterschiede im Denk- und Problemlöseverhalten in der deutschen Kultur
In diesem Abschnitt werden nun Denk- und Problemlösestile innerhalb einer – der deutschen – Nation gegenübergestellt. Im Rahmen einer kulturvergleichenden Unter- suchung zum Umgang mit verschiedenen Problemen im vereinigten Deutschland wurde deshalb eine Befragung von ost- und westdeutschen Probanden vorgenommen, wobei eine Kategorienbildung in den Denkansätzen nötig war. Bei statischen Problemen mit interpolativen Charakter erzielten die Ostprobanden ein besseres Ergebnis, weil diese Untersuchungsgruppe ein bestimmtes Ziel mit weniger Problemzerlegungsschritten im Sinne des 'interpolativen Problemlösens' erreicht hat. Diese Art von Problemen zeichnet sich schon per definitionem durch 'Geschlossenheit' aus, da nur der Problemlöser selbst basierend auf seiner Eigeninitiative durch Kombination von Lösungsalternativen den festen Ausgangszustand z. B. durch Vereinfachung eines aufwendigeren Rechenweges mithilfe anderer mathematischer Operationen verlassen wird.[4]
Weniger starr und simplifiziert sind hingegen komplexe und dynamische Probleme, da deren Problemlösungsanforderungen also die Struktur im Sinne einer Vernetztheit von Variablen, der Umfang und die Ausgangslage unklarer sind. Die große Schwierigkeit von komplexen Problemen liegt darin die Informationsvielfalt so zu reduzieren und transparenter zu machen, um mögliche Konsequenzen der Entscheidung im Vorhinein durch genaue Planung abzuwägen und eine langfristige an die Eigendynamik des
komplexen Problems angepasste Entscheidungskontrolle vorzunehmen.[5] Auch die Entscheidung für ein konkretes Ziel gestaltet sich aufgrund der Präsenz multipler und widersprüchlicher Problemlösungen kompliziert.[6] Zur Lösung des komplexen Problems ist ein weites Spektrum analytischer Fähigkeiten nützlich. Kreativität, Flexibilität und Risikobereitschaft aufgrund von Informationsasymmetrien erleichtern sowohl die Antizipation von Auswirkungen als auch die – zeitlich eingeschränkte – Reaktionsfä- higkeit auf unerwartete Entwicklungen. Innerhalb dieser Untersuchungskategorie, bei der auch entscheidungsrelevante und weniger wichtige Faktoren ausfindig gemacht werden müssen, liegen westdeutsche Probanden aufgrund situationsadäquaterem Reak- tionsverhalten vor ostdeutschen Studienteilnehmern. Oft wurde bei letzteren beispiels- weise wegen geringerer Risikobereitschaft eine stärkere Orientierung am Ausgangsplan beobachtet, während Westprobanden das 'Learning by Doing Prinzip' präferieren.[7]
Analog zu Divergenzen im Problemlöseverhalten konnte ebenso ein Unterschied in der Wahrnehmung von Ästhetik und Sprache konstatiert werden. Schließlich konnte beo- bachtet werden, dass Ostprobanden ästhetische Materialien weitaus tiefsinniger, gründlicher und abstrakter in bestimmte Kontexte einordnen, während Westprobanden oberflächlicher und impulsiver mit diesen Objekten umgingen. Dies bestätigt sich auf sprachlicher Ebene, weil Ostprobanden hier zur tiefsinnigeren, dichterisch-philoso- phischeren Erörterung tendieren, während Westprobanden kritisch-feuilletonische also unterhaltende Erklärungen vorziehen. Folglich wurden z. B. Grundschullesebücher in der ehemaligen DDR harmonieorientierter gestaltet, während diese in Westdeutschland konfliktärer und individuell-offenere Themen besitzt haben.[8] Verständlicher wird dieser Unterschied bei Kenntnis von Werten und Weltbildern in beiden deutschen Staaten. Während Werte wie Frieden, Umweltschutz und Gerechtigkeit sowohl bei west- als auch bei ostdeutschen Jugendlichen Priorität haben, existiert eine deutliche individualistisch-kollektivistische Trennlinie. Schließlich streben Westprobanden der Befragung nach stärker nach Selbstverwirklichung, während den Ostprobanden Sicher- heit im Bereich der Familie und der Arbeit wichtiger war. Trotz der Tatsache, dass diese Wertvorstellungen nicht allgemeingültig und absolut auf Problemlösestile übertragbar
[...]
[l] <http://www.psychologie.uni-heidelberg.de/ae/allg/enzykl_denken/Enz_ll_Kultur.pdf> am 29.6.2008,
S. 6.
[2] Vgl. ebd., S. 20.
[3] Vgl. Schroll-Machl, Sylvia, Kulturbedingte Unterschiede im Problemlöseprozess, in: Organisationsentwicklung, S. 78.
[4] Vgl. Strohschneider, Stefan, Eine Nation – Zweierlei Denken? Versuch einer Zusammenfassung und Integration der Ergebnisse, in: Strohschneider, Stefan (Hrsg.): Denken in Deutschland: Vergleichende Untersuchungen in Ost und West, l. Aufl., Bern l996, S. l75-l76.
[5] Vgl. Strohschneider, Stefan, Eine Nation – Zweierlei Denken? Versuch einer Zusammenfassung und Integration der Ergebnisse, in: Strohschneider, Stefan (Hrsg.): Denken in Deutschland: Vergleichende Untersuchungen in Ost und West, l. Aufl., Bern l996, S. l77.
[6] Vgl. <http://www.psychologie.uni-heidelberg.de/ae/allg/enzykl_denken/Enz_07_Funke_KPLl.pdf> am 29.6.2008, S. 5.
[7] Vgl. Strohschneider, Stefan, Eine Nation – Zweierlei Denken? Versuch einer Zusammenfassung und Integration der Ergebnisse, in: Strohschneider, Stefan (Hrsg.): Denken in Deutschland: Vergleichende Untersuchungen in Ost und West, l. Aufl., Bern l996, S. l78-l79.
[8] Vgl. ebd., S. l79-l80.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hat Kultur auf das Denken und Problemlösen?
Kultur fungiert als eine Art „Programmierung“, die Denkstile prägt und Routinen schafft, um die Unbestimmtheit des Alltags zu reduzieren und das Gehirn zu entlasten.
Was ist der Unterschied zwischen deduktivem und induktivem Denken?
Die Arbeit unterscheidet zwischen dem deduktiv-analytischen Stil (oft westlich geprägt) und dem induktiv-essayistischen Stil, der in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Ausprägungen findet.
Wie unterscheiden sich ost- und westdeutsche Problemlösestile?
Studien zeigen Unterschiede: Ostdeutsche Probanden waren oft bei statischen Problemen effizienter, während westdeutsche Probanden bei komplexen, dynamischen Problemen eher zum „Learning by Doing“ neigten.
Was zeichnet asiatische Denkstile aus?
Asiatisches Denken wird oft als ganzheitlicher und kontextbezogener beschrieben, im Gegensatz zur eher linearen und zergliedernden Logik westlicher Kulturen.
Warum entstehen in interkulturellen Teams oft Konflikte?
Konflikte entstehen häufig durch unterschiedliche Erwartungen an Planung, Risikobereitschaft und Kommunikation, die tief in der jeweiligen kulturellen Prägung verwurzelt sind.
- Quote paper
- M.A. Susann Grune (Author), 2007, Kulturanthropologie: Denk- und Problemlösestile, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210654