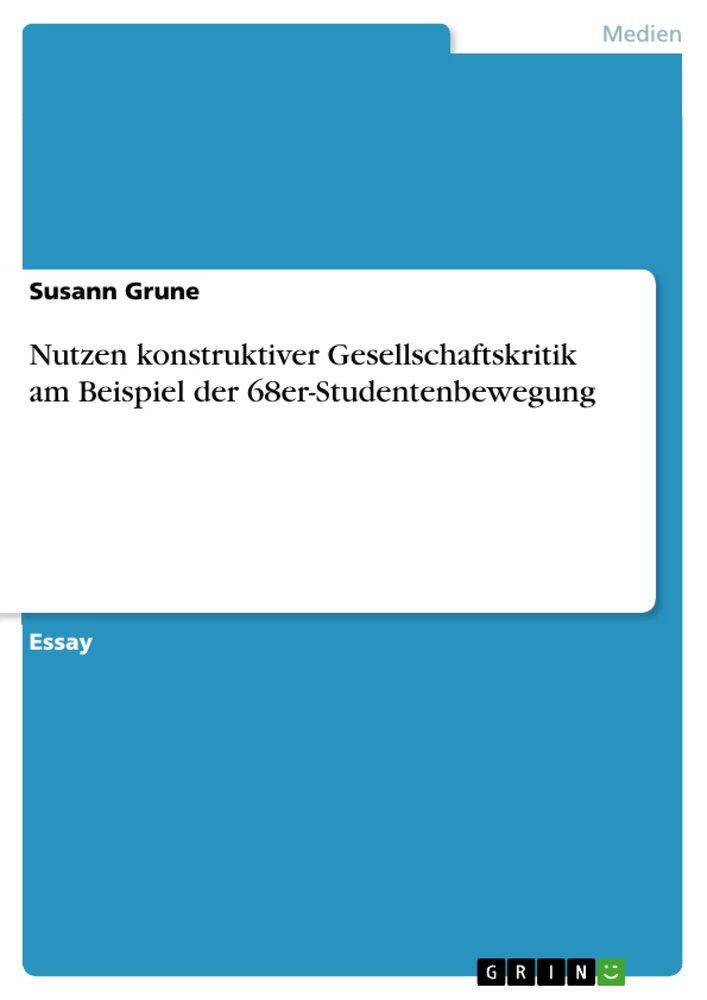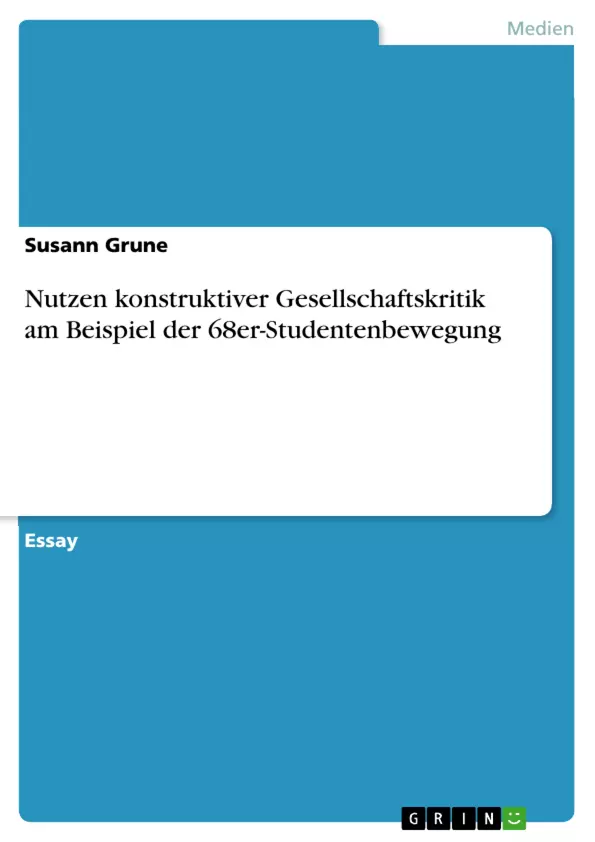Als Hinführung und thematische Vorüberlegung dient mir folgende provokante These: Eine Gesellschaft zeichnet sich durch ihr Facettenreichtum aus und ein (freier) Mensch, der Passivität1 und Gleichgültikeit als seine Lebensphilosophie ansieht, kann keinen relevanten Beitrag zu deren Entwicklung leisten. Kurzum wäre eine solche Gemeinschaft nicht erstrebenswert und sollte zugunsten einer diskussionsfähigen, kritischen und meinungspluralistischen Gesellschaftsform auf ihre nahezu „leblose“ Existenz verzichten. Im ersten Teil der Ausarbeitung soll der Zugang zur Thematik durch die inhaltliche und verkürzte Auseinandersetzung mit den Denkmodellen der 68er-Bewegung gelegt werden. Danach soll ein zweiter Komplex, der aus zwei Abschnitten besteht, erklären, inwiefern Kritik von Studenten bei bestimmten Themen verübt wurde und wie diese der Gesellschaft nützt. Schlussendlich wird dann Rückbezug auf meine streitbare These genommen.
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Institut für Interkulturelle Wirtschaftskommunikation Online Seminar Kulturgeschichte Deutschlands, WS 2007/08
Verfasser: Susann Grune Datum: 23. 11.2007
Aufgabe: Fassen Sie den Credit Denkmodelle der 68er-Bewegung von Wolfgang Kraushaar zusammen.
Quelle: Kraushaar, Wolfgang, Denkmodelle der 68er-Bewegung, in: APuZ (2001), B 22-23, S. 14-27.
Nutzen konstruktiver Gesellschaftskritik am Beispiel der 68er-Studentenbewegung
Als Hinführung und thematische Vorüberlegung dient mir folgende provokante These: Eine Gesellschaft zeichnet sich durch ihr Facettenreichtum aus und ein (freier) Mensch, der Passivität[1] und Gleichgültikeit als seine Lebensphilosophie ansieht, kann keinen relevanten Beitrag zu deren Entwicklung leisten. Kurzum wäre eine solche Gemeinschaft nicht erstrebenswert und sollte zugunsten einer diskussionsfähigen, kritischen und meinungspluralistischen Gesellschaftsform auf ihre nahezu „leblose“ Existenz verzichten. Im ersten Teil der Ausarbeitung soll der Zugang zur Thematik durch die inhaltliche und verkürzte Auseinandersetzung mit den Denkmodellen der 68er-Bewegung gelegt werden. Danach soll ein zweiter Komplex, der aus zwei Abschnitten besteht, erklären, inwiefern Kritik von Studenten bei bestimmten Themen verübt wurde und wie diese der Gesellschaft nützt. Schlussendlich wird dann Rückbezug auf meine streitbare These genommen.
Der Charakter und das Verstehen der deutschen Studentenbewegung lässt sich weder auf feste theoretische Inhalte noch auf eine widerspruchsfreie, praktische Stoßrichtung der angehörigen Gruppen festlegen, da die Beweggründe der dafür eingetretenen Akteure zu komplex sind. Folglich lag das wohl wichtigste Charakteristikum der Bewegung gerade darin, sich eben nicht auf eine bestimmte Theorie oder eine Idee, geschweige denn auf ein absolutes Selbstverständnis festzulegen. Trotzdem ist es wichtig eine Konkretisierung über gesellschaftsverändernde Impulse, die von der 68er-Bewegung ausgingen, nicht zuletzt für die heutige Öffentlichkeit vorzunehmen. Unberührt davon, wie stark die Heterogenität im Denken damaliger Gruppen war, hatten sie doch eins gemein: Ihr Zusammenhalt begründete sich in allgemeiner und oft destruktiver Kritik bestehender Traditionen.[2] Abgeleitet davon lassen sich drei „Metakritiken“ nämlich der Antifaschismus wegen mangelnder Beschäftigung mit der Nationalsozialistischen Zeit, der Antikapitalismus, der eine sozialgerechte Wirtschaftsordnung einfordert und der Antiimperialismus, der sich gegen die Unterdrückung dritter Weltländer richtet, identifizieren.[3] Nicht zuletzt deswegen, weil so gennante „konkrete Utopien“ damals ausblieben und sich auf bereits bekannte – meist marxistisch geprägte – Theorien berufen wurde, wird diese Zeit auch als „Zeit der Wiederentdeckungen“ beschrieben.[4]
In diesem Abschnitt soll der Nutzen von Kritik für eine Gesellschaft – also das entgegengesetzte zur Apathie eines Menschen gegenüber der Gesellschaft – am Beispiel der Studentenbewegung diskutiert werden. Wie sah nun damals die studentische Kritik aus?
Der erste wichtige Einschnitt ist, dass es damals eine längere Entstehungszeit (1961-1967) gab. Nachdem sich der Sozialistische Deutsche Studentenbund 1961 von der „Mutterpartei“ Sozialistische Partei Deutschlands (SPD) autonomisierte, konnten sie sich auf ein neues Programm – Neue Linke genannt – spezialisieren. Darauf folgte die Kritik an der Massenuniversität, wobei sich diese Kritik hauptsächlich gegen ungleiche Bildungschancen, fehlende universitäre Autonomie und damit verbunden die Vermittlung eines staatlich „gelenkten“ Wissens richtete.[5] Studentische Hochschulkritik gegen Ausbildungsdefizite selbst ist nichts verwunderliches, aber bemerkenswert ist, dass sich ein Zusammenhang zwischen Hochschulreform und Demokratisierung abzeichnet. In einer durchgeführten Studie mit dem Titel „Student und Politik“ wurde damals herausgefunden, dass sich 66% der Studenten nicht für Politik interessieren. Problematisch ist dabei, dass die Studie damals meist nur ökonomisch besser gestellte Studenten befragte. Aus der ökonomischen Ungleichbehandlung, weil bspw. kaum Arbeiterkinder studierten, resultiert folglich auch eine politische, da ihnen politische Partizipation meist verwehrt bleibt. Diese Einschränkung bewirkt ebenso wie Verstöße gegen die Pressefreihiet (z. B. „Spiegel“-Affäre) eine defekte Öffentlichkeit, wodurch eine „Instanz der demokratsiche[n] Kontrolle gegenüber der politischen Herrschaft“[6] wegfällt. In dieser Weise sah die Studentenbewegung eine Reziprozität von Öffentlichkeit und Demokratie, weil die Demokratie nicht ohne eine funktionierende Öffentlichkeit auskommt, und versuchte mehr öffentliche Macht zu erlangen und zu bewahren.[7] Demzufolge war die Kritik in diesen zwei Bereichen von großem Nutzen, da erstens Zusammenhänge aufgezeigt und hinterfragt wurden und andererseits der Mensch die Möglichkeit hatte, sich aktiv in die Diskussion einzumischen und neue Problemlösungsstrategien zu entwickeln. Ebenso nützlich und an dieser Stelle erwähnenswert waren die kritischen Ideen der 68er-Bewegung in Bezug auf mangelnde Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, weil gerade die in meiner provokanten These aufgeworfene Apathie des Menschen in diesem Sachverhalt verheerende Konsequenzen nach sie zieht. Ebenso wenig wie es sich nicht sagen lässt, ob derartige menschenverachtende Verbrechen mit der kritischen Grundeinstellung der 68er-Bewegung – also vehemente Kritik bestehender Konventionen und Traditionen – verhindert worden wären, verhält es sich mit gegenteiligen Behauptung.
Der zweite wichtige Einschnitt ähnelt einer Kehrtwende, weil nicht mehr eine wie bereits gezeigte schrittweise Entwicklung festzustellen ist, sondern ein Ausbruch. Nachdem der demonstrierende Student Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 tödlich getroffen wurde, breitete sich eine radikalsierte Revolte von Westberlin über ganz Westdeutland aus.[8] Das hatte zur Folge, dass bereits geäußerter Widerspruch, wenn auch in milderer Weise, in offenen Protest gegen den sich abzeichnenden Polizeistaat und gegen die zweifelhafte Qualität der parlamentarischen Demokratie überhaupt umschlug. Desweiteren konkretisierte die so genannte „Parlamentarismuskritik“ schon vorher erkennbare Tendenzen, wonach das Parlament allmählich seine Kontrollfunktion einbüßt, weil wichtige Entscheidungen außerhalb der Volksvertretung – dem Bundestag – gefällt werden. Die sinkende demokratische Qualität des Parlaments 'erzwingt' folglich eine außerparlamentarische Opposition mit radikaldemokratischen Zügen wie den Sozialistischen Deutschen Studentenbund. Außerdem schließt dieser das Nebeneinander von 'wahren' Kapitalismus und 'absoluter' Demokratie faktisch aus, weil sich wegen kapitalistischen Produktionskonditionen immer nur die Lobby der Kapitalisten durchsetzen würde.[9] Im Gegensatz zur
[...]
[1]Vgl. dazu die antike Lebenseinstellung der Vita Contemplativa, was die Selbstversenkung des Menschen (bspw. Sene-ca) in Philosophie und Kunst meint und öffentliche Teilhabe z. B. durch Ämterverzicht vermeidet.
[2]Vgl. Kraushaar, Wolfgang, Denkmodelle der 68er-Bewegung, in: APuZ (2001), B 22-23, S. 14-15. Hinterfragt wurden sog. Sekundärtugenden wie Glauben, Weltanschauung, Wissenschaft und Staatsbürgerpflicht.
[3]Vgl. ebd., S. 15-16. Trotz linker Vergangenheit des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) wurde der Sowjetkommunismus nicht kritisiert, weil anstelle der generellen Ablehnung einer diktatorischen Herrschaftsform (Stalinismus) die Ablehnung des Faschismus trat, wodurch es nicht mehr wichtig war antikommunistisch zu wirken. Desweiteren beschäftigte sich die antifaschistische Denkart der Studentenbewegung nicht speziell mit dem deutschen, historischen Nationalsozialismus, wodurch trotz Kritik keine Auseinandersetzung mit der Judenvernichtung einsetzte.
[4]Vgl. ebd., S. 15. Viele 68er Ideen waren deswegen nicht explizit, weil Rudi Dutschke u.a. keine konkreten Alternati-ven bspw. zum Kapitalismus formulierten. Unsicher war die Art der Gesellschaftsveränderung und nicht das diese überhaupt stattfinden muss.
[5]Vgl. ebd., S. 16-18. Ebenso sieht Habermas in „außerparlamentarischen Aktionen“ die Chance für Politikbeteilgung.
[6]Ebd., S. 17.
[7]Vgl. ebd., S. 18.
[8]Vgl. ebd., S. 20.
[9]Vgl. Kraushaar, Wolfgang, Denkmodelle der 68er-Bewegung, in: APuZ (2001), B 22-23, S. 20-21. Die Schwäche des
Häufig gestellte Fragen
Was war der Nutzen der studentischen Kritik der 68er-Bewegung?
Die Kritik deckte gesellschaftliche Missstände auf, förderte die Demokratisierung der Hochschulen und zwang die Gesellschaft zur Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit.
Welche drei „Metakritiken“ kennzeichneten die 68er-Bewegung?
Die Bewegung war geprägt durch Antifaschismus, Antikapitalismus und Antiimperialismus.
Was bedeutete die „Spiegel-Affäre“ für die Studentenbewegung?
Sie wurde als Verstoß gegen die Pressefreiheit und als Zeichen einer „defekten Öffentlichkeit“ wahrgenommen, was den Ruf nach demokratischer Kontrolle verstärkte.
Warum radikalisierte sich die Revolte im Jahr 1967?
Der gewaltsame Tod des Studenten Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 führte zu einem landesweiten Ausbruch von Protesten gegen den empfundenen „Polizeistaat“.
Was kritisierte der SDS an der Massenuniversität?
Der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) kritisierte ungleiche Bildungschancen, mangelnde universitäre Autonomie und die Vermittlung von staatlich gelenktem Wissen.
- Quote paper
- M.A. Susann Grune (Author), 2007, Nutzen konstruktiver Gesellschaftskritik am Beispiel der 68er-Studentenbewegung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210656