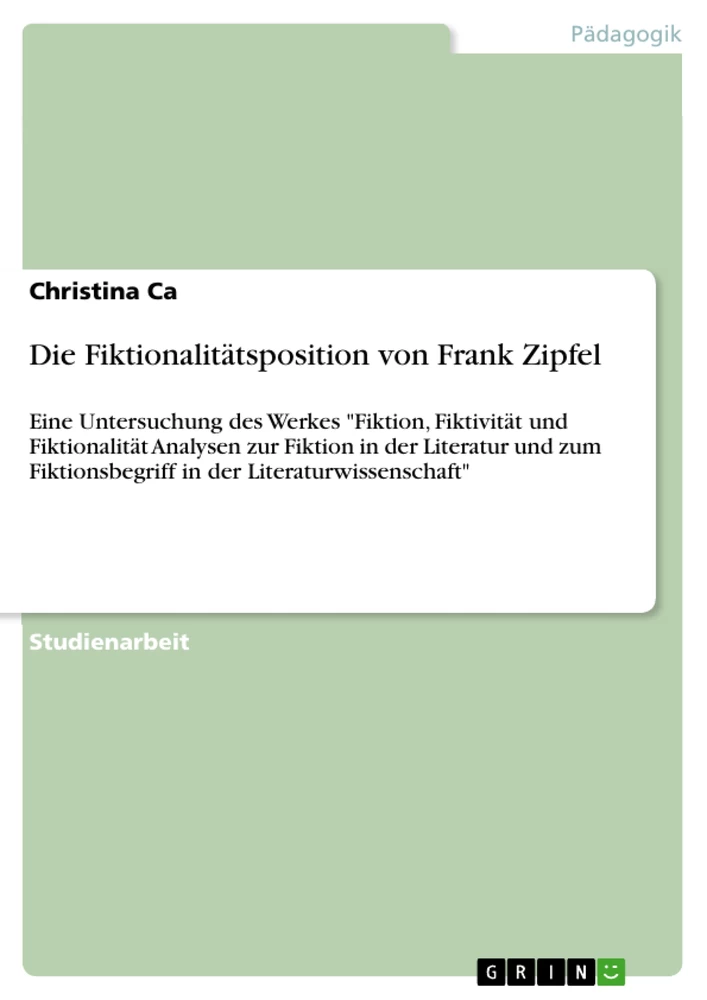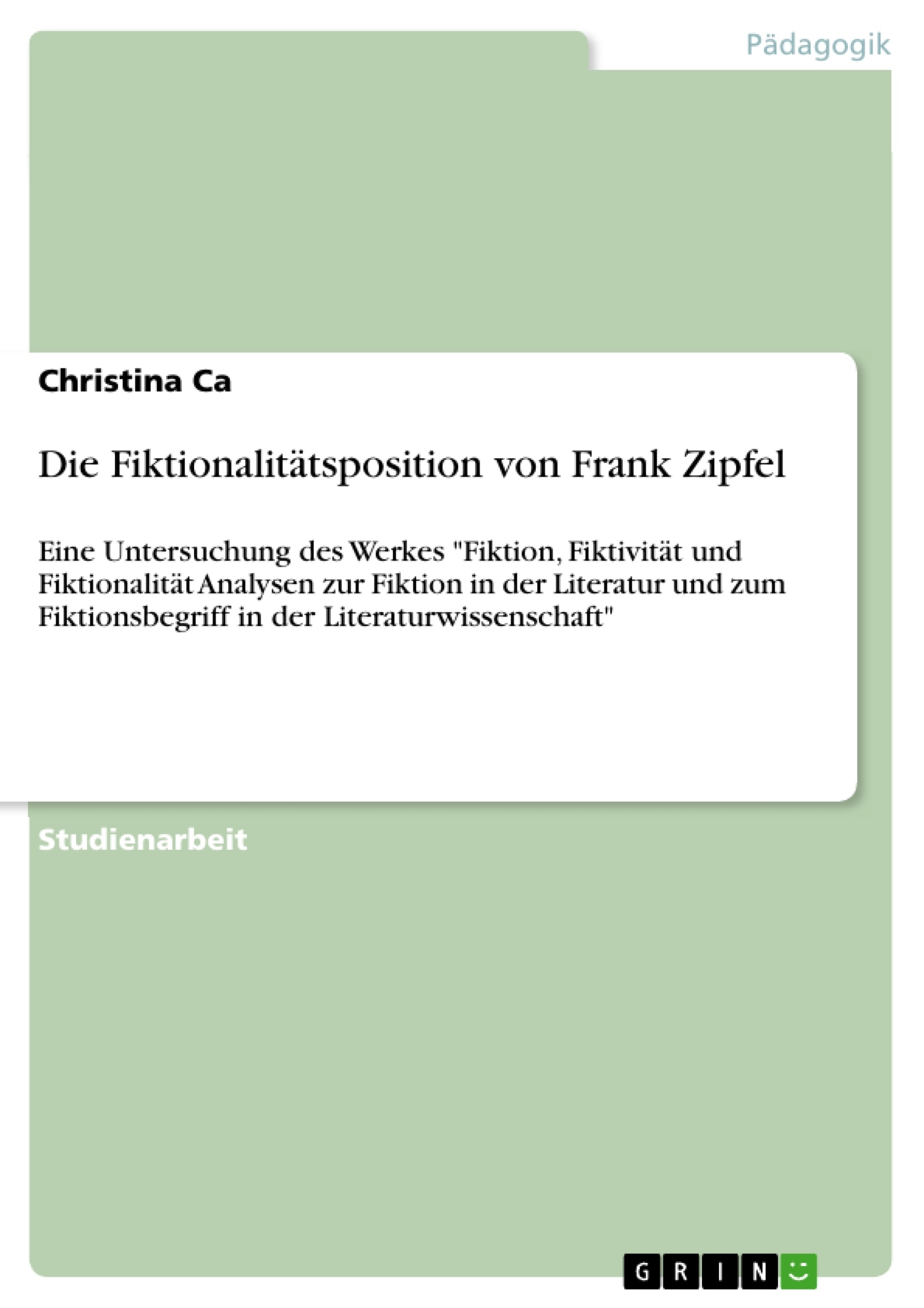Die hier vorliegende wissenschaftliche Arbeit zum Seminar Fiktionalität befasst sich primär
mit der Fiktionsbestimmung von Frank Zipfel in seinem Buch Fiktion, Fiktivität und
Fiktionalität. Analysen zur Fiktion in der Literatur und zum Fiktionsbegriff in der
Literaturwissenschaft (2001). Gegenstand dieser Arbeit ist die Tatsache, dass die
Erklärungsansätze zu Fiktion äußerst heterogen sind und durch die zahlreichen Theorien, die
unverbunden nebeneinander stehen, immer weniger klar ist, was mit Fiktion in Bezug auf
Literatur gemeint ist. Die Leitfrage dieser Arbeit ist, ob Frank Zipfel es schafft die Maße an
Bestimmungen zu einer umfassenden Fiktionstheorie zu integrieren und Aufschluss darüber
zu bringen, ob alle Literatur Fiktion ist oder die beiden Phänomene grundsätzlich unabhängig
voneinander sind. Ziel dieser Arbeit ist es aufzuzeigen, wie Zipfel mittels der doppelten
Sprachhandlungssituation von innen nach außen zu seiner Fiktionsbestimmung gelangt, denn
die Verdopplung der Sprachhandlungssituation vereint alle wichtigen Komponenten zur
Fiktion und stellt somit den zentralsten Punkt dieser Arbeit dar.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlage für Zipfels Fiktionalitätsposition
- 3. Heterogenität der Begriffsbestimmung
- 4. Literarische Fiktion als ästhetische und sprachliche Fiktion
- 4.1 Literarische Fiktion als ästhetische Fiktion
- 4.2 Literarische Fiktion als sprachliche Fiktion
- 5. Fiktion im Zusammenhang der Geschichte (Fiktivität)
- 5.1 Drei Faktoren: Ereignisträger, Ort und Zeit
- 5.1.1 Möglichkeit und Nicht-Möglichkeit fiktiver Geschichten
- 5.2 Fiktive und nicht-fiktive Elemente
- 5.2.1 reale, nicht-reale und pseudo-reale Objekte
- 5.3 Realistik und Phantastik
- 5.1 Drei Faktoren: Ereignisträger, Ort und Zeit
- 6. Fiktionalität und Erzählen
- 6.1 Das Modell der doppelten Sprachhandlungssituation
- 6.2 Fiktionale homodiegetische Erzähl-Texte
- 6.3 Fiktionale heterodiegetische Erzähl-Texte
- 6.4 Verhältnis Fiktivität und Fiktionalität
- 7. Fiktion im Zusammenhang der Textproduktion
- 7.1 Das make-believe Konzept
- 8. Fiktion im Zusammenhang der Textrezeption
- 8.1 Fiktionssignale
- 8.1.1 Textuelle Fiktionssignale
- 8.1.2 Paratextuelle Fiktionssignale
- 8.2 Rezeptionsverhalten gegenüber fiktionalen Texten
- 8.2.1 Emotionale Reaktionen
- 8.3 Exemplifikation
- 8.1 Fiktionssignale
- 9. Fiktion im Zusammenhang der Sprachhandlungssituation
- 9.1 Soziale Praxis Fiktion
- 9.1.1 Fiktionsvertrag
- 9.1 Soziale Praxis Fiktion
- 10. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Frank Zipfels Fiktionstheorie, insbesondere seine Konzepte von Fiktion, Fiktivität und Fiktionalität. Sie beleuchtet die Heterogenität bestehender Fiktionsbestimmungen und analysiert, ob Zipfels Ansatz eine umfassende Theorie bietet, die die verschiedenen Ansätze integriert und klärt, ob alle Literatur als Fiktion betrachtet werden kann. Das zentrale Element der Analyse ist Zipfels Modell der doppelten Sprachhandlungssituation.
- Heterogenität der Fiktionsbestimmungen in der Literaturwissenschaft
- Zipfels Modell der doppelten Sprachhandlungssituation
- Der Zusammenhang zwischen Fiktion, Fiktivität und Fiktionalität
- Die Rolle von ästhetischen und sprachlichen Aspekten in der literarischen Fiktion
- Fiktionssignale in der Textrezeption
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach der Integration verschiedener Fiktionsansätze in Zipfels Theorie und die Frage nach dem Verhältnis von Literatur und Fiktion. Sie benennt das Ziel, Zipfels Weg zu seiner Fiktionsbestimmung anhand des Modells der doppelten Sprachhandlungssituation aufzuzeigen.
2. Grundlage für Zipfels Fiktionalitätsposition: Dieses Kapitel beleuchtet die Heterogenität und Uneinheitlichkeit der Fiktionsbestimmungen im 20. Jahrhundert. Es zeigt auf, wie die Ausweitung des Begriffs "Fiktion" zu Unklarheiten geführt hat und wie unterschiedlich die Konzepte von Fiktion innerhalb der Literaturwissenschaft sind. Die Uneinheitlichkeit der Begriffe Fiktion, fiktiv, fiktional und Fiktionalität wird hervorgehoben.
3. Heterogenität der Begriffsbestimmung: Kapitel 3 vertieft die in Kapitel 2 eingeführte Heterogenität der Fiktionsbestimmungen. Es werden unterschiedliche Interpretationsansätze vorgestellt, die versuchen, die zentrale Bedeutung der "Nicht-Wirklichkeit" in Fiktion zu umgehen. Die unterschiedlichen Bedeutungen der Adjektive "fiktiv" und "fiktional" werden thematisiert.
4. Literarische Fiktion als ästhetische und sprachliche Fiktion: Kapitel 4 erläutert, dass Zipfels Fiktionsbeschreibungen sich auf ästhetisch-sprachliche Phänomene und narrative Texte beziehen. Es wird dargelegt, warum Zipfel den Fiktionsbegriff ausschließlich auf Literatur beziehen möchte und welche Merkmale auf eine literarische Fiktion hinweisen.
5. Fiktion im Zusammenhang der Geschichte (Fiktivität): Dieses Kapitel erklärt den Begriff der Fiktivität auf der narrativen Ebene, wobei die drei Faktoren Ereignisträger, Ort und Zeit im Mittelpunkt stehen. Es wird verdeutlicht, dass fiktive Geschichten sowohl fiktive als auch nicht-fiktive Elemente enthalten können (reale, nicht-reale und pseudo-reale Objekte).
6. Fiktionalität und Erzählen: Kapitel 6 behandelt die Fiktionalität auf der Ebene der Erzählung. Die Unterscheidung zwischen Autor und Erzähler sowie Erzählen und Erzähltem und die Entstehung der doppelten Sprachhandlungssituation werden erläutert. Die Bedeutung von Homodiegese, Heterodiegese und interner Fokalisierung wird hervorgehoben.
7. Fiktion im Zusammenhang der Textproduktion: Dieses Kapitel analysiert das Verhältnis von realem Autor und realem Leser zu fiktionalen Texten im Kontext der doppelten Sprachhandlungssituation. Das "make-believe-Konzept" als Beschreibung des Verhältnisses von Autor, fiktionalem Erzähltext und Leser spielt eine zentrale Rolle.
8. Fiktion im Zusammenhang der Textrezeption: Kapitel 8 fokussiert auf die Textrezeption und baut auf der doppelten Sprachhandlungssituation auf. Es werden Fiktionssignale vorgestellt, anhand derer Rezipienten Fiktion in Erzähltexten erkennen können. Emotionale Reaktionen der Rezipienten werden ebenfalls thematisiert.
9. Fiktion im Zusammenhang der Sprachhandlungssituation: Das Kapitel betrachtet die gesamte externe Sprachhandlungssituation und die kulturelle Praxis von Fiktion als notwendige Bedingung für die Produktion und Rezeption fiktionaler Erzähltexte. Der Fiktionsvertrag spielt hier eine wichtige Rolle.
Schlüsselwörter
Fiktion, Fiktivität, Fiktionalität, Frank Zipfel, Literaturwissenschaft, doppelte Sprachhandlungssituation, ästhetische Fiktion, sprachliche Fiktion, narrative Texte, Textproduktion, Textrezeption, Fiktionssignale, make-believe Konzept, Realität, Nicht-Wirklichkeit.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von Frank Zipfels Fiktionstheorie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Frank Zipfels Fiktionstheorie, insbesondere seine Konzepte von Fiktion, Fiktivität und Fiktionalität. Sie untersucht die Heterogenität bestehender Fiktionsbestimmungen und analysiert, ob Zipfels Ansatz eine umfassende Theorie bietet, die verschiedene Ansätze integriert. Ein zentrales Element ist Zipfels Modell der doppelten Sprachhandlungssituation.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht, ob alle Literatur als Fiktion betrachtet werden kann und zeigt Zipfels Weg zu seiner Fiktionsbestimmung anhand des Modells der doppelten Sprachhandlungssituation auf.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die wichtigsten Themen sind die Heterogenität der Fiktionsbestimmungen in der Literaturwissenschaft, Zipfels Modell der doppelten Sprachhandlungssituation, der Zusammenhang zwischen Fiktion, Fiktivität und Fiktionalität, die Rolle von ästhetischen und sprachlichen Aspekten in der literarischen Fiktion und Fiktionssignale in der Textrezeption.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in zehn Kapitel: Einleitung, Grundlagen von Zipfels Position, Heterogenität der Begriffsbestimmung, Literarische Fiktion als ästhetische und sprachliche Fiktion, Fiktion im Zusammenhang der Geschichte (Fiktivität), Fiktionalität und Erzählen, Fiktion im Zusammenhang der Textproduktion, Fiktion im Zusammenhang der Textrezeption, Fiktion im Zusammenhang der Sprachhandlungssituation und Fazit.
Was wird in Kapitel 2 behandelt?
Kapitel 2 beleuchtet die Heterogenität und Uneinheitlichkeit der Fiktionsbestimmungen im 20. Jahrhundert. Es zeigt die Ausweitung des Begriffs "Fiktion" und die unterschiedlichen Konzepte innerhalb der Literaturwissenschaft auf. Die Uneinheitlichkeit der Begriffe Fiktion, fiktiv, fiktional und Fiktionalität wird hervorgehoben.
Was ist das zentrale Element der Analyse?
Das zentrale Element der Analyse ist Zipfels Modell der doppelten Sprachhandlungssituation.
Was wird in Kapitel 4 erläutert?
Kapitel 4 erläutert, dass Zipfels Fiktionsbeschreibungen sich auf ästhetisch-sprachliche Phänomene und narrative Texte beziehen. Es wird dargelegt, warum Zipfel den Fiktionsbegriff ausschließlich auf Literatur beziehen möchte und welche Merkmale auf eine literarische Fiktion hinweisen.
Was wird in Kapitel 6 behandelt?
Kapitel 6 behandelt die Fiktionalität auf der Ebene der Erzählung. Die Unterscheidung zwischen Autor und Erzähler sowie Erzählen und Erzähltem und die Entstehung der doppelten Sprachhandlungssituation werden erläutert. Die Bedeutung von Homodiegese, Heterodiegese und interner Fokalisierung wird hervorgehoben.
Welche Rolle spielt das "make-believe-Konzept"?
Das "make-believe-Konzept" spielt im Kapitel 7 eine zentrale Rolle als Beschreibung des Verhältnisses von Autor, fiktionalem Erzähltext und Leser im Kontext der doppelten Sprachhandlungssituation.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind Fiktion, Fiktivität, Fiktionalität, Frank Zipfel, Literaturwissenschaft, doppelte Sprachhandlungssituation, ästhetische Fiktion, sprachliche Fiktion, narrative Texte, Textproduktion, Textrezeption, Fiktionssignale, make-believe Konzept, Realität, Nicht-Wirklichkeit.
- Citar trabajo
- Christina Ca (Autor), 2011, Die Fiktionalitätsposition von Frank Zipfel, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210662