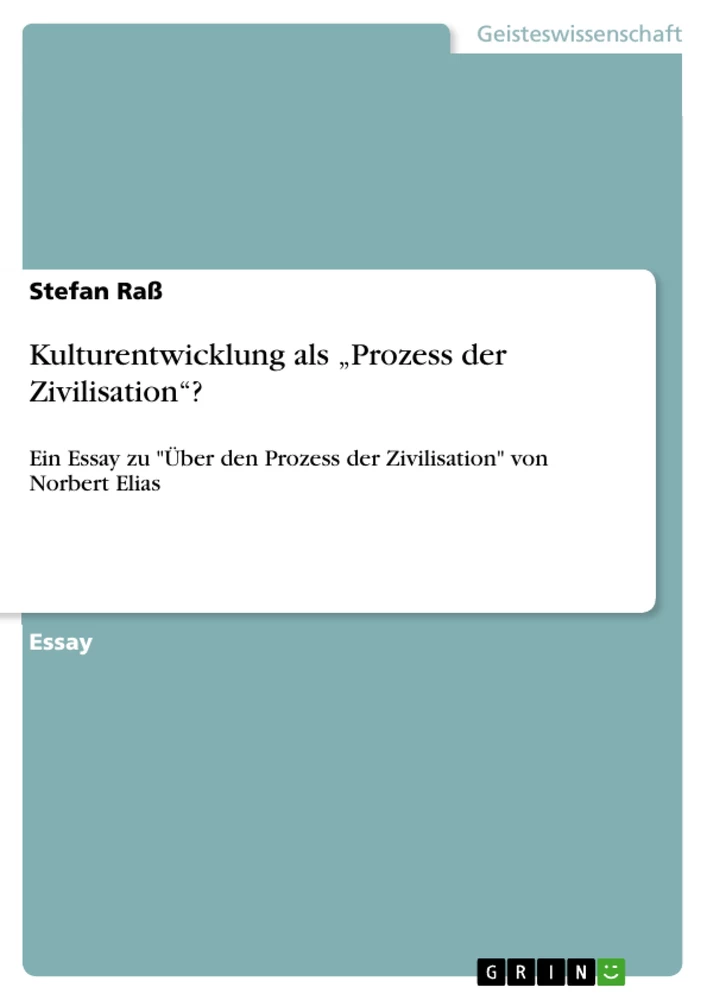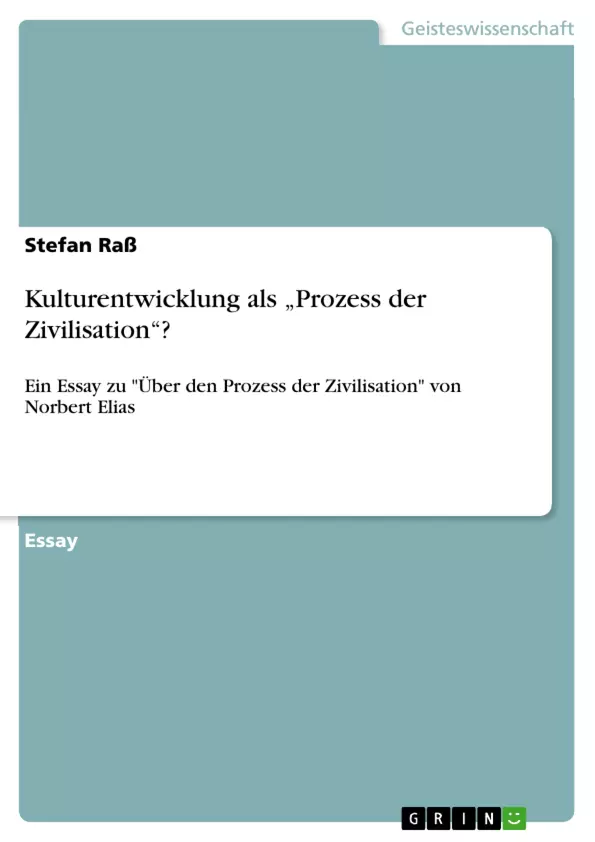Der Soziologe Norbert Elias setzt sich in seinem Werk „Über Prozesse der Zivilisation – Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen“ mit Verhaltensweisen der abendländischen Kultur und dem langfristigen Wandel ihrer Persönlichkeitsstruktur auseinander. Sein Werk ist in zwei Bände gegliedert. Der erste Teil beschäftigt sich mit den „Wandlungen des Verhaltens in den weltlichen Oberschichten des Abendlandes“, der zweite Band mit dem „Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation“.
Kulturentwicklung als „Prozess der Zivilisation“?
Elias (1997a): 75-85 & 157-181 und Elias (1997b): 9-22 & 323-347
Der Soziologe Norbert Elias setzt sich in seinem Werk „Über Prozesse der Zivilisation – Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen“ mit Verhaltensweisen der abendländischen Kultur und dem langfristigen Wandel ihrer Persönlichkeitsstruktur auseinander. Sein Werk ist in zwei Bände gegliedert. Der erste Teil beschäftigt sich mit den „Wandlungen des Verhaltens in den weltlichen Oberschichten des Abendlandes“, der zweite Band mit dem „Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation“.
Die Grundannahme von „Über Prozesse der Zivilisation“ ist, dass sich die Menschen und ihre Kultur im westlichen Europa, im Laufe der Geschichte wesentlich verändert haben. Diesen Wandel gilt es zu untersuchen, um eine Theorie zur Zivilisation zu formulieren. „Wie ging eigentlich diese Veränderung, diese „Zivilisation“ im Abendland vor sich? Worin bestand sie? Und welches waren ihre Antriebe, ihre Ursachen oder Motoren?"( Elias, 1997a, S.76) sind die Kernfragen, auf die eine Antwort gesucht wird.
Elias beschäftigt sich in seinem ersten Band zunächst mit der Geschichte des Begriffs „Civilité“ (Höflichkeit). Dieser stammt aus dem zweiten Viertel des 16. Jahrhunderts, als „die Rittersgesellschaft und die Einheit der katholischen Kirche zerbrach“ (Elias, 1997a, S.157) und ist Zeichen des Wechsels der Gemeinschaftssprache, vom Italienischen zum Französischen. Die höfische Gesellschaft, die laut Elias, das Rückgrat der Gesellschaft bildet, definiert sich in ihrem Selbstverständnis und Charakter durch diesen Begriff.
Eine besondere Stellung in der Etablierung des Begriffs, weißt Elias dem Buch „De civilitate morum puerilium“ von Erasmus zu. Dies handelt von „dem Benehmen des Menschen in der Gesellschaft“ (Elias, 1997a, S.160) und insbesondere dessen körperlichen Auftreten und seiner Haltung. Mithilfe dieses Buches wagt Elias einen Blick ins 15. Jahrhundert und leitet daraus Gebräuche und Sitten der Zeit ab. Erasmus zeichnet das Bild einer Gesellschaft „mit Verhaltensformen, die uns in manchem verwandt, in vielem fern sind.“ (Elias, 1997a, S.162) Beispielsweise wurden Gabeln nur sehr sporadisch benutzt und das Besteck wurde geteilt. Es wird sehr offen über „alle Bezirke des menschlichen Verhaltens“ (Elias, 1997a, S.165) geschrieben, was heute auf Grund eines anderen Peinlichkeitsstandards nur noch eingeschränkt möglich ist.
Um den Begriff der Zivilisation zu verstehen, muss man zu seinen Wurzeln der „civilité“ blicken. Erst dann wird die Verhaltensveränderung, die sich im Abendland vollzogen hat, deutlich, die Elias mit dem „ Zivilisationsprozess “ (Elias, 1997a, S.165) betitelt.
Dies wirft die Frage auf, wie wir von diesem, auf der einen Seite „unzivilisierten“ Standard, zu einem auf der anderen Seite „zivilisiertem“ Standard gelangt sind. Elias kommt zu dem Schluss, dass es sich hierbei nicht um einen Gegensatz, wie bei gut und schlecht handelt, sondern um eine „Entwicklungsreihe [zu tun], überdies eine[r] Entwicklungsreihe, die weitergeht“. (Elias, 1997a, S.166) Zivilisation ist also ein Prozess, der aufeinander aufbaut, immer noch andauert und an dem wir alle teilnehmen.
Des Weiteren untersucht Elias die mittelalterlichen Umgangsformen näher. Dabei stellt sich die Problematik, dass es nicht möglich ist, „unbegrenzt in einen [den] anfanglosen Prozess hineinzusteigen “. (Elias, 1997a, S. 167) Mit Fragen über eine bestimmte Art des gesellschaftlichen Verhaltens, beschäftigen sich die Menschen schon weit über das Mittelalter hinaus. Um den Prozess der Zivilisation zu untersuchen, müssen deshalb Grenzen gesetzt werden. Elias entscheidet sich für den mittelalterlichen Standard, um von dort an die „Evolutionskurve zu verfolgen“. (Elias, 1997a, S. 167)
Elias geht hier besonders auf Verhaltensregeln beim Essen ein. Um einprägsamer zu wirken, wurden die Texte oft in Reimform geschrieben, da Bücher zu dieser Zeit selten und teuer waren. Er interessiert sich aber mehr für ein allgemeines Verhaltensmuster im Mittelalter, weist aber darauf hin, dass es durchaus Modifikationen unter den verschiedenen Nationalitäten gibt.
Der Begriff des „guten Benehmens“ weißt viel mehr als heute, auf eine bestimmte gesellschaftliche Schicht hin. Im Deutschen diente hierfür „höfescheit oder hübescheit “ (Elias, 1997a, S.171), was auf die höfische Gesellschaft hinweist.
Durch diesen Terminus grenzt sich die Oberschicht in ihrem Selbstverständnis in Bezug auf ihre Verhaltensweisen und Regeln klar ab. Auch in den Texten wird das „vornehme Verhalten“ immer wieder dem, des gemeinen Bauern gegenübergestellt.
Regel wie „vor dem Essen sollte man die Hände waschen“ (Elias, 1997a, S.173) und „man soll sich nicht ins Tischtuch schnäuzen“ (vgl. Elias, 1997a, S.173), die durchaus an Erwachsene gerichtet waren, sind aber mit heutigen Standards nicht zu vergleichen. Egal ob auf dem Land oder in höheren Schichten gelten diese Vorschriften heute als elementar und werden automatisch von jedem befolgt.
Der „Standard der Esstechnik“ (Elias, 1997a, S.177), auch wenn sie in heutiger Zeit Peinlichkeitsgefühle hervorrufen, ist für Elias „ein sehr charakteristischer Ausschnitt [-] aus dem Ganzen der gesellschaftlich gezüchteten Verhaltensformen“ (Elias, 1997a, S.179) Er entspricht einer ganz bestimmten Gesellschaftsstruktur.
Die Menschen des Mittelalters hatten ein wesentlich anderes, emotionales Verhältnis zum Körper des Anderen. Elias sieht in den heutigen Verhaltensregeln eine „unsichtbare Mauer“ (Elias, 1997a, S. 181), die sich in unserer Gesellschaft zwischen den Körpern von Individuen auftut und in die wir von klein auf konditioniert werden.
Es sind keine naturgegebenen Verhaltensweisen, sondern eine von der Gesellschaft vorgegebene Doktrin, die von Geburt an verinnerlicht wird, sich aber Schritt für Schritt weiterentwickelt.
In der Zeitspanne seit dem frühen Mittelalter hat sich eine „Kultur der Distanz“ entwickelt, besonders bei den Essgewohnheiten. Es wird möglichst vermieden dieselben Instrumente und Behältnisse, ohne dass sie gereinigt wurden, zu verwenden, die ein Gegenüber vorher genutzt hat. Noch vor 500 Jahren war dies eine übliche Gangart zu Tisch.
Den zweiten Band von „Über den Prozess der Zivilisation“ beginnt Elias mit einem Überblick über die höfische Gesellschaft.
Herrschaftskämpfe zwischen Adel, Kirche, Fürsten und dem privilegierten Bürgertum durchziehen alle Gesellschaften des 12. und 13. Jahrhunderts. Nach und nach zeichnet sich aber die „absolute Herrschaft des Einen an der Spitze“ (Elias, 1997b, S.9) ab. Elias spricht hier von einem „Zeitalter des Absolutismus “ (Elias, 1997b, S.10), in dem sich eine Herrschaftsklasse durchsetzte und den Standard für höfischen Sitten und Gebräuche setzte.
Diese Entwicklung hatte ihren Ursprung vor allem in Frankreich, genauer gesagt in Paris. Von dort griffen die mehr oder minder gleichen Umgangsformen, über kurz oder lang, auf alle Höfe Europas über.
Aber warum ist Frankreich der Ursprung dieser Entwicklung? Die Grande Nation war das am „reichsten, mächtigsten und am stärksten zentralisierte Land dieser Zeit “ (Elias, 1997b, S.12) Deshalb waren „gehobenere“ Sitten ihrem eigenen gesellschaftlichen Bedürfnis und Selbstverständnis nur gerecht. Sie wurden benutzt, um die Hierarchie der Gesellschaft sichtbar zu machen.
Andere europäische Höfe übernahmen diese Lebensweise, da sie ebenfalls ihren Bedürfnissen entsprach. „Sie lasen die gleichen Bücher, sie haben den gleichen Geschmack, die gleichen Manieren und […] den gleichen Lebensstil.“ (Elias, 1997b, S.13) Daraus entstand eine umfassende Aristokratie des Abendlandes mit dem Zentrum Paris.
Mit dem Aufstieg der Mittelschicht und im Zuge der französischen Revolution differenzierte sich die höfisch-aristokratische Gesellschaft in den einzelnen Nationalitäten mehr und mehr auseinander. Auch wich das Französische den nationalen Sprachen.
Durch diese Entwicklung lässt sich erklären warum die doch sehr differenzierten, europäischen Nationen eine gemeinsame Kultur besitzen und in ihren Grundfesten eine zusammengehörige, „spezifische Zivilisation“ (Elias, 1997b, S.15) des Abendlandes bilden.
Um die Zivilisation des Verhaltens zu verstehen, ist es notwendig den Absolutismus, die staatenbildende und die daraus resultierende Zentralisierung der Gesellschaft näher zu beleuchten.
Um die Entwicklung der absoluten Herrschaft einer Person bzw. einer sehr kleinen Personen- gruppe zu erklären, verwendet Elias, Frankreich als Beispiel. Durch die steigende Menge an Gold im Umlauf, wurden Gesellschaftsgruppen wie Feudalherren, die ein festes Einkommen beziehen benachteiligt. Der König jedoch, konnte durch Steuern immer einen gewissen Teil des Erwirtschafteten einnehmen und besaß so einen Vorteil gegenüber seiner Rivalen.
Daraus entwickelte sich mit der Zeit die uneingeschränkte Macht und Monopolstellung des Königs, da er schlicht mehr Mittel besaß, um seine Machtansprüche geltend zu machen. Innovationen in der Waffentechnik machten außerdem das Waffenmonopol der Adligen und Ritter zu Nichte, da der einfache Fußsoldat immer mehr an Bedeutung gewann.
Elias kommt zu dem Schluss, dass der „Prozeß [sic!] der Zivilisation eine Veränderung des menschlichen Verhaltens und Empfindens in einer ganz bestimmten Richtung ist“ (Elias, 1997b, S. 323) Auf den ersten Blick lässt diese Gerichtetheit auf einen intentionalen, rationalen Prozess schließen, aber dies ist keineswegs der Fall. Zivilisation ist von keinem Menschen in Gang gesetzt oder erfunden worden; sie basiert nicht auf einer rationalen Idee. Ebenso wenig ist sie ein „regelloses Kommen und Gehen ungeordneter Gestalten“ (Elias, 1997b, S.324), also ein irrationales System.
Vielmehr gleicht der Zivilisationsprozess der darwinistischen Idee einer natürlichen Selektion. Elias spricht hier auch von einem „Konkurrenzdruck gesellschaftlicher Funktionen“. (vgl. Elias, 1997b, S.327) Sie ist nicht von einem bestimmten Individuum gewollt oder in Gang gesetzt worden, genauso wenig ist sie ein loses System ohne Regeln.
Vielmehr ist Zivilisation, genau wie natürliche Selektion, ein fortlaufendes Evolutionsgebilde, das nicht in unserem „Heute“ endet, sondern, angetrieben durch ihre Eigendynamik, immer voran schreitet. Elias betitelt diese ungewollte Komplexität, die sich immer weiter entwickelt, mit dem Begriff der „Verflechtungserscheinungen“. (Elias, 1997b, S.325)
Unsere heutige Gesellschaft verlangt nach einer anderen „Modellierung des psychischen Apparats“ (Elias, 1997b, S. 329), deshalb passen sich auch die Verhaltensregeln in diesem System an.
Das einzelne Individuum muss sich selbst kontrollieren die Konventionen einzuhalten, damit das System stabil bleibt. Elias spricht hier von einer „Selbstzwangapparatur“. (Elias, 1997b, S. 330) Ein Hilfsmittel zur Einhaltung von Verhaltensregeln ist das Gewaltmonopol eines Monopolinstituts, wie dem Staat.
In Gesellschaften, ohne solch ein Regulierungsorgan, ist die „Funktionsteilung relativ gering und die Handlungsketten, die den Einzelnen binden, verhältnismäßig kurz“ (Elias, 1997b, S.332) Ein etabliertes Monopolinstitut geht genau mit dem Gegenteil, größerer Verflechtung, einher. Hier bietet es dem Individuum einen Vorteil seine Triebe und Affekte zu dämpfen. Dies führt zu einer „leidenschaftslosere[n] Selbstbeherrschung“ (Elias, 1997b, S.338), im Gegenzug ist das Leben des Einzelnen erheblich sicherer.
Generationen, die in solch ein System geboren werden, gewöhnen sich meist völlig an den ständigen Druck der Einhaltung bestimmter Regeln, da die „Triebgestaltung von der frühesten Jugend an auf diesen Aufbau der Gesellschaft abgestimmt worden“ (Elias, 1997b, S. 336) ist. Die Umwelt führt hier zu einer erheblich anderen kognitiven Selbststeuerung, indem sie den Menschen zur mehr Selbstbeherrschung zwingt.
„Über den Prozess der Zivilisation“ betrachtet die gesellschaftlichen Verhaltensweisen des Abendlandes, seit dem Mittelalter. Deshalb lässt sich das Werk in die Makrosoziologie einordnen. Die These, dass ein gewisser Selbstzwang des Individuums notwendig ist, um eine „zivilisiertere“ Gesellschaft entstehen zu lassen, hat laut Elias immer wieder „Zwangshandlungen und andere Störungserscheinungen“ (Elias, 1997b, S.343) zur Folge. Mit dieser Schlussfolgerung erläutert Elias, wenn auch nur am Rande, eine Möglichkeit zur Erklärung der Entstehung psychischer Störungen. Darüber hinaus benutzt er immer wieder Begriffe wie „Über-Ich“ (Elias, 1997b, S. 342), und „Unbewußtsein [sic!]“ (Elias, 1997b, S. 342), die Sigmund Freud zu der Zeit geprägt hat, in der Elias an seinem Werk arbeitete. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte bietet Elias auch eine Basis für psychoanalytische Theorieansätze.
Hinsichtlich des Seminars, das die kulturellen Grundlagen von Gesellschaft und ihre vielfältigen Ausdrucks- und Erscheinungsformen zu vermitteln sucht, passt „Über den Prozess der Zivilisation“ gut ins Konzept, da es eine Basis für unsere heutigen Verhaltensweisen und Regeln liefert.
Elias stellt immer wieder klare Fragen wie „Wie ging eigentlich diese Veränderung, diese „Zivilisation“ im Abendland vor sich? Worin bestand sie? Und welches waren ihre Antriebe, ihre Ursachen oder Motoren?"( Elias, 1997a, S.76) und beantwortet diese dann, mit einem logischen Aufbau seiner Argumente. Er verdeutlicht erfolgreich, wie sich der Zivilisationsprozess seit dem Mittelalter entwickelt und damit, wie unsere heutigen Verhaltensregeln entstanden.
Einzige Kritik sind die nicht übersetzten, lateinischen Passagen, des ersten Bandes, auch wenn sie anschließend meist erklärt werden.
Sehr interessant war zu lesen, welche Auswirkungen der Selbstzwang und Druck zur Aufrechterhaltung des komplexen Verflechtungssystems haben kann.
Aktuellen Studien zufolge leiden mehr als ein Drittel der Europäer unter psychischen Störungen1.
Es stellt sich die Frage, ob dies im Zusammenhang mit der Unterdrückung von Affekten und Lustgefühlen, die tief im Menschen verankert sind, steht. Darüber hinaus wirft Elias indirekt die Frage auf, ob dieser Selbstzwang zu bestimmtem Verhalten wider der Natur des Menschen ist. Zwar ist „Zivilisation“ eine logische Konsequenz und Entwicklung der Gesellschaft, aber noch ist nicht klar, ob der Mensch an seinem, immer verflochteneren Regelsystem zerbricht oder ob es ein immer besseres Zusammenleben ermöglicht.
Quellen:
Elias, Norbert: Über den Prozess der Zivilisation – Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen Erster Band: Wandlungen des Verhaltens in den weltlichen Oberschichten des Abendlandes, München, 1997, S. 75-85, 157-181.
Elias, Norbert: Über den Prozess der Zivilisation – Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen zweiter Band: Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation , München, 1997, S. 9-22, 323-347.
[...]
1 ECNP/EBC: The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010, Paris 2011 (http://www.ecnp.eu/~/media/Files/ecnp/communication/reports/ECNP%20EBC%20Report.pdf)
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Norbert Elias unter dem „Prozess der Zivilisation“?
Es ist ein langfristiger Wandel der menschlichen Verhaltensweisen und Persönlichkeitsstrukturen im Abendland, der nicht rational geplant wurde, sondern sich durch soziale Verflechtungen entwickelte.
Was bedeutet der Begriff „civilité“?
Der Begriff stammt aus dem 16. Jahrhundert und bezeichnete die Höflichkeit der höfischen Gesellschaft, durch die sie sich von anderen Schichten abgrenzte.
Warum gilt Frankreich als Ursprung der modernen Zivilisationsstandards?
Frankreich war im Zeitalter des Absolutismus das am stärksten zentralisierte Land; der dortige Hof setzte Sitten und Gebräuche, die später von anderen europäischen Höfen übernommen wurden.
Wie veränderten sich die Tischsitten laut Elias?
Elias zeigt auf, wie Verhaltensweisen (z. B. das Benutzen von Gabeln), die heute als elementar gelten, im Mittelalter noch völlig unüblich waren und sich erst durch steigende Schamgrenzen etablierten.
Was ist die „unsichtbare Mauer“ zwischen Individuen?
Es ist die durch Erziehung verinnerlichte Distanz zwischen den Körpern von Individuen, die im Mittelalter noch wesentlich geringer war als in der modernen Gesellschaft.
- Quote paper
- Stefan Raß (Author), 2013, Kulturentwicklung als „Prozess der Zivilisation“?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210697