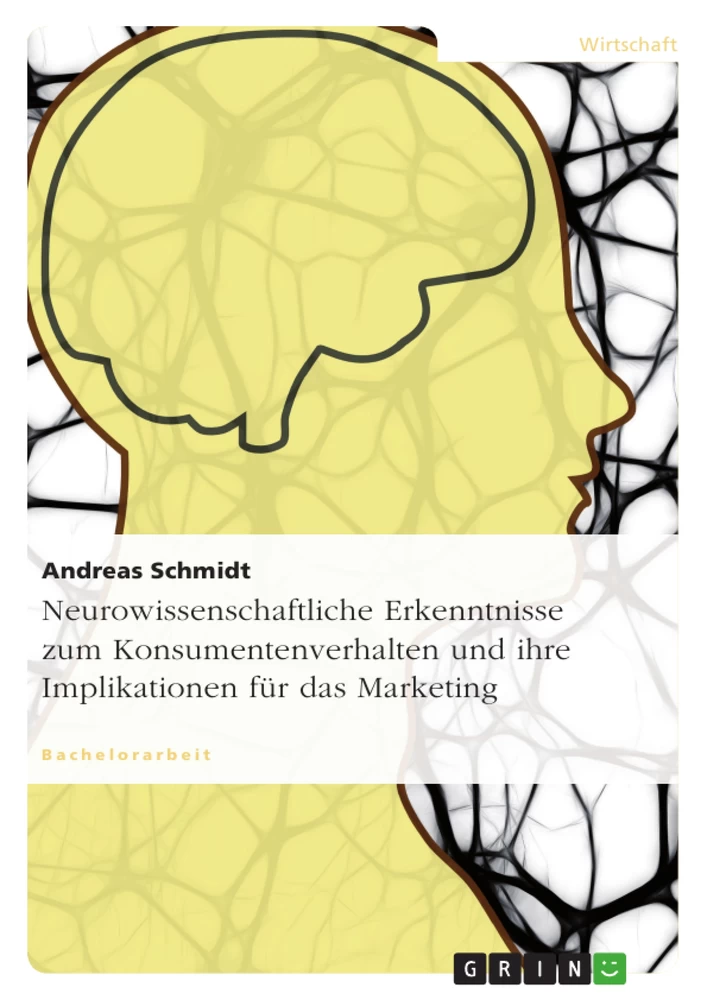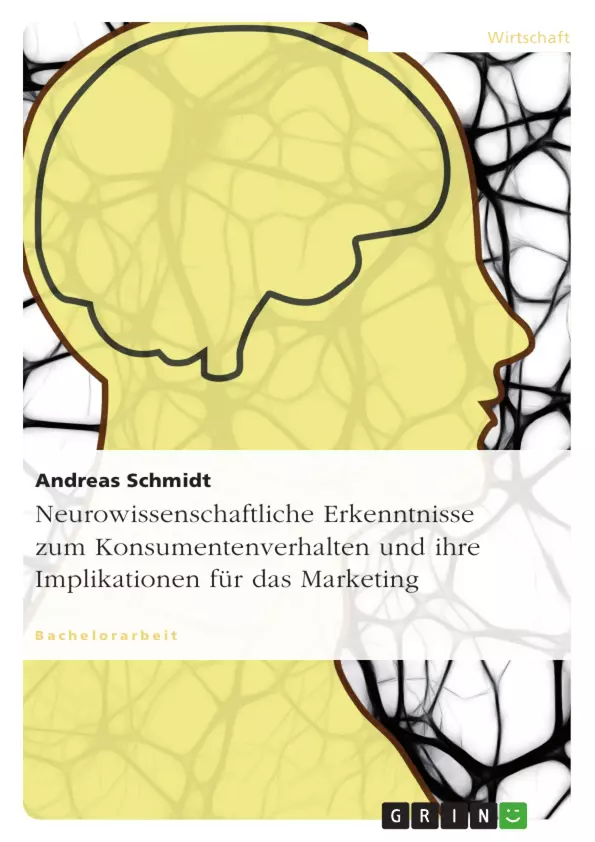Die Hirnforschung hat in den vergangen Jahren einen enormen Aufschwung erlebt. Fortschrittliche medizinische Technologien für die Messung von Gehirnaktivitäten ermöglichen heutzutage Einblicke in die Komplexität des menschlichen Gehirns. So entsteht der Eindruck, die Wissenschaft stünde kurz davor, der sogenannten „Black Box“ Gehirn seine letzten Geheimnisse zu entreißen. Bis heute versuchen sich Forscher an Computermodellen zum Nachbau des menschlichen Gehirns, doch ist die Komplexität der Kombination von rationalen und vor allem aber emotionalen Prozessen bisher unzureichend modellierbar.
Dabei sind es jedoch gerade die emotionalen Prozesse, die das menschliche Erleben und Verhalten in besonderem Maße bestimmen und so das klassische Bild des homo oeconomicus, der sich vor allem durch sein ausschließlich rational handelndes Agieren hervorhebt, neu zeichnen. Ein noch sehr junges interdisziplinäres Forschungsfeld, welches sich seit Ende der 1990er Jahre unter anderem mit der Grundlagenforschung dieser Neuzeichnung beschäftigt, ist das der Neuroökonomie.
Auch die Konsumentenverhaltensforschung als Teilgebiet des Marketings erlebte durch neuroökonomische Forschungen einen neuen Aufschwung. Im Jahr 2003 sorgte eine Untersuchung der Hirnforscher McClure et al. für Schlagzeilen. In der Untersuchung hatte das Forscherteam festgestellt, dass im Blindtest Coca-Cola und Pepsi jeweils die gleichen Hirnregionen aktivierten. Völlig andere Hirnbilder der Probanden zeigten sich jedoch beim offenen Test mit aufgedeckten Marken. Bei der Marke Coca-Cola wurden dort deutlich mehr emotionale Hirnareale aktiviert als es bei der Marke Pepsi der Fall war und die Entscheidung für Coca-Cola fiel gleichzeitig signifikant höher aus. Die anschließende Kritik bis hin zur renommierten Wissenschaftszeitung „Science“ – angesichts eines gläsernen Konsumenten war enorm. Doch wahrscheinlich gerade wegen des öffentlichen Wirbels und den verlockenden hypothetischen Möglichkeiten rückte das Interesse der Hirnforschung in den Blickwinkel verschiedener Konzernzentralen samt Marketing- sowie Marktforschungsabteilungen und spätestens zu diesem Zeitpunkt war die ebenfalls noch junge Disziplin des Neuromarketings bzw. der Consumer Neuroscience geboren.
Diese Arbeit soll einen Status Quo dieser noch neuen Forschungseinrichtung gegeben und Implikationen für das Marketing am Konstrukt der 4 N's bestehend aus Neuropricing, Neuroproducting, Neuropromotion und Neurodistribution aufzeigen.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Anlagenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Ziel der Arbeit
1.2 Aufbau der Arbeit
2 Einordnung des Themas
2.1 Neuroökonomie
2.2 Erweiterung der Neuroökonomie
2.3 Neuromarketing als Teilbereich der Neuroökonomie
3 Grundlagen der „Black Box“ Gehirn
3.1 Neurowissenschaften
3.2 Aufbau des menschlichen Gehirns
3.2.1 Stammhirn
3.2.2 Limbisches System
3.2.3 Großhirnrinde
3.3 Relevante Gehirnstrukturen der Consumer Neuroscience
3.3.1 Belohnungssystem
3.3.2 Bestrafung
3.3.3 Entscheidung
3.4 Methoden der Hirnforschung
3.4.1 Elektroenzephalografie (EEG)
3.4.2 Magnetenzephalografie (MEG)
3.4.3 Positronen-Emissions-Tomografie (PET)
3.4.4 Funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT)
3.4.5 Resümee der Methoden
4 Neurowissenschaftliche Erkenntnisse zum Konsumentenverhalten
4.1 Aktueller Forschungsstand
4.1.1 Markenforschung
4.1.2 Werbewirkungsforschung
4.1.3 Kaufentscheidung
4.1.4 Resümee zum Forschungsstand
4.2 Das Limbic®-Modell der Emotions- und Motivsysteme
4.2.1 Balance-System
4.2.2 Stimulanz-System
4.2.3 Dominanz-System
4.2.4 Dynamik und Spielräume der Emotionen und Motive
4.3 Die Neuentdeckung des Unbewussten
4.4 NeuroIPS Verfahren
4.5 Codes - Die vier Zugänge zum Konsumenten
4.5.1 Sprache
4.5.2 Geschichten
4.5.3 Symbole
4.5.4 Sensorik
4.6 Markennetzwerke
5 Implikationen für das Marketing als Konstrukt der 4 N‘s
5.1 Neuropricing
5.2 Neuroproducting
5.3 Neuropromotion
5.4 Neurodistribution
6 Schlussbetrachtung und Fazit
Anhang
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Vier-Quadranten-Modell neuronaler Verarbeitungsprozesse
Abb. 2: Neuroökonomie und Neurobetriebswirtschaftslehre
Abb. 3: Consumer Neuroscience und Neuromarketing
Abb. 4: Die vier Hauptdisziplinen der Neurowissenschaften
Abb. 5: Schichtenmodell des menschlichen Gehirns nach McLean
Abb. 6: Die Lappen des menschlichen Großhirns
Abb. 7: Zusammenfassung der erwähnten Gehirnareale
Abb. 8: Die wesentlichen neuralen Treiber der Kaufentscheidung
Abb. 9: Präfrontaler Cortex als Teil des Vorderlappens
Abb. 10: Messmethoden der Hirnforschung
Abb. 11: Elektroenzephalografie (EEG) und typische Messergebnisse
Abb. 12: Magnetenzephalografie (MEG) und typisches Messergebnis
Abb. 13: PET des Gehirns
Abb. 14: fMRT des Gehirns
Abb. 15: Phänomen der kortikalen Entlastung
Abb. 16: Der Framing-Effekt
Abb. 17: Die Emotions- und Motivsysteme im Gehirn
Abb. 18: Erscheinungsformen des Balance-Systems
Abb. 19: Erscheinungsformen des Bindungs- und Fürsorge Moduls
Abb. 20: Erscheinungsformen des Stimulanz-Systems
Abb. 21: Erscheinungsformen des Spiel-Moduls
Abb. 22: Erscheinungsformen des Dominanz-Systems
Abb. 23: Erscheinungsformen des Jagd- und Beute- sowie Rauf-Moduls
Abb. 24: Die Limbic-Map und die Werte des Menschen
Abb. 25: Die Neuentdeckung des Unbewussten
Abb. 26: Experiment zum Zusammenspiel zwischen Autopilot und Pilot
Abb. 27: NeuroIPS Verfahren
Abb. 28: Die Symbolik von Marken
Abb. 29: Neue Sichtweise von Markennetzwerken im Gehirn
Abb. 30: Reaktionen des Gehirns auf verschiedene Preisdarbietungen
Abb. 31: Reaktionen des Gehirns auf die Worte „teuer“ und „günstig“
Abb. 32: Reaktionszeitmessung
Abb. 33: Physische und mentale Ebene am Beispiel eines Weinglases
Abb. 34: Vergleich altes und neues Verpackungsdesign von Tropicana
Abb. 35: Coors Light Farbveränderung
Abb. 36: Modell nach Joaquin Fuster
Abb. 37: Volvic Aroma-Wasser
Abb. 38: Tischschmuck-Wasser VOSS vs. Mineral-Wasser Gerolsteiner
Abb. 39: Fünf grundlegende Bedeutungen der BBDO Studie
Abb. 40: Motoröl vs. Duschgel
Abb. 41: Die strategischen Dreiecke der Positionierung
Abb. 42: Die Führungsrolle des impliziten Autopiloten
Abb. 43: Motive und Codes als Ebenen im Markennetzwerk
Abb. 44: Der Brand Code-Management Prozess
Abb. 45: Becks, Jever und Krombacher im Emotions- und Motivraum der Limbic Map
Abb. 46: Stark vereinfachter Ausschnitt des Markennetzwerks von Becks
Abb. 47: Multisensuale Verstärkung
Abb. 48: Brand Strategy Prozess der Umdasch Shopfitting Group
Abb. 49: Sortimentsgeschichte der Marke Nike in Nike Town London
Abb. 50: MEXX-Corner Auswirkungen emotionales Bild vs. ohne Bild
Anlagenverzeichnis
Anlage 1: Experiment zur unbewussten Wahrnehmung
Anlage 2: Limbic Types und ihre Verteilung in Deutschland
Anlage 3: Beispielhafte Kommunikations-Umsetzung eines Kunden- Newsletters für ein fiktives Energieversorgungs-Unternehmen
Anlage 4: Langnese Eis Magnum fünf Sinne
Anlage 5: Deutsche Bank vs. Commerzbank hinsichtlich explizitem vs. implizitem Image
Anlage 6: Real Future Store Fischmarkt
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
Die Hirnforschung hat in den vergangen Jahren einen enormen Aufschwung erlebt. Fortschrittliche medizinische Technologien für die Messung von Gehirn- aktivitäten ermöglichen heutzutage Einblicke in die Komplexität des menschli- chen Gehirns. So entsteht der Eindruck, die Wissenschaft stünde kurz davor, der sogenannten „Black Box“ Gehirn seine letzten Geheimnisse zu entreißen.1 Bis heute versuchen sich Forscher an Computermodellen zum Nachbau des menschlichen Gehirns, doch ist die Komplexität der Kombination von rationalen und vor allem aber emotionalen Prozessen bisher unzureichend modellierbar.2 Dabei sind es jedoch gerade die emotionalen Prozesse, die das menschliche Erleben und Verhalten in besonderem Maße bestimmen und so das klassische Bild des homo oeconomicus, der sich vor allem durch sein ausschließlich ratio- nal handelndes Agieren hervorhebt, neu zeichnen. Ein noch sehr junges inter- disziplinäres Forschungsfeld, welches sich seit Ende der 1990er Jahre unter anderem mit der Grundlagenforschung dieser Neuzeichnung beschäftigt, ist das der „Neuroökonomie“. Auch die Konsumentenverhaltensforschung als Teilge- biet des Marketings erlebte durch neuroökonomische Forschungen einen neuen Aufschwung. Im Jahr 20033 sorgte hier eine wissenschaftliche Untersuchung der Hirnforscher McClure et al.4 für Schlagzeilen in der amerikanischen Publi- kumspresse. In der Untersuchung hatte das Forscherteam festgestellt, dass im Blindtest Coca-Cola und Pepsi jeweils die gleichen Hirnregionen aktivierten. Völlig andere Hirnbilder der Probanden zeigten sich jedoch beim offenen Test mit aufgedeckten Marken. Bei der Marke Coca-Cola wurden dort deutlich mehr emotionale Hirnareale aktiviert als es bei der Marke Pepsi der Fall war und die Entscheidung für Coca-Cola fiel gleichzeitig signifikant höher aus. Die anschlie- ßende Kritik und der Protest in der Publikumspresse - bis hin zur renommierten Wissenschaftszeitung „Science“5 - angesichts eines gläsernen Konsumenten und des möglichen Findens eines „Buy Buttons“ im Gehirn war enorm. Doch wahrscheinlich gerade wegen des öffentlichen Wirbels und den verlockenden hypothetischen Möglichkeiten rückte das Interesse der Hirnforschung in den Blickwinkel verschiedener Konzernzentralen samt Marketing- sowie Marktfor- schungsabteilungen und spätestens zu diesem Zeitpunkt war die ebenfalls noch junge Disziplin des „Neuromarketings“ bzw. der „Consumer Neuroscience“ ge- boren. Hinzu kommt, dass noch immer trotz dutzender Marketing- und Managementinstrumente, ca. 80 % aller neu eingeführten Produkte früh schei- tern6, obwohl vor der Einführung intensiv Marktforschung betrieben wurde. So müssen jedes Jahr etwa 20.000 Artikel nach kurzer Zeit wieder vom Markt ge- nommen werden, was laut der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) eine Summe von 10 Milliarden Euro ausmacht und dabei gleichzeitig verschwendet wird.7 Die klassische Marktforschung stößt an ihre Grenzen auch, weil Konsu- menten häufig keine Auskunft über die wahren Gründe ihres Kaufverhaltens geben können, weil viele Signale unbewusst wirken und aus der Introspektion schwer zu verbalisieren sind (Vgl. hierzu Experiment Anlage 1)8. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende Alan G. Lafley (2000-2009) von Procter & Gamble - ei- nem Unternehmen, das weltweit mit am meisten Geld für Werbung investiert9 - sagt gar „Wir müssen unsere Methode, wie wir den Kunden ansprechen, über- denken und ein neues Modell entwerfen.“10 und stellt damit gleichzeitig die klassischen Marketingansätze in ihrer Wirksamkeit in Frage. Neuromarketing spielt auch zunehmend bei Managern eine Rolle.11
Führte eine Google Suchanfrage des Begriffs „Neuromarketing“ im Jahr 2001 noch nahezu zu einem Nullergebnis12, so sind es heute im Jahre 2013 ungefähr 1.410.000 Ergebnisse.13 Waren es im Jahr 2000 knapp 15 Unternehmen, die explizit neurowissenschaftliche Methoden für die Praxis anboten, so sind es heute mit gut 100 Unternehmen etwa sechs Mal so viele - Tendenz steigend.14 Der rasante Zuwachs entsprechender neuroökonomischer Studien, Artikel und Fachbücher kann ebenfalls als Indikator für das steigende Interesse aus Wissenschaft und Praxis angesehen werden.
1.1 Ziel der Arbeit
Der Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit soll daher sein, das ak- tuelle Trendthema der Neuroökonomie aufzugreifen und zunächst einen Status Quo dieser noch neuen Forschungsrichtung herauszuarbeiten. Im weiteren Ver- lauf wird der Schwerpunkt der Betrachtung dann auf die „Consumer Neuro- science“, respektive das „Neuromarketing“, als Teilbereich der Neuroökonomie gelegt. Ziel ist es dabei, das Konsumentenverhalten aus dem Blickwinkel neu- rowissenschaftlicher Erkenntnisse der Hirnforschung zu betrachten um daraus ergänzende Implikationen für die Marketingpraxis abzuleiten. Die Ableitung für die Marketingpraxis soll dabei an einem innovativen Konstrukt der vier N’s er- folgen, das in Anlehnung an den Marketing Mix der vier P’s, aus den Konstruk- ten Neuropricing, Neuroproducting, Neuropromotion und Neurodistribution be- steht.
1.2 Aufbau der Arbeit
Zur besseren Orientierung soll im zweiten Abschnitt zunächst der Titel dieser Arbeit „Neurowissenschaftliche Erkenntnisse zum Konsumentenverhalten und ihre Implikationen für das Marketing“ näher zu den damit in Verbindung stehen- den Disziplinen eingeordnet werden. Dazu werden die Schnittmengen zwischen den Neurowissenschaften und den Wirtschaftswissenschaften am Begriff der Neuroökonomie konkretisiert und erläutert. Anschließend erfolgt eine Erweite- rung des Begriffs der Neuroökonomie, in der das Neuromarketing, respektive die Consumer Neuroscience, als Teilbereich der Neuroökonomie dargestellt wird.
Um ein besseres Verständnis über das Organ des Gehirns zu erhalten, soll im dritten Abschnitt, die sogenannte „Black Box“ Gehirn in ihren Grundzügen erfasst und durchleuchtet werden. Darunter zählt an erster Stelle der Zugang zur Hirnforschung über die Neurowissenschaften. Nach kompaktem Einstieg in die Neurowissenschaften erfolgt ein grober Überblick über den strukturellen und funktionellen Aufbau des menschlichen Gehirns. Hierbei werden auch die relevanten Gehirnstrukturen hinsichtlich der Consumer Neuroscience thematisiert. Abschließend werden die wichtigsten Methoden der Hirnforschung exemplarisch dargestellt und in einem Resümee gewürdigt.
Der vierte Abschnitt widmet sich konkret den neurowissenschaftlichen Erkennt- nissen zum Konsumentenverhalten. Dazu werden zunächst primäre Studiener- gebnisse der Consumer Neuroscience vorgestellt. Im weiteren Verlauf wird das Konsumentenverhalten anhand des Limbic-Modells aus dem Blickwinkel der Emotions- und Motivsysteme betrachtet. Im Anschluss daran wird dezidiert auf die Neuentdeckung des Unbewussten eingegangen. Letzten Endes werden die sogenannten Codes als Zugänge zum Konsumenten aufgezeigt und beispiel- haft die neue Sichtweise von Markennetzwerken im Gehirn dargestellt.
Abschließend soll in Abschnitt fünf der Fokus gezielt auf den praktischen Nut- zen und die Implikationen neurowissenschaftlicher Erkenntnisse für das Marke- ting gelegt werden. Als Basis dafür dient der traditionelle Marketing Mix mit sei- nen vier P’s, bestehend aus der Preispolitik (Price), der Produktpolitik (Product), der Kommunikationspolitik (Promotion) sowie der Distributionspolitik (Place).15 Diese Basis der vier P’s des Marketings, soll nachfolgend um das Konstrukt der vier N’s, bestehend aus Neuropricing, Neuroproducting, Neuropromotion und Neurodistribution ergänzt werden, indem eine Brücke zwischen Erkenntnissen der modernen Hirnforschung und der Marketingpraxis geschlagen wird.
2 Einordnung des Themas
Zur besseren Orientierung soll an dieser Stelle zunächst der Titel dieser Arbeit „Neurowissenschaftliche Erkenntnisse zum Konsumentenverhalten und ihre Implikationen für das Marketing“ näher zu den damit in Verbindung stehenden Disziplinen eingeordnet werden. Dazu werden die Schnittmengen zwischen den Neurowissenschaften und den Wirtschaftswissenschaften am Begriff der Neuroökonomie konkretisiert und erläutert. Anschließend erfolgt eine Erweite- rung des Begriffs der Neuroökonomie in der das Neuromarketing - respektive die Consumer Neuroscience - als Teilbereich der Neuroökonomie dargestellt wird.
2.1 Neuroökonomie
Der Begriff Neuroökonomie kann in umfassender Form aufgefasst werden als die Beschreibung und Erklärung menschlichen Verhaltens in ökonomischen Entscheidungssituationen unter zu Hilfenahme methodischer Unterstützung der Neurowissenschaften.16 Dabei liefern die Wirtschaftswissenschaften die theore- tischen und praxisbezogenen Problemstellungen und die Neurowissenschaften geben Aufschluss über die neuronalen Grundlagen menschlichen Verhaltens.17 Weitere Erklärungsbeiträge werden unter anderem durch die Psychologie und Soziologie geliefert, so dass die Neuroökonomie insgesamt als eine interdiszip- linäre Wissenschaft bezeichnet werden kann.18 Beim Begriff Neuroökonomie ist ferner zwischen Neuroökonomie im engeren und weiteren Sinne zu differenzie- ren. Die Untersuchung klassischer mikroökonomischer Fragestellungen erfolgt dabei im engeren Sinne. Hierunter sind Entscheidungen unter Unsicherheit, Interaktion zwischen Individuen hinsichtlich der Spieltheorie sowie das inter- temporale Wahlverhalten und das Verhalten in Märkten von Bedeutung. Die Auffassung der Neuroökonomie im weiteren Sinne schließt zusätzlich alle wei- teren Forschungskomplexe mit ein, die sich mit den neuronalen Grundlagen von generell ökonomisch relevanten Verhalten befassen. Beispiele hierfür sind die betriebswirtschaftlichen Disziplinen, die unter dem Begriff Neurobetriebs- wirtschaftslehre (Vgl. Kapitel 2.3) zusammengefasst werden.19 Ziel der Neu- roökonomie ist es, das Gehirn als „Black Box“ vor, während und nach ökonomi- schen Entscheidungen besser zu verstehen sowie dabei kognitiv und affektiv ablaufende Prozesse in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Die Neuroökonomie er- fährt diesbezüglich seit Ende der 1990er Jahre einen regelrechten Forschungs- boom, da sich seit dieser Zeit die zur Verfügung stehenden Methoden der mo- dernen Hirnforschung technisch rasant weiterentwickelt haben.20
Das klassische Bild des Menschen als homo oeconomicus in seiner ursprüngli- chen Form, welches sich durch ausschließlich rational handelndes Verhalten auszeichnet, erfährt durch Erkenntnisse der Neuroökonomie eine ergänzende Komponente. Nach Meinung der Neurowissenschaftler, fehlt dem homo oeco- nomicus die emotionale Basis, welche jedoch hinsichtlich der Erklärungsversu- che des menschlichen Verhaltens in Kaufsituationen, Finanzierungsentschei- dungen oder anderen betriebswirtschaftlichen Situationen, wie beispielsweise dem Management, von bedeutender Relevanz ist. Im Fokus der neurowissen- schaftlichen Untersuchungen stehen daher die Emotionen, die neuronale Akti- vierung und die Prozesse der Informationsverarbeitung. Dabei wird versucht herauszufinden inwieweit die rationalen und kognitiven Prozesse vor, während oder nach Entscheidungssituationen von den Affekten und Emotionen beein- flusst werden, diese überlagern oder unbewusst steuern.21
Zur näheren Konkretisierung hinsichtlich der neurowissenschaftlichen For- schung eignet sich an dieser Stelle das Vier-Quadranten-Modell nach Camerer et al.22 (Vgl. Abb. 1 Folgeseite). Der Anordnung des Modells zur Folge werden die neuronalen Prozesse anhand von zwei Dimensionen näher unterschieden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Vier-Quadranten-Modell neuronaler Verarbeitungsprozesse
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Camerer, C. et al. 2005, S. 16.
Auf der horizontalen Achse findet sich die Unterscheidung zwischen kognitiven und affektiven Prozessen. Unter kognitiven Prozessen versteht man dabei alle gehirngesteuerten Abläufe, die mit Erinnerungen, Wissen, Überzeugungen und Absichten verknüpft sind. Affektive Prozesse hingegen beziehen sich auf sämt- liche Emotionen (Freude, Angst etc.), Triebe (Hunger, Durst etc.) sowie motiva- tionale Zustände (wie Ekel, physischer Schmerz etc.). Die vertikale Achse wird in kontrollierte und automatische Prozesse untergliedert. Kontrollierte Prozesse laufen sequentiell, d. h. Schritt für Schritt ab. Sie werden nach einem inneren oder äußeren Reiz bewusst ausgelöst, sind mit einem gewissen Maß an An- strengung verbunden und können im Nachhinein noch gut reflektiert werden. Automatische Prozesse verlaufen parallel anstatt sequentiell. Sie laufen im Un- terbewusstsein ab und sind für das Bewusstsein gar nicht oder nur sehr schwer zugänglich. Da sie nur eine geringe neuronale Verarbeitungskapazität erfor- dern, werden sie als relativ anstrengungsfrei erlebt. Camerer et al. nach intera- gieren die zwei Unterscheidungsebenen fast immer mit der Bewältigung einer Aufgabe zusammen, welches mit den Feldern I - IV abgebildet wird. So be- trachtet die klassische Wirtschaftsforschung bisher lediglich den Quadrant I der kontrollierten kognitiven Prozesse, während die drei übrigen Felder, insbeson- dere Feld IV, dem weiter gespannten Anspruch einer wirklich verhaltensorien- tierten Analyse ökonomischen Entscheidens und Handelns entgegenkommen.23
2.2 Erweiterung der Neuroökonomie
Anlässlich des großen Zuspruchs neurowissenschaftlicher Erkenntnisse für klassische betriebswirtschaftliche Funktionen und zur besseren Einordnung in die Neuroökonomie, nehmen Peters/Ghadiri eine Erweiterung der Definition der Neuroökonomie vor. Dabei werden die betriebswirtschaftlichen Funktionen Neu- romarketing, Neurofinance, Neuroleadership und Neuromanagement unter dem Begriff „Neurobetriebswirtschaftslehre“ zusammengefasst. Peters/Ghadiri zufol- ge untersucht die Neurobetriebswirtschaftslehre Forschungskomplexe, die neu- rowissenschaftliche Erkenntnisse auf betriebliche Funktionen anwenden und sich an dieser Stelle von klassischen mikroökonomischen Fragestellungen ab- grenzen.24
Die einzelnen Disziplinen, die Peters/Ghadiri nach, der Neurobetriebswirtschaftslehre zugeordnet werden, sind Neurofinance, Neuroleadership, Neuromanagement und Neuromarketing.25 Abb. 2 soll dieses erweiterte Verständnis der Neuroökonomie verdeutlichen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Neuroökonomie und Neurobetriebswirtschaftslehre
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Peters, T./Ghadiri, A. 2011, S. 14.
Hinsichtlich dieser Arbeit liegt der Fokus auf dem Neuromarketing, da hier neurowissenschaftliche Erkenntnisse auf das Marketing, respektive das Konsumentenverhalten projiziert werden. Demzufolge soll im nachfolgenden Kapitel dezidiert auf das Neuromarketing eingegangen werden.
2.3 Neuromarketing als Teilbereich der Neuroökonomie
Wie in den vorangegangen Ausführungen dargestellt wurde, wird das Neuro- marketing in der Literatur vom übergeordneten Begriff der Neuroökonomie ab- gegrenzt und entsprechend den Autoren Peters/Ghadiri in einer erweiterten De- finition der Neuroökonomie zur Neurobetriebswirtschaftslehre zugeordnet.
Der Begriff Neuromarketing taucht in der Literatur - insbesondere in der univer- sitären Grundlagenforschung und unter dem Gesichtspunkt des Konsumenten- verhaltens - auch unter der Bezeichnung „Consumer Neuroscience“ auf.26 Nach Kenning et al. wird unter „Consumer Neuroscience“, die Nutzung neuro- wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden mit dem Ziel verstanden, die Grundlagen des für das Marketing relevanten Konsumentenverhaltens besser zu verstehen.27 Das Neuromarketing hingegen wird entsprechend Häusel, in eine engere und eine weitere Sichtweise unterteilt. Unter der engeren Sichtwei- se wird Neuromarketing, als die Nutzung von apparativen Methoden der Hirn- forschung für Marketingzwecke verstanden. Die weitere und umfassendere Sichtweise definiert den Begriff des Neuromarketing, als die Nutzung von appa- rativen Methoden und der Erkenntnisse der Hirnforschung für Marketingzwecke. Das Ziel des Neuromarketings ist es, ein erweitertes Verständnis über die Zu- stände und Prozesse im menschlichen Gehirn in Zusammenhang mit marke- tingrelevanten Fragestellungen wie z. B. dem Kauf- und Wahlverhalten oder Markenverhalten zu erhalten, um so die ‚wahren‘ Bedürfnisse und Wünsche der Konsumenten besser antizipieren zu können.28 Erweitertes Verständnis bedeu- tet in diesem Fall auch, dass das Neuromarketing nicht versucht die traditionelle Marktforschung zu ersetzen, sondern als interdisziplinärer Ansatz bestehende Kenntnisse aus klassischen Teilgebieten wie beispielsweise der empirischen Sozial- und Marktforschung und Psychologie mit Hilfe neurowissenschaftlicher Erkenntnisse wissenschaftlich zu ergänzen und bestenfalls zu validieren.29
Beide Begriffe Neuromarketing und Consumer Neuroscience sind demnach eng miteinander verzahnt und der Übergang verläuft fließend. Differenziert betrach- tet beinhaltet also die Consumer Neuroscience die neurowissenschaftliche Grundlagenforschung zum Konsumentenverhalten, während das Neuromarke- ting anwendungs- und praxisorientiert auf das Marketing ausgerichtet ist (Vgl. Abb. 3).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Consumer Neuroscience und Neuromarketing
Quelle: Eigene Darstellung.
Der Titel dieser Arbeit ist daher diesen beiden zuvor genannten Bereichen zuzuordnen. Für den weiteren Verlauf dieser Arbeit wird die weitere Definition von Neuromarketing gewählt, da hier der Blickwinkel in umfassenderer Form auf die gesamten Erkenntnisse der aktuellen Hirnforschung in Bezug auf Marketingtheorie und Marketingpraxis gelegt wird.
3 Grundlagen der „Black Box“ Gehirn
Um ein besseres Verständnis über das Organ des Gehirns zu erhalten soll nachfolgend die sogenannte „Black Box“ Gehirn in ihren Grundzügen erfasst und durchleuchtet werden. Darunter zählt an erster Stelle der Zugang zur Hirnforschung über die Neurowissenschaften. Nach kompaktem Einstieg in die Neurowissenschaften erfolgt ein grober Überblick über den strukturellen und funktionellen Aufbau des menschlichen Gehirns. Hierbei werden auch die relevanten Gehirnstrukturen hinsichtlich der Consumer Neuroscience thematisiert. Abschließend werden die wichtigsten Methoden der Hirnforschung exemplarisch dargestellt und in einem Resümee gewürdigt.
3.1 Neurowissenschaften
Neurowissenschaften exakt zu definieren ist schwierig. Selbst die umfangreiche Einführung in die Neurowissenschaften von Kandel et al. biete keine exakte Definition dieses Wissenschaftsbereiches. Das große Spektrum der Neurowissenschaften lässt sich allerdings mit Blick auf die Vielzahl der angesprochenen Themenbereiche, erahnen.30
In einer knappen Definition der Untersuchung zum Thema „Hirnforschung“ des Deutschen Bundestages wird unter Neurowissenschaften der Aufbau des Ge- hirns, sowie die Erforschung des Nervensystems und seine Bedeutung für Wahrnehmung, inneres Erleben und Verhalten der Menschen verstanden.31
Die verschiedene Forschungsgegenstände und Zugangsweisen der Neurowissenschaften lassen sich üblicherweise drei verschiedenen Beschreibungsebenen zuordnen:
Einer unteren, subzellulären und zellulären Ebene, d. h. die Untersu- chung der Funktion und Wechselwirkung von Neuronen (Nervenzellen), Neurotransmittern (z. B. Glutamat) und Neuromodulatoren (z. B. Dopa- min).
Einer mittleren Ebene aus neuronalen Netzwerken von tausenden Zellen und ihrem Zusammenwirken bei der Erbringung von Gehirnleistungen wie etwa Lernen, dem Erkennen von Handlungsoptionen, der Handlungsplanung- und Steuerung.
Einer oberen Ebene, d. h. ganzer funktionaler Systeme und Areale des Gehirns und der räumlichen Lokalisation entsprechender Hirnleistungen. So z. B. des Sprachzentrums oder des limbischen (emotionalen) Sys- tems.32
Einige Bereiche der unterschiedlichen Ebenen sind bereits schon gut erforscht, so z. B. auf der oberen Ebene die Hirnareale sowie lokalisierbaren Systeme. Über die ablaufenden Vorgänge auf der mittleren Ebene, denen die Prozesse auf der obersten Ebene zugrunde liegen, weiß die Hirnforschung jedoch noch relativ wenig. Die Verarbeitung von wahrgenommen Informationen auf höheren Ebenen und ihre Verknüpfung, im Sinne einer multimodalen Wahrnehmung mit anderen Schaltkreisen im gesamten Gehirnverbund ist noch weitgehend unbe- kannt. So z. B. die Verknüpfung mit emotionalen Zuständen und autobiographi- schen Erinnerungen, ihrer Codierung, Bewertung und Speicherung, respektive, wenn hundert Millionen oder gar einige Milliarden Nervenzellen miteinander kommunizieren.33
Die zahlreichen Disziplinen der Neurowissenschaften lassen sich, den zuvor genannten Ebenen entsprechend, grob in vier Hauptdisziplinen einteilen (Vgl. Abb. 4 Folgeseite).34
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Die vier Hauptdisziplinen der Neurowissenschaften
Quelle: Eigene Darstellung.
Alle vier Hauptdisziplinen beinhalten dabei, eine Vielzahl untergeordneter Teildisziplinen, die nachfolgend grob beschrieben werden.35
Die Neurobiologie als Teildisziplin der Biologie beschäftigt sich im Wesentli- chen mit den molekularen und zellbiologischen Grundlagen der Neurowissen- schaften. Im Fokus steht dabei die Struktur, Aufbau und Entwicklung von Ner- venzellen sowie des Nervensystemen. Teilgebiet der Neurobiologie stellt auch die vergleichende Hirnforschung dar. Für ca. 95 % aller Untersuchungen in der Hirnforschung dienen Säugetiere. Schimpansen und Menschen haben zu 96-99 %36 die gleichen Gene, so dass die Ergebnisse evolutionär bedingt durchaus auf den Menschen übertragbar sind. Ein weiteres relevantes angren- zendes Gebiet der Neurobiologie stellt der Komplex der neurochemischen Vor- gänge über Nervenbotenstoffe (wie z. B. Serotonin oder Dopamin) im Gehirn dar. Dies wird unter dem Begriff der Neurochemie zusammengefasst. Nerven- botenstoffe sind maßgeblich hinsichtlich der Steuerung von Motiven und Emoti- onen im Gehirn beteiligt. Auch bestehen zwischen Mann und Frau erhebliche Unterschiede in der Konzentration dieser Nervenbotenstoffe, was wiederum zu unterschiedlichen Emotions- und Motivausprägungen sowie zu einer verschie- denen Art des Denkens führt. Ähnliches für die Konzentration der Nervenboten- stoffe gilt in Bezug auf das Lebensalter, denn im Verlauf des Lebens ändert sich die Zusammensetzung dieser Stoffe im Gehirn, was wiederum Verhaltensände- rungen impliziert.37
Die Neurophysiologie als Teilgebiet der Physiologie befasst sich mit der Funk- tionsweise des Nervensystems. Hier werden die Leistungen, Informationsverar- beitungen und Reaktionen des Nervensystems auf Umweltreize und der dabei dynamische Prozess der Signalübertragung zwischen Nervenzellen untersucht.
Unter Kognitive Neurowissenschaft werden alle Aktivitäten des Nervensys- tems zusammengefasst, die Einfluss auf mentale Prozesse bzw. kognitive Funktionen wie beispielsweise Aufmerksamkeit, Denken oder Erinnern nehmen. Untersucht wird hier, welche Areale für bestimmte Aufgaben aktiv sind und wie diese Aktivitäten des Gehirns, Geist und Bewusstsein hervorbringen.
Den vierten und letzten Bereich stellen die Klinisch-medizinischen F ä cher dar. Hierunter sind beispielsweise Disziplinen wie die Neurologie oder die Neu- ropsychologie zu verstehen die sich mit der Entstehung und Entwicklung, der Diagnose, sowie der Therapie einer Erkrankung des Gehirns befassen.
Eine weitere interdisziplinäre und auch die Neurowissenschaften betreffende Disziplin stellt die der Neurophilosophie dar. Diese verknüpft Teile der Neuro- wissenschaften mit der Philosophie. Dieses Fachgebiet setzt sich unter ande- rem mit der Frage auseinander, ob der Mensch überhaupt einen freien Willen hat und was unter dem Begriff Bewusstsein zu verstehen ist. Hinsichtlich des Konsumentenverhaltens ist hier der Begriff der Bewusstseinsillusion relevant. Dabei wird davon ausgegangen, dass Entscheidungen im Unterbewusstsein bereits getroffen sind, bevor der Mensch sie als bewusst erlebt.38
Dieser komprimierte Einblick in den überdimensionalen Bereich der Neurowis- senschaften soll an dieser Stelle genügen. Für das weitere Verständnis der Ar- beit ist es hinreichend, unter Neurowissenschaften die Grundgesamtheit der Einzeldisziplinen zu verstehen, die Aufschluss über den Aufbau und die Funkti- onsweise der Prozesse im menschlichen Gehirn geben. Anzumerken ist dabei, dass keine der zuvor genannten Disziplinen der Neurowissenschaften alleine in der Lage ist, ein umfassendes Bild des Konsumenten zu zeichnen. Erst die Verknüpfung der einzelnen Disziplinen der Neurowissenschaften (und auch Psychologie und Soziologie) mit ihren unterschiedlichen Perspektiven, tragen zu einem immer besseren Verständnis zum Konsumentenverhalten bei.39
Das Zentrum der Neurowissenschaften bezieht sich dabei auf das Forschungsobjekt des menschlichen Gehirns welches im nachfolgenden Kapitel komprimiert beschrieben wird.
3.2 Aufbau des menschlichen Gehirns
Das menschliche Gehirn nimmt im Hinblick auf die Neurowissenschaften eine zentrale Rolle ein. Es bietet als zentrale Verarbeitungszentrale der etwa 100 Milliarden Nervenzellen40 sozusagen die Bühne aller Sinnesempfindungen als auch komplexen Informationsverarbeitungen und steuert aus der Summe der Entscheidungen die anatomischen Bewegungen sowie das körperliche und emotionale Befinden. Darüber hinaus ist das Gehirn der Sitz des Bewusstseins, des Gedächtnisses und aller seelischen und geistigen Leistungen wie Emotion und Kognition.41 Das Gehirn als Ganzes ist dabei im Durchschnitt 1.300 Gramm schwer und besteht aus bis zu 80 % Wasser. Dabei macht es nur zwei Prozent des Körpergewichts aus, verbraucht jedoch dennoch bis zu 25 % der Energie des Körpers. Um die Leistungsfähigkeit sicherzustellen, strömen bis zu 1200 Liter Blut pro Tag durch das Gehirn und liefern damit über 70 Liter Sauerstoff.
Das menschliche Gehirn lässt sich grob in zwei Hälften, die sogenannten Hemi- sphären, einteilen.42 Die strikte Trennung der Zuständigkeitsbereiche in linke Hälfte für Fakten, logisches Denken und Verarbeitung von Sprache sowie die rechte Hälfte für emotionales Erleben, Kreativität sowie bildliche und räumliche Informationen, werden dabei mittlerweile als überholt angesehen (Vgl. hierzu Kapitel 4.1.2).43
Die gesamte Gehirnstruktur ist dabei ähnlich komplex wie die im Gehirn ablaufenden Verarbeitungsprozesse und eine exakte, transparente Darstellung des Gehirns würde über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen. Zur Komplexitätsreduzierung bietet sich daher an dieser Stelle das vereinfachte Gehirnmodell vom amerikanischen Hirnforscher McLean an. Dieses sogenannte Schichtenmodell teilt das Gehirn in drei Bereiche ein, die Großhirnrinde, das limbische System und das Stammhirn (Vgl. Abb. 5).44
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Schichtenmodell des menschlichen Gehirns nach McLean
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Gassen, H. G. 2008, S.39.
Zwar wird in der Fachliteratur immer wieder auf die in hohem Maße vorhandene Verwobenheit der einzelnen Hirnareale hingewiesen45, aber dennoch eignet sich das Schichtenmodell an dieser Stelle für einen ersten komplexitätsreduzierten Überblick der Hirnareale.
Eine detaillierte Betrachtung der einzelnen Areale, erfolgt in den nachfolgenden Unterkapiteln 3.2.1 bis 3.2.3. Die Strukturen die für das Verständnis der neurowissenschaftlichen Forschungsergebnisse zum Konsumentenverhalten besonders relevant sind werden in Kapitelpunkt 3.3 thematisiert.
3.2.1 Stammhirn
Das Stammhirn ist der evolutionär älteste Teil des Gehirns und setzt sich aus dem verlängerten Rückenmark, Kleinhirn und Hinterhirn (auch Brücke), Mittel- hirn sowie Zwischenhirn zusammen. Dort ist die Stelle in der die über die Sin- nesorgane ankommenden Informationen verarbeitet werden und die bei Bedarf für sofortige und elementare Reflexe sorgt. Darüber hinaus werden in diesem Bereich die Instinkte und zentralen Körperfunktionen (z. B. Atmung, Blutkreis- lauf) gesteuert.46
Als wichtiges Element ist dabei der Thalamus zu nennen, der den größten Teil des Zwischenhirns darstellt. Der Thalamus seinerseits setzt sich aus diversen Kerngebieten zusammen, die eine besonders starke Verbindung zur gesamten Großhirnrinde aufweisen. Als Empfangsstation für alle ankommenden Informa- tionen aus dem Körper und den Sinnesorganen ist er dabei für eine Art grobe Klassifizierung und Auswertung dieser Signale zuständig. In Form einer Mi- schung aus Filterstation und Entscheidungszentrale bestimmt der Thalamus darüber, welche Relevanz einzelne Informationen für den Organismus haben und inwieweit sie einer Weiterleitung zur Großhirnrinde, zum Mandelkern und zum Hippocampus (Bestandteil des limbischen Systems vgl. Kapitel 3.2.2) zur differenzierten Weiterverarbeitung bedürfen. Kurz gesagt bestimmt der Thalamus durch diese Weiterleitung, welche Informationen bewusst werden sollen und einer präziseren Bearbeitung unterzogen werden müssen. Demzufolge wird der Thalamus auch als das „Tor zum Bewusstsein“ bezeichnet.47
3.2.2 Limbisches System
Das limbische System ist das Zentrum der Emotionen und reichert die mensch- lichen Wahrnehmungen und Gedanken mit einem Spektrum emotionaler Fär- bung an. Durch diese unbewusst erzeugten Stimmungen wird das menschliche Verhalten stark beeinflusst. So hat das limbische System einen maßgeblichen Anteil am unbewussten Entstehen und der Regulation von körperlichen Bedürf- nissen, Affekten und Gefühlen. Das limbische System steht dabei in enger Ver- bindungen zum Stammhirn, besonders zum Hypothalamus. Dieser übermittelt Signale an die Hypophyse - der obersten Hormondrüse - die einerseits den Hormonhaushalt steuert und damit auch die Emotionen in Körpergefühle um- wandelt.48
Als wesentlicher Bestandteil des limbischen Systems ist ferner der Mandelkern (auch Amygdala) zu nennen, der über neuronale Bahnen eng mit dem Hippo- campus verbunden ist. Der Mandelkern selbst besteht aus 13 Kernen und erhält über Faserverbindungen zahlreiche Informationen aus höheren Hirnzentren. Er kann als ein zentrales emotionales Bewertungs- und Alarmsystem im Gehirn angesehen werden, da er Ereignisse mit Emotionen verknüpft und abspeichert. So kann es beispielsweise vorkommen, dass frühere Ereignisse die mit Gefahr oder Schmerz verbunden waren, in zukünftigen vergleichbaren Situationen eben wieder diese im Gedächtnis verankerten Reaktionen hervorrufen. Daher wird der Mandelkern auch als Körpergedächtnis bezeichnet. Der mit dem Man- delkern verbundene Hippocampus dagegen, fungiert als eine Art ‚Organisator‘ des Gedächtnisses. Dort fließen alle Informationen aus verschiedenen sensori- schen Systemen zusammen, werden verarbeitet und zur Großhirnrinde weiter- geleitet. Demzufolge ist der Hippocampus von hoher Bedeutung für die Ge- dächtniskonsolidierung, d. h. die Überführung von konkreten Gedächtnisinhal- ten aus dem Kurzzeit- in das Langzeitgedächtnis und wird so auch als Genera- tor für neue Erinnerungen angesehen. Darüber hinaus erfolgt dort auch die Ko- ordinierung der an den verschiedenen Stellen der Großhirnrinde abgespeicher- ten Gedächtnisinhalte indem unzählige verschiedene Eindrücke zu einem kon- sistenten Bild zusammengefügt werden. So besteht beispielsweise die „innere Karte“, die man von einer Stadt besitzt, aus zahlreichen Eindrücken, die auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten gewonnen und abgespeichert wurden. Ab- schließend im Zusammenhang und als Teil des limbischen Systems zu erwäh- nen, ist der Kernbereich des Nucleus accumbens. Dieser Bereich spielt im Kon- text des „Belohnungssystems“ (Vgl. Kapitel 3.3.1) eine zentrale Rolle.49
3.2.3 Großhirnrinde
Die Großhirnrinde (auch Cortex) ist der evolutionär jüngste Teil des Gehirns. Sie wird dabei in fünf Bereiche50 (auch Lappen) eingeteilt. Vier der fünf Lappen, liegen an der Hirnoberfläche. Dies sind der Stirnlappen (auch Frontalcortex), der Scheitellappen (auch Parietalcortex), der Schläfenlappen (auch Temporalcortex) und der Hinterhauptslappen (Okzipitalcortex).
Jeder Lappen entspricht dabei einem vielfältig funktionalen Verarbeitungsareal (Vgl. Abb. 6 Folgeseite). Den fünften Bereich stellt die Insula (auch Inselrinde) dar. Als eingesenkter Teil der Großhirnrinde, spielt diese Gehirnregion hinsicht- lich der Kodierung von „Bestrafung“ eine entscheidende Rolle (Vgl. Kapitel 3.3.2).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Die Lappen des menschlichen Großhirns
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Bear, M. F. et al. 2009, S. 217.
Die Großhirnrinde steuert u.a. über die sogenannten Basalganglien motorische, sensorische und assoziative Funktionen. Sie macht willkürliche Bewegungen möglich, macht Sinnesreize bewusst und ist für komplexe kognitive Leistungen wie z. B. Denken und Sprechen verantwortlich. Die Bewältigung dieser Aufga- ben ermöglichen Netzwerke verschalteter Nervenzellen die Informationen gleichzeitig in verschiedenen sensorischen Systemen verarbeiten. Jedes dieser Systeme entschlüsselt dabei die ankommenden Reize und wertet sie in den entsprechenden Hirnarealen aus. Die komplexe Funktionalität des Gehirns be- steht letztendlich darin die Informationsflut zu einem einheitlichen Bild zusam- menzufügen, so dass interne kongruente Repräsentationen entstehen, die die Realität individuell widerspiegeln.51 Dies hat zur Folge, dass die Wahrnehmung der realen Welt einem sehr subjektiven Empfinden unterliegt, auch wenn ge- sellschaftliche Regeln bestehen die eine soziale Wahrnehmung ermöglichen.
Die stark gefurchte Großhirnrinde legt sich dabei über die zwei Hemisphären und kann als eine Art Metasystem verstanden werden, welches die zuvor genannten innenliegenden Bereiche - limbisches System und Stammhirn - interaktiv über neuronale Regelkreise miteinander verbindet. Aufgrund dessen ist es notwendig, die einzelnen Bereiche nicht getrennt voneinander zu betrachten sondern als Einheit aufzufassen.52
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ohne Stammhirnfunktion der Mensch nicht überleben könnte, ohne das limbische System er antriebslos und handlungsschwach wäre und er ohne die Großhirnfunktion ziel- und planlos handeln würde.53 Zur Veranschaulichung werden in nachfolgender Abb. 7 die zuvor angesprochenen Hirnareale der einzelnen drei Ebenen Stammhirn (3), Limbisches System (2) und Großhirnrinde (1) in einer Übersicht dargestellt.
Abbildung 7: Zusammenfassung der erwähnten Gehirnareale
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Peters, T./Ghadiri, A. 2011, S. 29.
Fundamental für die neuroökonomische Wissenschaft sind vor allem die Befun- de über Emotionen und damit über das limbische System. Dort befindet sich auch der Nucleus accumbens, bei dem es sich um einen Bereich des Beloh- nungssystems handelt. Dieser und weitere relevante Gehirnstrukturen der Con- sumer Neuroscience werden im nachfolgenden Kapitel 3.3 näher beschrieben.
3.3 Relevante Gehirnstrukturen der Consumer Neuroscience
In diesem Kapitelpunkt soll auf die für das Konsumentenverhalten relevanten Hirnstrukturen eingegangen werden. Dies sind Hirnstrukturen, die mit der neuronalen Verarbeitung von Produkten, Preisen, Werbung und Marken verbunden sind. Dabei handelt es sich um Strukturen, die den Konzepten Belohnung, Bestrafung und Entscheidung zugeordnet werden können. Diese Strukturen sind von einem signifikanten Interesse für die Konsumentenverhaltensforschung und werden nachfolgend betrachtet.54
3.3.1 Belohnungssystem
Das Belohnungssystem besteht aus einer komplexen Verflechtung von Struktu- ren verschiedenster Hirnareale wie beispielsweise Teile der Großhirnrinde (orbitofrontaler Cortex) und des limbischen Systems.55 Der Beweis für die Exis- tenz des Belohnungssystems geht zurück auf ein Tierexperiment von den Wis- senschaftlern James Olds und Peter Millner56 aus dem Jahr 1954. Hierzu im- plantierten die Wissenschaftler Nadelelektronen in Rattengehirne, die über elektrisch freisetzbare Reize in der Lage waren das Gehirn der Ratten zu stimu- lieren. Die Freisetzung der elektrischen Reize erfolgte dabei im Versuchsaufbau in Form eines Hebels durch die Tiere selber. Das Ergebnis des Experiments war, dass die elektrische Stimulation dieser Gehirnstrukturen bei den Ratten ein so großes Wohlbefinden auslösten, dass sie so oft wie in der Versuchsanord- nung möglich, den Hebel zur Aktivierung der Glücksgefühle betätigten und da- bei sogar auf Nahrung oder Fortpflanzung verzichteten. Analoge Experimente mit menschlichen Probanden kamen zu ähnlichen Ergebnissen.57
Eine zentrale Rolle im Belohnungssystem spielt die Kernstruktur des sogenann- ten „Nucleus accumbens“. Dieser gehört zum mesolimbischen Dopaminsystem und ist ein Teilbereich des emotionssteuernden limbischen Systems. Unter Be- lohnung versteht man Stimuli, die ein Verhalten positiv verstärken können. Die Wirkung ist dabei abhängig von gelernten Erfahrungen, dem situativen Kontext, der Zeitdauer und der Stärke der Belohnung.58 Wird der Mensch nun in lustvolle belohnende Erwartung in Form von z. B. gutem Essen, guter Musik, oder Sex versetzt, wird der Nervenbotenstoff Dopamin freigesetzt, der dazu motiviert die Belohnung zu konsumieren. Die eigentliche Belohnung wird dann letztendlich erst über Endorphine, die sogenannten Glückshormone im Gehirn, ausgelöst.59 Ergebnisse aus Studien der Consumer Neuroscience zeigen, dass das Beloh- nungssystem nicht ausschließlich durch primäre Stimuli der Grundbedürfnisse des Menschen aktiviert wird sondern auch durch attraktive Werbung, Preisre- duktionen, attraktive Gesichter und Statussymbole wie z. B. ein Sportwagen, eine Aktivierung im Belohnungszentrum erfolgen kann (Vgl. Kapitel 4.1.1).60
3.3.2 Bestrafung
Als Gegenspieler zu Belohnung stellt die Kodierung von Bestrafung im mensch- lichen Gehirn ein weiteres wichtiges Konstrukt hinsichtlich des Konsumenten- verhaltens dar. Bestrafende Reize werden dabei als Stimuli definiert, die zu ei- nem Vermeidungs- bzw. Abwehrverhalten führen. Menschen versuchen dabei in der Regel Energie aufzuwenden, um das Eintreten diese Zustände möglichst zu verhindern. Primäre Reize, die bestrafend bzw. vermeidend wirken können, sind beispielsweise aversive Reize wie körperlicher Schmerz, unangenehme Gerüche oder Ekel. Hirnstrukturen, die mit der Wahrnehmung von Bestrafung zusammenhängen, sind unter anderem Teile des Großhirns (Vorderlappen) sowie der Mandelkern und die Inselrinde. Einige Hirnareale überschneiden sich dabei mit denen des Belohnungssystems, so dass eine genaue Abgrenzung bisher noch nicht möglich ist. Beispielsweise dekodiert der orbitofrontale Cortex des Frontallappens des Gehirns nicht nur den Belohnungswert sondern gleich- zeitig auch den negativen Wert eines eingehenden Reizes. Das Gehirnareal, das jedoch überwiegend mit der Verarbeitung von aversiven Reizen in Verbin- dung gebracht wird, ist die Inselrinde, die als eingesenkter Teil ihren Sitz in der Großhirnrinde hat. Die genaue Arbeitsweise der Inselrinde ist jedoch bis heute noch weitgehend unerschlossen. Studienergebnisse der Consumer Neuro- science zeigen jedoch, dass sie an der Vorhersage von Verlusten wie z. B. der Wahrnehmung hoher Preise und an der Verarbeitung von ungerechten Angebo- ten beteiligt ist. Weiter zeigen Studienergebnisse, dass ebenso ökonomische Reize wie z. B. ungerechte Angebote, Geldverluste und hohe Preise neuronale Bestrafungsmechanismen auslösen können.61
3.3.3 Entscheidung
Eine Entscheidung definiert sich als die Auswahl aus einem Set an Alternativen, welche zuvor situationsabhängig nach ihrem möglichen Wert und Nutzen be- wertet wurden.62 Obgleich eine exakte Differenzierung der unterschiedlichen Mechanismen innerhalb des Entscheidungsprozesses nicht möglich ist, so gibt es dennoch vier wesentliche Aspekte die den Entscheidungsprozess betreffen. Eine wichtige Gehirnstruktur im Entscheidungsprozess stellt der sich im Vorder- lappen befindliche präfrontale Cortex der Großhirnrinde dar (Vgl. Abb. 9 Seite 26). Im Zusammenspiel mit den emotionalen Strukturen des Belohnungs- und Bestrafungssystems und der Moderation durch das anteriore cingulum63 in Form von Vorentscheidungen (Vgl. Kapitel 4.1.3 Somatische Marker) sowie in- dividuellen Rahmenbedingungen (Vgl. Kapitel 4.1.3 Framing Effekt), laufen hier alle wichtigen Informationen für eine Entscheidungsfindung zusammen.
Nachfolgende Abb. 8 zeigt die vier am Entscheidungsprozess beteiligten Komponenten des Gehirns:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 8: Die wesentlichen neuralen Treiber der Kaufentscheidung.
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Kenning, P. 2010, S. 43.
(1) Der dem Produkt bzw. der Marke vom Gehirn beigemessene Belohnungswert (Belohnungssystem). (2) Der in der Kaufentscheidung emp- fundene Preisschmerz (Bestrafung, Inselrinde). (3) Integration der Impulse des Belohnungssystems und Inselrinde in die Exekutionskontrolle (präfrontaler Cortex). Diese wird u.a. durch situative Frames (Framing-Effekt) und Vorent- scheidungen (Somatische Marker) (4) moderiert (Anteriores cingulum) und be- einflusst.64
Der präfrontale Cortex als Exekutionskontrolle selbst kann, wie nachfolgende Abb. 9 auf der Folgeseite zeigt, in drei Bereiche gegliedert werden, die mit un- terschiedlichen Funktionen im Entscheidungsprozess assoziiert werden kön- nen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 9: Präfrontaler Cortex als Teilbereich des Vorderlappens
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Bear, M. F. et al. 2009, S. 511.
Wie bereits in den vorangegangenen Ausführungen erwähnt, ist der orbitofron- tale Cortex eng mit dem des Belohnungs- und Bestrafungssystem verknüpft und dabei häufig mit der Analyse und Auswertung eingehender Informationen assoziiert. Der Bereich des dorsolateralen Cortex ist hauptsächlich in rational kognitive Vorgänge involviert. So spielt zum Beispiel diese Hirnregion eine Rolle für die Zahlungsbereitschaft der Konsumenten. Consumer Neuroscience Stu- dien zur Folge kann hier interessanterweise auch eine reduzierte Aktivierung gemessen werden, wenn Konsumenten Entscheidungen treffen, die ihre Lieb- lingsmarke beinhalten (Vgl Kapitel 4.1.1 kortikale Entlastung). Der ventromedia- le Cortex besitzt eine enge Verknüpfung mit dem Mandelkern sowie dem Hip- pocampus und scheint bedeutsam für die Integration von Emotionen in den Entscheidungsprozess zu sein. Ebenfalls kann eine Aktivierung in diesem Be- reich damit zusammenhängen, wie leicht sich Konsumenten durch Markenin- formationen beeinflussen lassen. Dazu wiederholten Koenigs und Tranel (2007)65 die zu Beginn in der Einleitung erwähnte Coca-Cola-Studie von McClu- re et al. (2004) mit Personen, die Schädigungen im Bereich des ventromedialen Cortex aufwiesen. Im Ergebnis zeigte sich, dass die Entscheidung der Proban- den - im Gegensatz zur der eingangs erwähnten Studie von McClure et al (2004) - nicht stark von der Markeninformation beeinflusst wird.66
Bei beiden zuvor genannten Coca-Cola Studien kam die Methode der funktio- nellen Magnetresonanz Tomografie (fMRT) zum Einsatz. Für ein besseres Ver- ständnis der Methoden der Hirnforschung soll der nachfolgende Kapitelpunkt 3.4 einen groben Überblick über die relevanten Methoden der Hirnforschung geben.
3.4 Methoden der Hirnforschung
Die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse zum Konsumentenverhalten sind maßgeblich darauf zurückzuführen, dass durch den gegenwärtigen technischen Fortschritt immer neuere Untersuchungsmethoden eingesetzt werden können. Die heute existierenden Verfahren lassen sich in zwei Kategorien einteilen (Vgl. Abb. 10). Auf der einen Seite die elektrophysiologischen Verfahren und auf der anderen Seite die bildgebenden Verfahren.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 10: Messmethoden der Hirnforschung
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Peters, T./Ghadiri, A. 2011, S. 36.
[...]
1 Vgl. Monyer, H. et al. 2004, S. 30ff.
2 Vgl. Stern.de GmbH (Hrsg.) 2012; Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH (Hrsg.) 2012.
3 Wissenschaftlich veröffentlicht jedoch erst 2004.
4 Vgl. McClure, S. M. et al. 2004, S. 379ff.
5 Vgl. The Lancet (Hrsg.) 2004, S. 71.
6 Vgl. Zaltman, G. 2003, S. 3.
7 Vgl. Scheier, C./Held, D. 2012a, S. 18.
8 Vgl. Nisbett, R. E./Wilson, T. D. 1977, S. 231ff.
9 Above-the-line Ausgaben 2012 in Deutschland in Höhe von 536,59 (in Mio. EUR) (Vgl. Statista GmbH (Hrsg.) 2013).
10 Vgl. Christensen, C. M. et al. 2005, S. 70.
11 Vgl. Häusel, H. G. 2012b, S. 201ff.
12 Vgl. Häusel, H. G. 2012b, S. 12.
13 Eigene Recherche Google-Suchmaschine, Stand 04.02.2012.
14 Vgl. Rampl, L. V. et al. 2011, S. 32.
15 Vgl. Meffert, H. et al. 2012, S. 22.
16 Vgl. Camerer, C. et al. 2005, S. 9ff.
17 Vgl. Schilke, O./Reimann, M. 2007, S. 249.
18 Vgl. Reimann, M./Weber, B. 2011, S. 5f.
19 Vgl. Bauer, H. H. et al. 2006, S. 3.
20 Vgl. Schilke, O./Reimann, M. 2007, S. 249ff.
21 Vgl. Reimann, M./Weber, B. 2011, S. 5ff.
22 Vgl. Camerer, C. et al. 2005, S. 16.
23 Vgl. Camerer, C. et al. 2005, S. 16ff.
24 Vgl. Peters, T./Ghadiri, A. 2011, S. 13.
26 Vgl. Häusel, H. G. 2012a, S. 19.
27 Vgl. Kenning, P. et al. 2007, S. 57.
28 Vgl. Häusel, H. G. 2012a, S. 19.
29 Vgl. Scheier, C./Held, D. 2012a, S. 25ff.
30 Vgl. Kandel, E. R. 1996, S. 13ff.
31 Vgl. Deutscher Bundestag (Hrsg.) 2008, S. 5.
32 Vgl. Deutscher Bundestag (Hrsg.) 2008, S. 12.
33 Vgl. Könneker, C. 2006, S. 78.
34 Vgl. Deutscher Bundestag (Hrsg.) 2008, S. 12ff.
35 Für ein detailliertes Verständnis der einzelnen nachfolgenden Disziplinen vgl. Kandel, E. R. et al. 1996; Gassen, H. G. 2008; Ewert, J. P. 1998; Deutscher Bundestag (Hrsg.) 2008.
36 Vgl. Dambeck, H. 2005.
37 Vgl. Häusel, H. G. 2012a, S. 28ff.
38 Vgl. Häusel, H. G. 2012a, S. 31f.
39 Vgl. Häusel, H. G. 2012a, S. 32.
40 Die Zahl ist in der Literatur von 50 - 100 Milliarden Nervenzellen schwankend, öfter jedoch 100 Milli- arden. Die Nervenzellen sind wiederum über 100 Billionen (1012 ) Kontaktstellen miteinander verbunden.
41 Gassen, H. G. 2008, S. 8.
42 Vgl. Peters, T./Ghadiri, A. 2011, S. 25f.
43 Vgl. Bruhn, M./Köhler, R. 2010, S. 22.
44 Vgl. Gassen, H. G. 2008, S. 39.
45 Vgl. Kötter, R./Meyer, N. 1992, S. 105ff.
46 Vgl. Gassen, H. G. 2008, S. 35ff.
47 Vgl. Gassen, H. G. 2008, S. 34f.
48 Vgl. Roth, G. 2007, S. 45ff; Gassen, H. G. 2008, S. 38f.
49 Vgl. Roth, G. 2007, S. 45ff; Gassen, H. G. 2008, S. 38f.
50 Diese fünf Bereiche werden weiter in ihrer Gesamtheit in die sogenannten 52 Brodmann-Areale subsumiert (Vgl. Kandel, E. R. et al. 1996, S. 15).
51 Der funktionelle Akt des Gehirns, ein kohärentes Abbild der Umgebung aus unterschiedlichen sensorischen Informationen zu erstellen, ist bis heute noch nicht erschlossen und wird als Bindungsproblem bezeichnet (Vgl. Kandel, E. R. et al. 1996, S. 373f).
52 Vgl. Gassen, H. G. 2008, S. 29ff.
53 Vgl. Gassen, H. G. 2008, S. 39.
54 Vgl. Hubert, M./Kenning, P. 2011, S. 208ff.
55 Vgl. Gassen, H. G. 2008, S. 133ff.
56 Vgl. Olds, J./Milner, P. 1954, S. 421ff.
57 Vgl. Kirsch, P./Gruppe, H. 2007, S. 277; Heath, R. G. 1963, S. 571ff.
58 Vgl. Hubert, M./Kenning, P. 2011, S. 208.
59 Vgl. Gassen, H. G. 2008, S. 133ff.
60 Vgl. Hubert, M./Kenning, P. 2011, S. 209.
61 Vgl. Hubert, M./Kenning, P. 2011, S. 209f.
62 Vgl. Hubert, M./Kenning, P. 2011, S. 210.
63 Das anteriore cingulum ist ein Teil des limbischen Systems und spielt eine wesentliche Rolle als Mode- rator von Entscheidungsfindungen (Vgl. Bush, G. et al. 2000, S. 215ff; Deppe, M. et al. 2007, S. 1119ff).
64 Vgl. Kenning, P. 2010, S. 42f.
65 Vgl. Koenigs, M./Tranel, D. 2007, S. 1ff.
66 Vgl. Hubert, M./Kenning, P. 2011, S. 210f.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Neuromarketing?
Neuromarketing nutzt neurowissenschaftliche Methoden, um unbewusste Prozesse bei Kaufentscheidungen und Markenwahrnehmungen im Gehirn zu untersuchen.
Was zeigte das berühmte Coca-Cola-Pepsi-Experiment?
Es zeigte, dass Markenbekanntheit emotionale Gehirnareale aktiviert, die das rationale Geschmacksempfinden bei der Entscheidung überlagern.
Welche Rolle spielt das limbische System beim Konsum?
Das limbische System steuert Emotionen und Motive; es ist der Sitz des „Autopiloten“, der einen Großteil unserer Kaufentscheidungen unbewusst trifft.
Was sind die „4 N's“ im Marketing?
Das Konstrukt umfasst Neuropricing, Neuroproducting, Neuropromotion und Neurodistribution zur Optimierung der Marketing-Mix-Bereiche.
Welche Methoden nutzt die Hirnforschung für das Marketing?
Eingesetzt werden bildgebende Verfahren wie die funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT), EEG, MEG und die Positronen-Emissions-Tomografie (PET).
- Citar trabajo
- Andreas Schmidt (Autor), 2013, Neurowissenschaftliche Erkenntnisse zum Konsumentenverhalten und ihre Implikationen für das Marketing, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210726