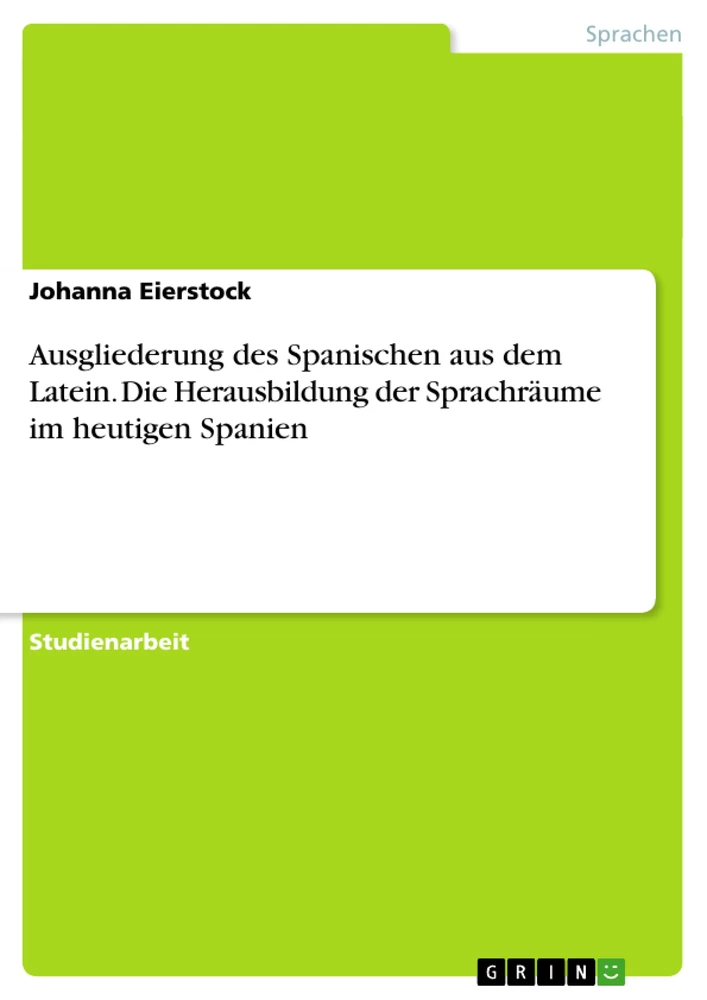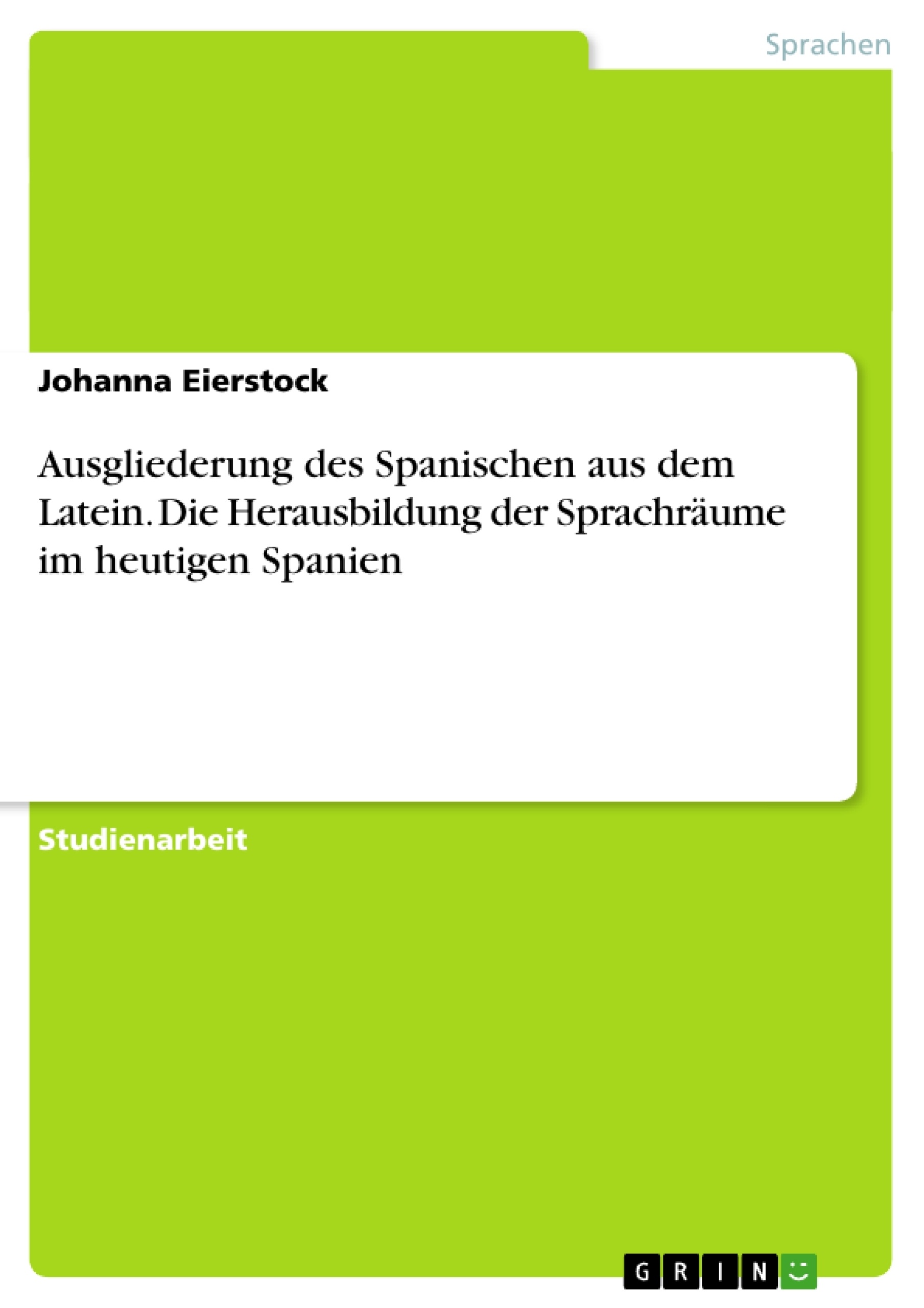Wie, wann und vor allem warum entstehen Sprachen/ Sprachräume?
Das ist eine alte Frage, die sich auch schon u.a. Dante in „De vulgari eloquentia“ (lat.: „Über die Beredsamkeit in der Volkssprache“) in der Renaissance (ca. 15.-17. Jhd.) gestellt hat. Die Ansätze waren meist monistisch und wurden erst später miteinander kombiniert.
In der folgenden Arbeit handelt es sich vorwiegend um das „Warum“, also um die allgemeinen Voraussetzungen und eigentlichen Ursachen für die sogenannte Ausgliederung (= Entstehung) von Sprachräumen, da man den Zeitpunkt nicht genau bestimmen kann, weil Sprachen nach Johannes Kabatek und Claus Pusch kein Geburtsdatum haben. Außerdem gehen die Meinungen ab wann eine Sprache eine Sprache ist, weit auseinander, wie z.B. nach Wright erst ab der Verschriftung oder nach Ferguson bereits mit dem Ender der Diglossie. Die Antwort auf das „Wie“ dreht sich eher um die historisch-administrativen Grenzen und die areale Ausgliederung, was den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.
Hauptsächlich orientiere ich mich an dem österreichischen Sprachwissenschaftler Arnulf Stefenelli und seinen „Thesen zur Entstehung und Ausgliederung der romanischen Sprachen“.
Besonderes Augenmerk wird auf die innerlateinische regionale Differenzierung auf der Grundlage des Latein und Vulgärlatein gelegt.
Da diese Hausarbeit im Rahmen des Proseminares „Spanische Sprachgeschichte“ geschrieben wird, geht es im Folgenden nun um das Herausbilden der Sprachräume im heutigen Spanien.
Zu Beginn gebe ich einen Überblick über den historischen Hintergrund und stelle das Modell Peter Kochs, das ein prototypisches Phasenmodell der romanischen Sprachgeschichte darstellt, vor.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung: Wie, wann und vor allem warum entsteht eine Sprache?
2. Hauptteil
2.1 Historischer Hintergrund
2.2 Entstehung romanischer Idiome und eine prototypsiche romanische Sprachgeschichte nach Koch
2.3 Thesen zur Entstehung und Ausgliederung der romanischen Idiome
2.3.1 Diachronische und diasystematische Variation des Latein und Vulgärlatein als Grundlage der romanischen Sprachen
2.3.2 Innerlateinische regionale Differenzierung als Folge divergierender Bedingungen des Romanisierungsprozesses
a) Chronologie und Intensität der Romanisierung
b) Soziale und regionale Herkunft der Romanisierungsträger
2.3.3 Überblick über weitere wichtige Thesen
3. Zusammenfassung: Multikausalität
4. Bibliographie
5. Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung: Wie, wann und vor allem warum entsteht eine Sprache?
Wie, wann und vor allem warum entstehen Sprachen/ Sprachräume?
Das ist eine alte Frage, die sich auch schon u.a. Dante in „De vulgari eloquentia“ (lat.: „Über die Beredsamkeit in der Volkssprache“)[1] in der Renaissance (ca. 15.-17. Jhd.) gestellt hat. Die Ansätze waren meist monistisch und wurden erst später miteinander kombiniert.
In der folgenden Arbeit handelt es sich vorwiegend um das „Warum“, also um die allgemeinen Voraussetzungen und eigentlichen Ursachen für die sogenannte Ausgliederung (= Entstehung) von Sprachräumen, da man den Zeitpunkt nicht genau bestimmen kann, weil Sprachen nach Johannes Kabatek und Claus Pusch kein Geburtsdatum haben.[2] Außerdem gehen die Meinungen ab wann eine Sprache eine Sprache ist, weit auseinander, wie z.B. nach Wright[3] erst ab der Verschriftung oder nach Ferguson[4] bereits mit dem Ende der Diglossie. Die Antwort auf das „Wie“ dreht sich eher um die historisch-administrativen Grenzen und die areale Ausgliederung, was den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.
Hauptsächlich orientiere ich mich an dem österreichischen Sprachwissenschaftler Arnulf Stefenelli und seinen „Thesen zur Entstehung und Ausgliederung der romanischen Sprachen“.[5]
Besonderes Augenmerk wird auf die innerlateinische regionale Differenzierung auf der Grundlage des Latein und Vulgärlatein gelegt.
Da diese Hausarbeit im Rahmen des Proseminares „Spanische Sprachgeschichte“ geschrieben wird, geht es im Folgenden nun um das Herausbilden der Sprachräume im heutigen Spanien.
Zu Beginn gebe ich einen Überblick über den historischen Hintergrund und stelle das Modell Peter Kochs[6], das ein prototypisches Phasenmodell der romanischen Sprachgeschichte darstellt, vor.
Bei dieser Konzeptualisierung ist die Zeit vom Beginn der Romanisierung, über die Diglossiesituation bis hin zum Ende der vertikalen Kommunikation für die Entstehung eines Sprachraumes von großer Bedeutung.
2. Hauptteil
2.1 Historischer Hintergrund
Wichtig für das Verständnis zur Ausgliederung von Sprachen ist der historische Hintergrund, da die Geschichte Gründe und Ausgangssituationen liefert, die dann zur Entstehung von Sprachen führen. So stellen z.B. die Romanisierung von 218 v. Chr. – 19 n. Chr. mit zwei Romanisierungsströmen und auch die Einteilung der Regionen/Provinzen um 15 v. Chr. auf der Iberischen Halbinsel Teilfaktoren dar und tragen somit zur Ausgliederung bei.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Zeitstrahl einer romanischen Sprachgeschichte
Natürlich gab es vor der Romanisierung bereits andere Völker, wie Karthager, Iberer und Kelten, die dort siedelten. Auch während und nach der Dezentralisierung, d.h. Verlust von Ansehen und Macht Roms, v. a. durch die „Constitutio Antoniana“ im Jahre 212 n. Chr., die allen im Römischen Reich frei Lebenden das röm. Bürgerrecht verlieh, bis zum Verfall des Römischen Reiches 476 n. Chr., eroberten immer wieder andere Völker, wie die Westgoten 507 n. Chr. oder Araber 711 n. Chr. das heutige Spanien.
Durch die Dezentralisierung von ca. 100 – 400 n. Chr., gab es nun keine Zentralmacht „als einigende Klammer“[7] mehr und die Bedingungen für die Entstehung von Einzelsprachen waren gegeben.
Bedeutungstragend war die Restauration sowohl durch die Karolingische Reform 800 n. Chr. durch die die Leseaussprache reformiert und eine Art Reinigung der Distanzsprache von nähesprachlichen Elementen erreicht werden wollte, als auch als Reaktion darauf das Konzil von Tours 813 n. Chr., auf dem beschlossen wurde z. B. in Predigten die Volkssprache zu verwenden, damit alle es verstehen können. Durch die Karolingische Reform waren nämlich die sprachlichen Divergenzen und das Nichtfunktionieren der vertikalen Kommunikation in das Bewusstsein der Bildungseliten gedrungen. Diese beiden Ereignisse in Gallien können als Vorreiter für andere Teile der Romania und im Falle Hispaniens für die Reformierung der lateinischen Vorleseaussprache 1050 n. Chr. und das Konzil von Burgos 1080 n. Chr. gesehen werden.
2.2 Entstehung romanischer Idiome und eine prototypsiche romanische Sprachgeschichte nach Koch 2003
Wie in der Einleitung bereits gesagt, sind für diese Arbeit hauptsächlich Punkt I „Romanisierung“ und Punkt II „Ende der vertikalen Kommunikation“ von Bedeutung, da diese die Basis für eine Ausgliederung einer Sprache sind. Anfangs gibt es eine elaborierte Mündlichkeit, die dann standardisiert wird.[8]
Zu Beginn der Romanisierung war das Sprechlatein/Vulgärlatein strikt vom Schriftlatein, dem klassischen Latein, getrennt, eine sogenannte Diglossiesituation.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Phasen einer prototypischen romanischen Sprachgeschichte (idealisiert)
Fergusons enger Diglossiebegriff, im Gegensatz zu Lüdis[9] erweitertem Begriff, der den Bilingualismus mit einbezieht, beschreibt die Situation folgendermaßen: In der relativ stabilen Situation gibt es eine low variety, den Nähebereich, und eine high variety, den Distanzbereich einer Sprache, in diesem Falle des Lateinischen. Die „L-Varietät“, das Sprech-/Vulgärlatein, wird als Muttersprache erlernt und ist im Gegensatz zur prestigebesetzten „H-Varietät“, das hauptsächlich durch institutionelle Erziehung erlernt werden muss, nicht standardisiert. Zwischen den beiden Varietäten herrscht eine komplementäre Funktionsverteilung, da die high variety für die schriftliche und formelle Kommunikation und im Gegensatz zur low variety nicht in der normalen spontanen Konversation verwendet wird.[10]
Allmählich entsteht ein Spannungsverhältnis zwischen der Nähe- und der Distanzsprache in der romanisch-lateinischen Diglossie, wobei der Nähebereich den Distanzbereich unbewusst beeinflusst. Erreichen diese Spannungen ihren Höhepunkt kommt es zum Zerbersten des Varietätenraumes, nicht aber des Kommunikationsraumes und somit zum Ende der Diglossie ca. 900 n. Chr. und später zum Ende der vertikalen Kommunikation ca. 1080 n. Chr. mit dem Konzil von Burgos.
Nach Banniard dann, wenn die phonische Kommunikation innerhalb des Distanzbereiches zwischen schriftlateinkundigen litterati und nur nähesprachlich bewanderten illitterati (nur mit passiven Lateinkenntnissen) z. B. beim Vorlesen oder Vortragen in Predigten nicht mehr funktioniert.
Die Distanzkommunikation erreicht also den Nähesprecher nicht mehr.[11] Es ist somit ein Bewusstsein entstanden, dass zwei verschiedene Sprachen existieren und sich die Varietät des Lateinischen, die romanische Volkssprache zu einer eigenständigen romanischen Sprache entwickelt hat.
Mit dem Ende der vertikalen Kommunikation ist auch III „Anfänge der Verschriftung der Volkssprache“ verbunden, da ab dem Zeitpunkt des Erkennens, dass die Verständigung nicht mehr funktioniert, das volksprachliche romanische Idiom verschriftet werden muss.
2.3 Thesen zur Entstehung und Ausgliederung der romanischen Idiome
(nach Arnulf Stefenelli)
Um die Entstehung der Sprachräume erklären zu können, orientiere ich mich an den Aufsatz „Thesen zur Entstehung und Ausgliederung der romanischen Sprachen“ von Arnulf Stefenelli, in dem er Thesen verschiedener Sprachwissenschaftler untersucht und den Wahrheitsgehalt überprüft.
[...]
[1] Philosophische Werke (2007): Dante, Alighieri : De vulgari eloquentia I – Über die Beredsamkeit in der Volkssprache, Hamburg: Meiner.
[2] Kabatek, Johannes/Pusch, Claus D. (2011): Spanische Sprachwissenschaft. Eine Einführung, Tübingen: Narr.
[3] Wright, Roger (1989 [1982]): Latín tardío y romance temprano en España y la Francia Carolingia, Madrid: Gredos.
[4] Ferguson, Charles A. (1959): „Diglossia“, in Word 15/2, 325-340, New York.
[5] Stefenelli, Arnulf (1996): „Thesen zur Entstehung und Ausgliederung der romanischen Sprachen“, in: LRL II/1, Tübingen: Niemeyer, 73-90.
[6] Koch, Peter (2003): „ Romanische Sprachgeschichte und Varietätenlinguistik “, in: Ernst u.a. (Hrsg.) Romanische Sprachgeschichte. Ein internationales Handbuch zur Geschichte der romanischen Sprachen, Bd.1 , Berlin/New York: de Gruyter, 102-124.
[7] Euler, Wolfram (2005): Vom Vulgärlatein zu den romanischen Einzelsprachen: Überlegungen zur Aufgliederung von Protosprachen, Praesens Verlag: Wien.
[8] Koch, Peter (2003): „ Romanische Sprachgeschichte und Varietätenlinguistik “, in: Ernst u.a. (Hrsg.) Romanische Sprachgeschichte. Ein internationales Handbuch zur Geschichte der romanischen Sprachen, Bd.1 , Berlin/New York: de Gruyter, 102-124.
[9] Lüdi, Georges (1990): „Diglossie und Polyglossie“ in: LRL V/1, Tübingen: Niemeyer, 307-334.
[10] Ferguson, Charles A. (1959): „Diglossia“, in Word 15/2, 325-340, New York.
[11] Banniard, Michel (1992): Viva voce. Communication écrite et communication orale due IVe au IXe siècle en occident latin, Paris: Institut des Etudes Augustiniennes.
Häufig gestellte Fragen
Wie entstand die spanische Sprache aus dem Lateinischen?
Durch die regionale Differenzierung des Sprechlateins (Vulgärlatein) während und nach der Romanisierung der Iberischen Halbinsel.
Was bedeutet "Diglossie" in der Sprachgeschichte?
Es beschreibt ein Nebeneinander von einer "hohen" Varietät (Schriftlatein) und einer "niedrigen" Varietät (Volkssprache), die unterschiedliche Funktionen erfüllen.
Welchen Einfluss hatte die Romanisierung auf die Sprachräume?
Die Chronologie und Intensität der Romanisierung sowie die Herkunft der Siedler bestimmten die regionalen Unterschiede des Lateins in Spanien.
Wann endete die vertikale Kommunikation zwischen Latein und Romanisch?
Man geht davon aus, dass um 1080 n. Chr. (Konzil von Burgos) das Bewusstsein für zwei getrennte Sprachen endgültig gefestigt war.
Warum gibt es kein genaues "Geburtsdatum" für das Spanische?
Sprachwandel ist ein fließender Prozess; die Abgrenzung hängt davon ab, ob man die Verschriftung oder das Ende der Diglossie als Kriterium wählt.
- Citar trabajo
- Johanna Eierstock (Autor), 2012, Ausgliederung des Spanischen aus dem Latein. Die Herausbildung der Sprachräume im heutigen Spanien, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210737