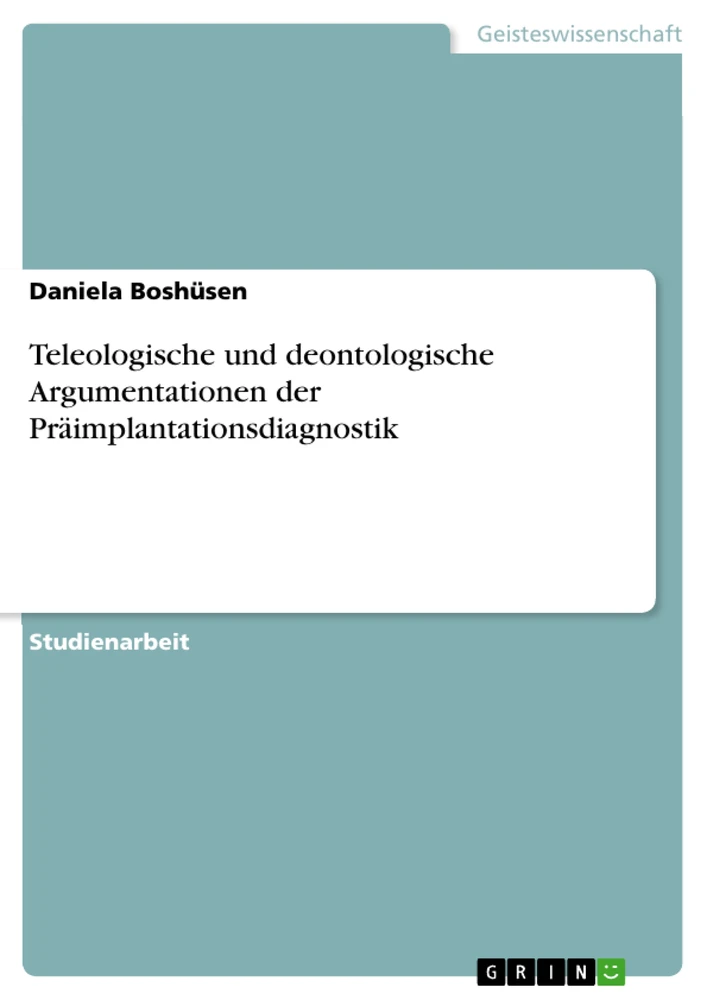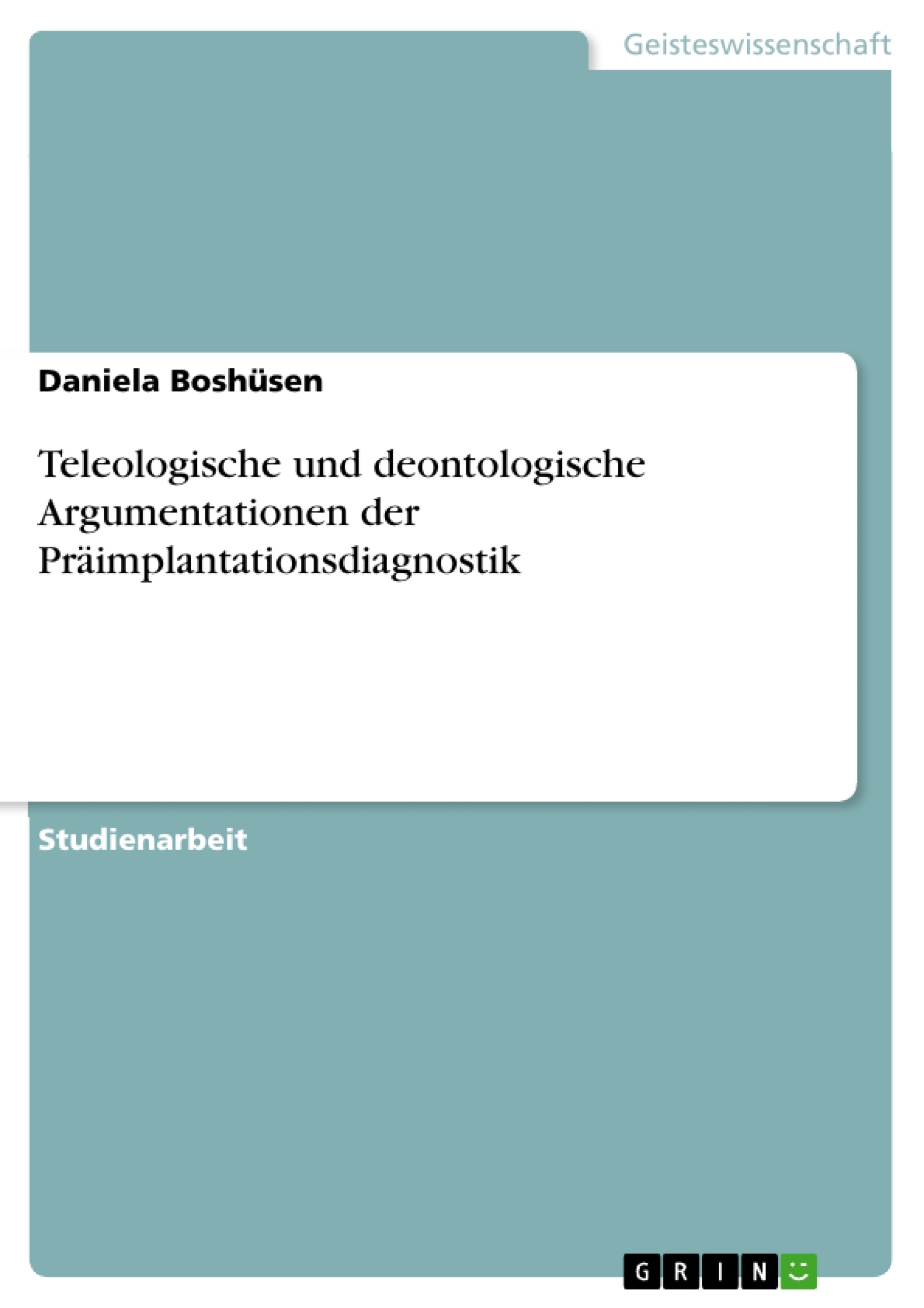Bis zum 7.07.2011 war das Verfahren der Präimplantationsdiagnostik in Deutschland verboten. Deutschland hatte bis zu diesem Tag eines der restriktivsten Schutzgesetze für menschlichen Embryonen weltweit, dass auf dem Embryonenschutzgesetz von 1991 fußte.
In diesem sind die Instrumentalisierung des menschlichen Embryos zu Forschungs- oder nicht reproduktiven Zwecken, sowie das therapeutische und reproduktive Klonen und die Präimplantationsdiagnostik verboten.
Man sah die Gefahr als zu groß an, dass bspw. die Zulassung der Präimplantationsdiagnostik langfristige Folgen für das Zusammenleben der Menschen haben könnte, denn die Einstellung der Menschen zu Krankheiten, Behinderungen und Unvollkommenheit hätte sich verändern können.
Am 7.07.2011 wurde im Bundestag für die eingeschränkte Präimplantationsdiagnostik abgestimmt.
Paare, die die Veranlagung für schwere Erbkrankheiten in sich tragen oder bei denen die Gefahr einer Fehl-/ Totgeburt hoch ist, sollen die Erlaubnis bekommen die PID durchführen zu lassen. Aber selbst mit dieser Beschränkung der PID auf schwerste genetische Belastungen, kann es trotzdem noch zu Konflikten kommen, da eine ethisch höchst fragwürdige Auswahl von Krankheiten getroffen werden müsste.
Die Frage nach dem richtigen Umgang mit menschlichen Embryonen und die Definition des Beginns des menschlichen Lebens sind höchst brisante Themen, die einer genaueren Betrachtung bedürfen.
In dieser Arbeit soll das Verfahren der PID auf seine Berechtigung und seine Durchführbarkeit hin untersucht werden. Des Weiteren wird versucht, die Position der Kirche gegenüber diesem Verfahren zu verdeutlichen und die teleologischen und deontologischen Argumentationslinien der christlichen Ethik herauszuarbeiten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Definition von Teleologie
- Die Definition von Deontologie
- Das Recht auf ein Kind
- Teleologische Argumentationen
- Deontologische Argumentationen
- Die Menschenwürde und das Recht auf Leben
- Teleologische Argumentationen
- Deontologische Argumentationen
- Richtige Entscheidung PID?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verfahren der Präimplantationsdiagnostik (PID) auf seine Berechtigung und Durchführbarkeit. Sie beleuchtet die Position der Kirche gegenüber diesem Verfahren und arbeitet die teleologischen und deontologischen Argumentationslinien der christlichen Ethik heraus.
- Das Recht auf ein Kind und die Bedeutung der Familiengründung
- Die ethischen und rechtlichen Aspekte der PID
- Die Teleologie und Deontologie als ethische Argumentationsansätze
- Der Schutz des menschlichen Embryos und die Definition des Lebensbeginns
- Die Position der Kirche und ihre ethischen Argumente gegen die PID
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung bietet einen historischen Überblick über die Entwicklung der Präimplantationsdiagnostik in Deutschland und erläutert die ethischen und rechtlichen Debatten, die mit dieser Technik verbunden sind.
- Die Definition von Teleologie: Dieses Kapitel erklärt die teleologische Argumentationslinie, die auf der Bewertung von Handlungsfolgen basiert. Es definiert die Begriffe Güter und Werte und erläutert die Bedeutung der Abwägung von Folgen im ethischen Diskurs.
- Die Definition von Deontologie: Dieses Kapitel beschreibt die deontologische Argumentationslinie, die sich auf die Pflicht und die ethische Bewertung von Handlungen an sich konzentriert. Es erklärt, dass bestimmte Handlungen unabhängig von ihren Folgen als sittlich falsch betrachtet werden können.
- Das Recht auf ein Kind - Teleologische Argumentationen: Dieses Kapitel analysiert die teleologischen Argumente für die Zulässigkeit der PID, die sich auf die Verwirklichung des Rechts auf ein Kind und die Vermeidung von schweren Behinderungen konzentrieren.
- Das Recht auf ein Kind - Deontologische Argumentationen: Dieses Kapitel untersucht die deontologischen Argumente gegen die PID, die sich auf den Schutz des menschlichen Embryos und die ethische Unzulässigkeit der selektiven Embryonenvernichtung konzentrieren.
Schlüsselwörter
Präimplantationsdiagnostik, Teleologie, Deontologie, Menschenwürde, Recht auf ein Kind, Embryonenschutz, christliche Ethik, ethische Argumentation, Lebensbeginn.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Präimplantationsdiagnostik (PID)?
PID ist ein Verfahren zur genetischen Untersuchung eines Embryos vor dessen Einpflanzung in die Gebärmutter, meist um schwere Erbkrankheiten auszuschließen.
Was ist der Unterschied zwischen teleologischer und deontologischer Ethik?
Teleologie bewertet Handlungen nach ihren Folgen (Güterabwägung), während Deontologie Handlungen nach ihrer Übereinstimmung mit festen Pflichten oder Prinzipien bewertet, unabhängig von den Folgen.
Wie beurteilt die Kirche die PID?
Die Kirche lehnt die PID meist ab, da sie den Schutz des Lebens ab der Befruchtung betont und die Selektion von Embryonen als Verstoß gegen die Menschenwürde sieht.
Seit wann ist die PID in Deutschland eingeschränkt erlaubt?
Nach einer Abstimmung im Bundestag am 7. Juli 2011 ist die PID für Paare mit hoher Veranlagung für schwere Erbkrankheiten oder Fehlgeburten unter engen Grenzen zulässig.
Welches Gesetz schützte Embryonen in Deutschland ursprünglich?
Das Embryonenschutzgesetz von 1991 bildete die restriktive Grundlage, die PID und Klonen verbot.
- Citar trabajo
- Daniela Boshüsen (Autor), 2012, Teleologische und deontologische Argumentationen der Präimplantationsdiagnostik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210829