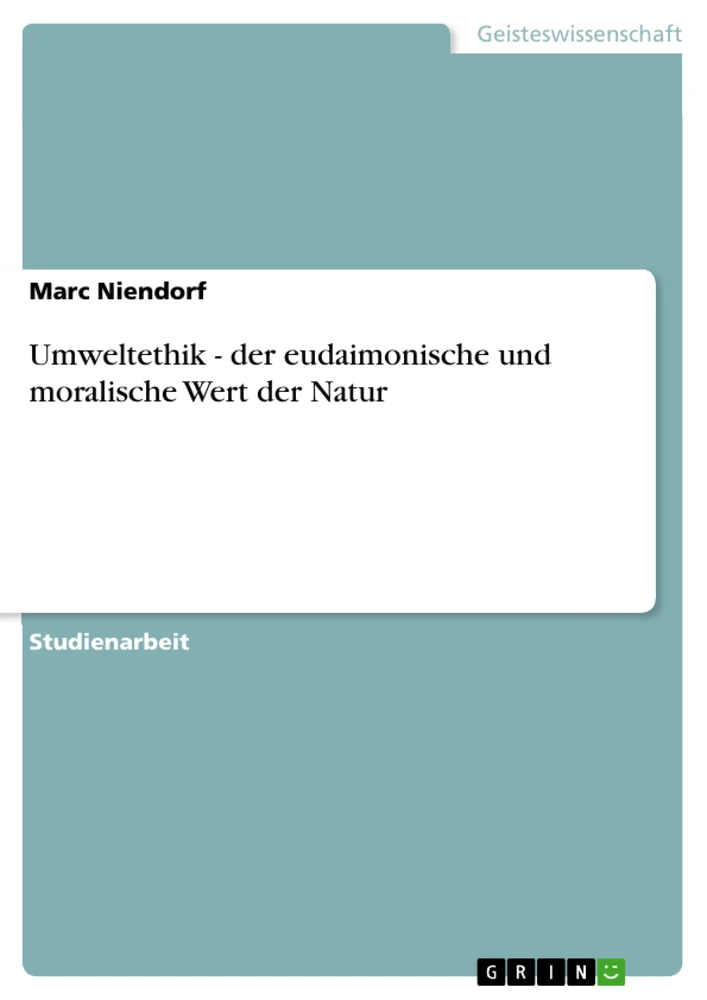Das Thema dieser Arbeit ist die Umweltethik. Die Umweltethik fragt nach dem moralisch richtigen Umgang des Menschen mit seiner natürlichen Umwelt. Eine Frage, die angesichts der derzeitigen Diskussion um Wasserknappheit, Ressourcenerschöpfung, Artensterben und den Klimawandel besonders aktuell erscheint.
Der Gegenstand dieses relativ jungen Zweiges der Ethik, die Natur, definiert sich dabei wie folgt: Natur (lat. natura von nasci, geboren werden, griech. physis) ist das, was unabhängig vom Menschen aus sich selbst heraus entsteht und entwickelt. Das, was sich aus eigenen Kräften und Gesetzen entfaltet. Demgegenüber steht die Artefaktwelt. Artefakte (von lat. ars, Kunst, Handwerk, und facere, tun) sind menschliche Erzeugnisse, also die kulturell und künstlich bearbeitete Natur.
Die Frage nach dem richtigen Umgang mit der Natur kann man unter zwei Gesichtspunkten stellen. Einmal kann man nach dem eudaimonischen Wert der Natur fragen. Damit ist gemeint, inwieweit die Natur das menschliche Glück befördert.
Und einmal kann man nach einem moralischen Wert der Natur fragen, d.h. inwieweit ist auf das Glück bzw. Heil der Natur selbst zu achten.
Ziel dieser Arbeit ist es diese beiden Gesichtspunkte und ihre Unterpositionen vorzustellen und so ein Rüstzeug in der allgemeinen Naturschutzdebatte zu liefern.
Als Grundlage der Ausarbeitung dient primär die Analyse des gegenwärtigen Standes der Umweltethik von Angelika Krebs in ihrem Aufsatz “Naturethik im Überblick”. Des Weiteren werden die einzelnen Positionen durch konkrete Ansichten ihrer führenden Vertreter ergänzt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Anthropozentrismus und Physiozentrismus
- 3. Der Physiozentrismus
- 3.1 Das pathozentrische Argument
- 3.2 Das teleologische Argument
- 3.3 Das Argument der Ehrfurcht vor dem Leben
- 3.4 Das Naturam-Sequi-Argument
- 3.5 Das theologische Argument
- 3.6 Das Holismus-Argument
- 4. Anthropozentrismus
- 4.1 Das Basic-Needs-Argument
- 4.2 Das Aisthesis-Argument
- 4.3 Das Argument der ästhetischen Kontemplation
- 4.4 Das Design-Argument
- 4.5 Das Heimat-Argument
- 4.6 Das pädagogische Argument
- 4.7 Das Argument vom Sinn des Lebens
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Umweltethik und untersucht den moralisch richtigen Umgang des Menschen mit seiner natürlichen Umwelt. Sie analysiert zwei zentrale Perspektiven: den Anthropozentrismus und den Physiozentrismus, und präsentiert verschiedene Argumente für und gegen beide Positionen. Das Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Debatte um den Naturschutz zu vermitteln.
- Der moralische Wert der Natur
- Anthropozentrische und physiozentrische Positionen im Naturschutz
- Verschiedene Argumentationslinien für und gegen den Naturschutz
- Die Bedeutung von anthropozentrischen Bedürfnissen im Kontext der Natur
- Analyse des gegenwärtigen Standes der Umweltethik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Umweltethik ein und definiert die Begriffe Natur und Artefaktwelt. Sie stellt die zentrale Frage nach dem moralisch richtigen Umgang mit der Natur unter zwei Gesichtspunkten: dem eudaimonischen Wert (Nutzen für das menschliche Glück) und dem moralischen Eigenwert der Natur. Die Arbeit wird als Beitrag zur Naturschutzdebatte positioniert und benennt die Grundlage der Ausarbeitung: Angelika Krebs' Aufsatz "Naturethik im Überblick".
2. Anthropozentrismus und Physiozentrismus: Dieses Kapitel differenziert zwischen Anthropozentrismus (Natur hat nur Wert für den Menschen) und Physiozentrismus (Natur hat Eigenwert). Der Physiozentrismus wird in drei Versionen unterteilt: Pathozentrismus (empfindungsfähige Lebewesen), Biozentrismus (alle Lebewesen) und radikaler Physiozentrismus/Ökozentrismus (gesamte Natur). Die verschiedenen Varianten werden hinsichtlich ihrer egalitären oder hierarchischen Wertung gegenüber dem Menschen diskutiert, wobei auch epistemologische Herausforderungen angesprochen werden (die Schwierigkeit, nicht-menschliches Leiden zu messen).
3. Der Physiozentrismus: Dieses Kapitel präsentiert sechs Argumentationslinien für physiozentrische Positionen. Die ersten drei Argumente erweitern anthropozentrische Moralvorstellungen auf die Natur. Die Argumente vier und fünf versuchen, den absoluten Wert der Natur und ihre Bedeutung für menschliches Handeln zu zeigen. Das sechste Argument fokussiert die moralische Bedeutung der Natur als Ganzes. Jeder der sechs Punkte wird im Detail erläutert und begründet, in Abhängigkeit zu den angesprochenen unterschiedlichen Varianten des Physiozentrismus.
4. Anthropozentrismus: Dieses Kapitel legt sieben anthropozentrische Argumente dar, die die menschlichen Bedürfnisse im Verhältnis zur Natur erläutern. Es beleuchtet verschiedene Aspekte der menschlichen Beziehung zur Natur, z.B. grundlegende Bedürfnisse, ästhetische Erfahrungen, pädagogische Aspekte und den Sinn des Lebens. Jedes Argument wird ausführlich beschrieben und mit Beispielen veranschaulicht. Die Argumente betonen unterschiedliche Facetten des menschlichen Nutzens und der Bedeutung der Natur für das menschliche Wohlbefinden.
Schlüsselwörter
Umweltethik, Anthropozentrismus, Physiozentrismus, Pathozentrismus, Biozentrismus, Ökozentrismus, Naturschutz, Moral, Natur, Eigenwert, menschliche Bedürfnisse, eudaimonischer Wert.
Häufig gestellte Fragen zu: Umweltethik - Anthropozentrismus vs. Physiozentrismus
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Umweltethik und analysiert zwei zentrale Perspektiven im Umgang des Menschen mit der Natur: Anthropozentrismus (Natur hat nur Wert für den Menschen) und Physiozentrismus (Natur hat Eigenwert). Sie präsentiert verschiedene Argumente für und gegen beide Positionen und zielt auf ein umfassendes Verständnis der Naturschutzdebatte ab. Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zu Anthropo- und Physiozentrismus mit detaillierten Argumentationslinien für beide, ein Fazit und ein Glossar wichtiger Begriffe.
Welche Perspektiven werden verglichen?
Der Vergleich konzentriert sich auf den Anthropozentrismus und den Physiozentrismus. Der Physiozentrismus wird weiter unterteilt in Pathozentrismus (empfindungsfähige Lebewesen), Biozentrismus (alle Lebewesen) und Ökozentrismus (gesamte Natur). Die Arbeit untersucht die unterschiedlichen hierarchischen Wertungen des Menschen gegenüber der Natur innerhalb dieser Perspektiven.
Welche Argumente werden für den Physiozentrismus vorgebracht?
Sechs Argumentationslinien werden für physiozentrische Positionen vorgestellt. Diese reichen von der Erweiterung anthropozentrischer Moralvorstellungen auf die Natur über Argumente für den absoluten Wert der Natur bis hin zur Betonung der moralischen Bedeutung der Natur als Ganzes (Holismus). Die Argumente werden im Detail erläutert und in Bezug zu den verschiedenen Varianten des Physiozentrismus gesetzt.
Welche Argumente werden für den Anthropozentrismus vorgebracht?
Sieben anthropozentrische Argumente werden präsentiert, die die menschlichen Bedürfnisse im Verhältnis zur Natur beleuchten. Diese umfassen grundlegende Bedürfnisse, ästhetische Erfahrungen, pädagogische Aspekte und den Sinn des Lebens. Die Argumente betonen verschiedene Facetten des menschlichen Nutzens und der Bedeutung der Natur für das menschliche Wohlbefinden.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Umweltethik, Anthropozentrismus, Physiozentrismus, Pathozentrismus, Biozentrismus, Ökozentrismus, Naturschutz, Moral, Natur, Eigenwert, menschliche Bedürfnisse und eudaimonischer Wert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Anthropozentrismus und Physiozentrismus (differenzierende Betrachtung), detaillierte Argumentation für Physiozentrismus, detaillierte Argumentation für Anthropozentrismus und schließlich ein Fazit. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und eine Auflistung der Schlüsselbegriffe.
Auf welcher Grundlage basiert die Arbeit?
Die Arbeit basiert unter anderem auf dem Aufsatz "Naturethik im Überblick" von Angelika Krebs.
Welche zentrale Frage wird behandelt?
Die zentrale Frage ist, wie der moralisch richtige Umgang des Menschen mit seiner natürlichen Umwelt aussieht, betrachtet unter den Aspekten des eudaimonischen Wertes (Nutzen für menschliches Glück) und des moralischen Eigenwertes der Natur.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit beinhaltet eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, welche die zentralen Inhalte und Argumentationslinien zusammenfasst.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Personen, die sich akademisch mit Umweltethik, Anthropozentrismus und Physiozentrismus auseinandersetzen möchten. Sie dient als umfassende Übersicht der Debatte um den Naturschutz.
- Quote paper
- Marc Niendorf (Author), 2009, Umweltethik - der eudaimonische und moralische Wert der Natur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210831