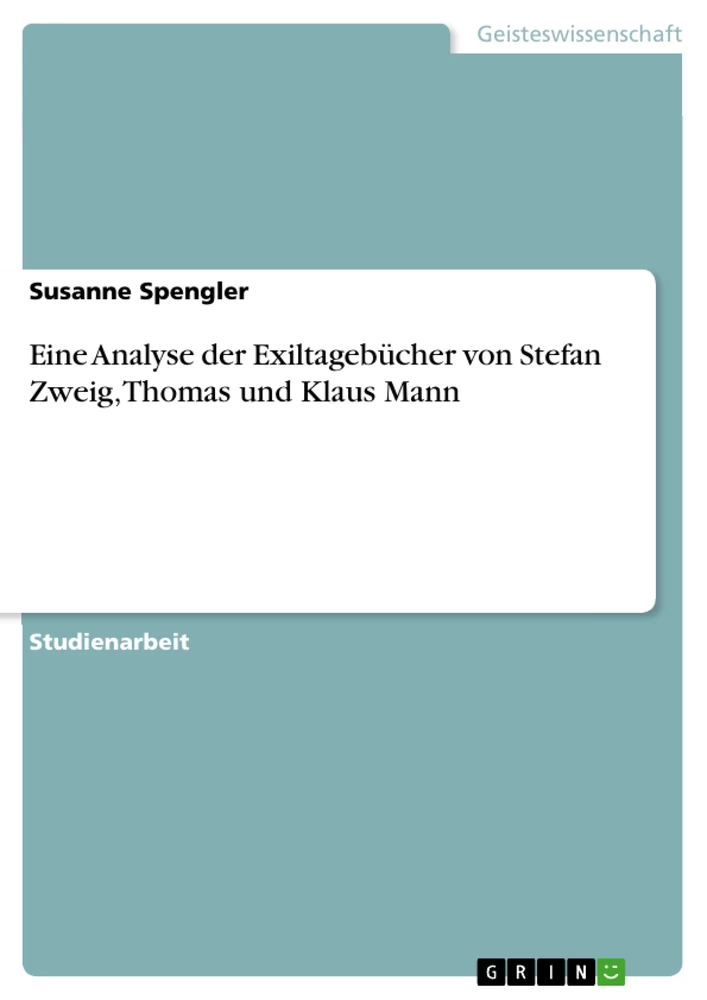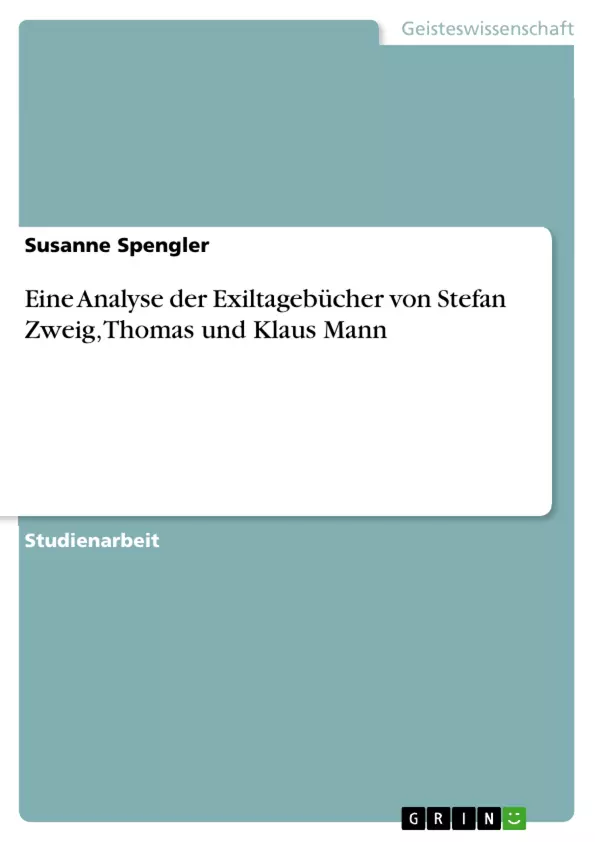Tagebücher wurden und werden aus den verschiedensten Gründen geführt. Dabei gibt es innere und äußere Einflüsse, welche die Entstehung eines Tagebuchs fördern können. Festhalten von Erinnerungen und Gedanken, Langeweile, Selbsterkenntnis oder Recht-fertigungsbedürfnis sind auf der einen Seite Beispiele für eine Motivation von innen heraus. Die Diktaturen des 20. Jahrhunderts sind auf der anderen Seite ein Beispiel für die Motivation von Außen. Denn in Schreckenszeiten, in denen öffentliche Meinungsäußerung gefährlich, sogar tödlich sein kann, wird das Tagebuch zum bevorzugten Medium. Allein hier hat der Tagebuchschreiber dann noch die Möglichkeit, zu sich selbst zurückzukehren und ehrlich seine Meinung zu äußern. Das Leben im Exil gehört zu diesen radikalen äußeren Situationen, welche Tagebücher generieren können.
Stefan Zweig, Thomas und Klaus Mann verfügen über mindestens vier Gemeinsamkeiten: Sie sind deutschsprachige Schriftsteller, sie gehen ins Exil, sie führen dort Tagebuch und sie kehren nach Kriegsende nicht mehr nach Deutschland zurück. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Exiltagebüchern dieser drei Autoren.
Als bedeutende Schriftsteller sind ihre Tagebücher wichtige historische und literaturgeschichtliche Quellen, das gilt umso mehr speziell für die Tagebücher ihrer Emigrationszeit. Denn diese berichten einerseits von den historischen Ereignissen zur Zeit des Hitler-Regimes, des Zweiten Weltkrieges und den Lebenserfahrungen im Exil. Andererseits bieten sie aufschlussreiche Blicke in das Innenleben ihrer Verfasser. Sie zeigen zum einen, wie die Autoren das Geschehen in Deutschland und Europa bewerten und zum anderen machen sie die bitteren Konsequenzen, die das Leben im Exil mit sich bringt, deutlich.
Es wird angenommen, dass die drei Schriftsteller gerade in ihren Tagebüchern besonders offen und ehrlich über ihre Gedanken und Gefühle Auskunft geben, was schließlich einen Rückschluss auf die Bedeutung der Lebensverhältnisse im Exil für die Schriftsteller zulässt. Auf den ersten Blick setzt man Exil mit Rettung gleich. Doch ein zweiter, genauerer Blick offenbart die Kehrseite der Medaille und zeigt Fremde, Einsamkeit, Isolation und auch Verhängnis.
Zu Beginn der Arbeit soll ein kurzer Überblick über die Exilbewegung gegeben werden, insbesondere geht es dabei um flüchtende Schriftsteller. Anschließend werden die drei Autoren vorgestellt. Dazu wird ein Überblick über die jeweilige Person gegeben und nachfolgend allgemeine Aussagen..
Inhalt
1. Einführung
2. Historischer Kontext – Autoren auf der Flucht
3. Stefan Zweig
3.1. Tod durch Selbstmord im Exil
3.2. Stefan Zweigs Krisentagebücher
3.3. Seine Exiltagebücher
4. Thomas Mann
4.1. Flucht nach Amerika
4.2. Thomas Mann – Notorischer Tagebuchschreiber
4.3. Manns Exiltagebücher
5. Klaus Mann
5.1. Selbstmord in Frankreich
5.2. Wie der Vater, so der Sohn?
5.3. Exiltagebücher von Klaus Mann
6. Fazit
Quellen- und Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Welche Autoren stehen im Fokus der Analyse der Exiltagebücher?
Die Arbeit analysiert die Exiltagebücher von Stefan Zweig, Thomas Mann und Klaus Mann.
Warum führten diese Schriftsteller im Exil Tagebuch?
Das Tagebuch diente als Medium zur Selbsterkenntnis, zur Verarbeitung von Isolation und als Ort ehrlicher Meinungsäußerung in Zeiten der Diktatur.
Was verbindet Stefan Zweig und Klaus Mann in ihrem Exilschicksal?
Beide Schriftsteller litten stark unter den Bedingungen des Exils und wählten schließlich den Freitod (Selbstmord).
Wie unterschied sich Thomas Manns Exil von den anderen?
Thomas Mann war ein notorischer Tagebuchschreiber und lebte im Exil in Amerika, wobei seine Tagebücher auch seinen Kampf gegen das Hitler-Regime dokumentieren.
Welche historische Bedeutung haben diese Tagebücher?
Sie sind wichtige Quellen, die sowohl historische Ereignisse des Zweiten Weltkriegs als auch das Innenleben und die Verzweiflung der Emigranten zeigen.
- Arbeit zitieren
- Susanne Spengler (Autor:in), 2012, Eine Analyse der Exiltagebücher von Stefan Zweig, Thomas und Klaus Mann, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210926