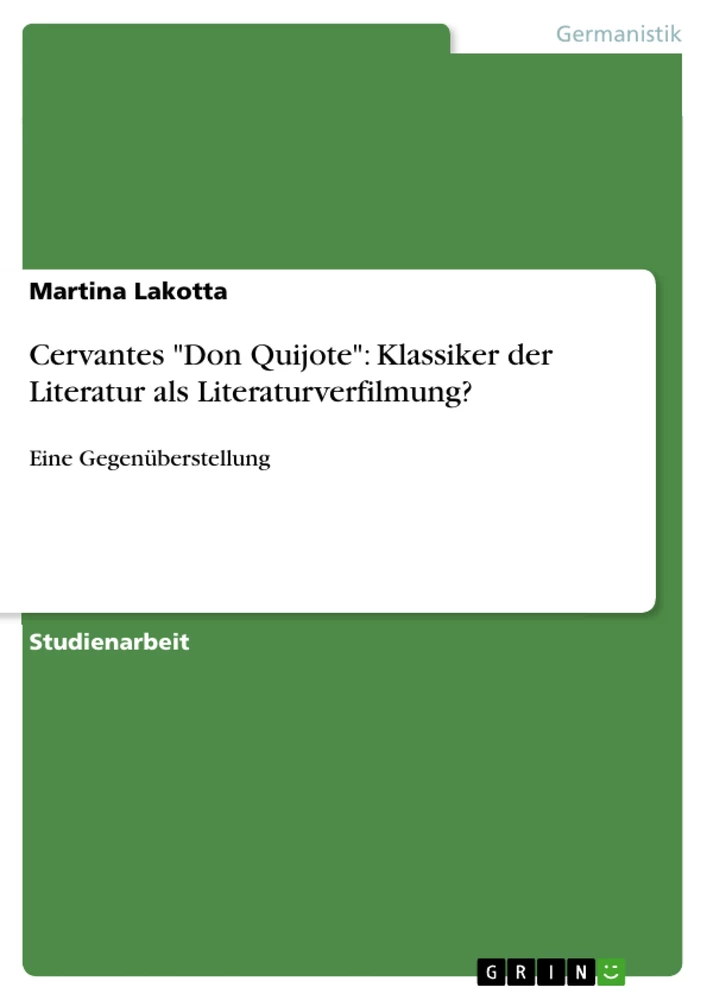Das die Filme Vom Winde verweht, A Beautyful Mind, Herr der Ringe, Charlie und die Schokoladenfabrik, Madam Bovary und The Ring etwas gemeinsam haben ergibt sich für die wenigsten Menschen auf den ersten Blick. Jedoch haben alle Regisseure dieser Filme einen Roman als Vorlage für ihren Film benutzt – bei manchen Verfilmungen wie Der Herr der Ringe ist das wohl den allermeisten Zuschauern bekannt, bei vielen Filmen ist jedoch verlorengegangen, dass es sich dabei um eine Literaturverfilmung handelt, also, dass ein Buch dem Film zugrunde liegt.
Ziel der Arbeit ist es, einige der konkurrierenden Meinungen der Forschung zum Thema Literaturverfilmung kurz darzustellen und zu bewerten, darauf basierend möchte ich begründen, ob eine Literaturverfilmung von Romanklassikern, wie Don Quijote einer ist, überhaupt zulässlich ist.
Im ersten Teil dieser Hausarbeit sollen deswegen zunächst die Unterschiede und Möglichkeiten des Mediums Buch und Film betrachtet und gegenübergestellt werden, im zweiten Teil dann die eigentliche Literaturverfilmung und die an ihr geübte Kritik untersucht werden. Anschließend soll im letzten Teil nach dem Analyse-Model von Mathias Hurst2 eine konkrete Literaturverfilmung3 zu Cervantes´ Don Quijote von la Mancha1 auf ihre Erzählsituation im Vergleich zum Roman untersucht werden, um so eventuell die Qualität der Verfilmung bewerten zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Film und Buch - Ein Vergleich
- 2.1 Die Produktion im Vergleich
- 2.2 Die Zeichensysteme im Vergleich
- 3. Literaturverfilmungen und die an ihr geübte Kritik
- 3.1 Beeinträchtigung der Deutungsfreiheit?
- 3.2 Literaturverfilmungen als konkurrierende Kunst zur Literatur?
- 4. Analyse einer Literaturverfilmung nach einem Analyse-Modell von Hurst
- 4.1 Die auffälligsten Unterschiede zwischen Vorlage und Adaption
- 4.2 Die Erzählsituation in Vorlage und Adaption
- 4.2.1 Erzählsituation im Roman
- 4.2.2 Erzählsituation in der Serie
- 5. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Adaption von literarischen Klassikern, insbesondere Cervantes' Don Quijote, in Filmform. Sie beleuchtet die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen dem Medium Buch und Film und bewertet die Kritik an Literaturverfilmungen. Die Arbeit prüft die Zulässigkeit von Literaturverfilmungen von Klassikern und analysiert eine konkrete Verfilmung von Don Quijote nach einem Analysemodell von Hurst.
- Vergleich der Medien Buch und Film hinsichtlich Produktion und Zeichensysteme
- Bewertung der Kritik an Literaturverfilmungen bezüglich Deutungsfreiheit und Konkurrenz
- Analyse der Erzählsituation in einer konkreten Don Quijote-Verfilmung im Vergleich zum Roman
- Untersuchung der Zulässigkeit von Literaturverfilmungen klassischer Werke
- Anwendung eines Analysemodells zur Bewertung der Qualität der Verfilmung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Literaturverfilmung ein und stellt die kontroversen Meinungen in der Literatur- und Medienwissenschaft dar. Sie beschreibt die Zielsetzung der Arbeit, die darin besteht, konkurrierende Meinungen zur Literaturverfilmung darzustellen, zu bewerten und die Zulässigkeit von Verfilmungen klassischer Romane wie Don Quijote zu diskutieren. Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: einen Vergleich von Buch und Film, eine Untersuchung der Kritik an Literaturverfilmungen und eine Analyse einer konkreten Don Quijote-Verfilmung nach dem Analysemodell von Hurst.
2. Film und Buch – ein Vergleich: Dieses Kapitel vergleicht die Medien Buch und Film. Es hebt die Unterschiede in der Produktion hervor: Während ein Buch von einem Autor erstellt wird, benötigt ein Film ein großes Team. Der Vergleich der Zeichensysteme zeigt die unterschiedlichen Ausdrucksmittel auf: Film benutzt Bild- und Sprache, das Buch nur Schrift. Es wird diskutiert, ob der Film durch seine unmittelbare Bildlichkeit realitätsnäher und einprägsamer ist als das Buch, und ob dies einen tatsächlichen Vorteil darstellt. Verschiedene Ansichten in der Forschung zum Thema werden präsentiert, die die Ähnlichkeiten und Unterschiede der beiden Medien betonen.
2.1 Die Produktion im Vergleich: Dieser Abschnitt detailliert den Unterschied im Produktionsaufwand zwischen Buch und Film. Er betont, dass ein Buch im Allgemeinen von einem einzelnen Autor mit vergleichsweise geringem Aufwand erstellt werden kann, während ein Film ein großes Team und hohe Kosten erfordert. Die Qualität eines Films hängt von der Zusammenarbeit des gesamten Teams ab, im Gegensatz zum Buch, dessen Qualität primär vom Autor bestimmt wird. Trotz des höheren Aufwands bietet die Zusammenarbeit eines großen Teams auch Potenziale für innovative und vielschichtige Ergebnisse.
2.2 Die Zeichensysteme im Vergleich: Dieser Abschnitt fokussiert den Vergleich der Zeichensysteme von Buch und Film. Beide sind sinnstiftende Systeme, aber mit unterschiedlichen Mitteln: Film nutzt Bild und Sprache, während das Buch auf Schrift angewiesen ist. Es wird die Debatte aufgegriffen, ob die unmittelbare Bildlichkeit des Films einen Vorteil hinsichtlich Realitätsnähe und Einprägsamkeit darstellt. Es werden Argumente sowohl für als auch gegen diese These präsentiert, inklusive der Diskussion um den Zugang zu Informationen für Analphabeten und die Fähigkeit des menschlichen Gehirns, visuelle Informationen zu verarbeiten, unabhängig davon, ob sie direkt wahrgenommen oder imaginiert werden. Die verschiedenen Perspektiven der Forschung werden zusammengetragen.
Schlüsselwörter
Literaturverfilmung, Cervantes, Don Quijote, Buch, Film, Medienvergleich, Erzählsituation, Analysemodell Hurst, Deutungsfreiheit, Medienwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Literaturverfilmung - Don Quijote
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Adaption von literarischen Klassikern, insbesondere Cervantes' Don Quijote, in Filmform. Sie vergleicht Buch und Film, bewertet die Kritik an Literaturverfilmungen und analysiert eine konkrete Don Quijote-Verfilmung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Vergleich der Medien Buch und Film (Produktion und Zeichensysteme), die Kritik an Literaturverfilmungen (Deutungsfreiheit und Konkurrenz), die Analyse der Erzählsituation in einer Don Quijote-Verfilmung im Vergleich zum Roman, die Zulässigkeit von Literaturverfilmungen klassischer Werke und die Anwendung eines Analysemodells zur Bewertung der Verfilmungsqualität.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Vergleich von Buch und Film (inkl. Unterkapiteln zur Produktion und den Zeichensystemen), ein Kapitel zur Kritik an Literaturverfilmungen, ein Kapitel zur Analyse einer konkreten Don Quijote-Verfilmung nach einem Modell von Hurst und eine Schlussbemerkung. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind enthalten.
Welche Aspekte des Vergleichs zwischen Buch und Film werden beleuchtet?
Der Vergleich beleuchtet die Unterschiede im Produktionsaufwand (ein Autor vs. ein großes Team) und in den Zeichensystemen (Schrift vs. Bild und Sprache). Es wird diskutiert, ob die Bildlichkeit des Films einen Vorteil in Bezug auf Realitätsnähe und Einprägsamkeit bietet.
Wie wird die Kritik an Literaturverfilmungen behandelt?
Die Arbeit untersucht die Kritik an Literaturverfilmungen hinsichtlich der Beeinträchtigung der Deutungsfreiheit und der Frage, ob Literaturverfilmungen als konkurrierende Kunstform zur Literatur betrachtet werden sollten. Verschiedene Positionen und Argumentationen werden präsentiert.
Welches Analysemodell wird verwendet?
Die Analyse der konkreten Don Quijote-Verfilmung erfolgt nach einem Analysemodell von Hurst. Die Arbeit konzentriert sich auf die auffälligsten Unterschiede zwischen Vorlage und Adaption sowie auf den Vergleich der Erzählsituation im Roman und in der Verfilmung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Literaturverfilmung, Cervantes, Don Quijote, Buch, Film, Medienvergleich, Erzählsituation, Analysemodell Hurst, Deutungsfreiheit, Medienwissenschaft.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, konkurrierende Meinungen zur Literaturverfilmung darzustellen, zu bewerten und die Zulässigkeit von Verfilmungen klassischer Romane zu diskutieren.
Was ist die Schlussfolgerung der Arbeit (in Kurzfassung)?
Die Schlussfolgerung wird im Kapitel "Schlussbemerkung" präsentiert und fasst die Ergebnisse der Analyse und des Vergleichs zusammen. (Der genaue Inhalt der Schlussfolgerung ist im vorliegenden Textfragment nicht enthalten.)
- Quote paper
- Martina Lakotta (Author), 2011, Cervantes "Don Quijote": Klassiker der Literatur als Literaturverfilmung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210942