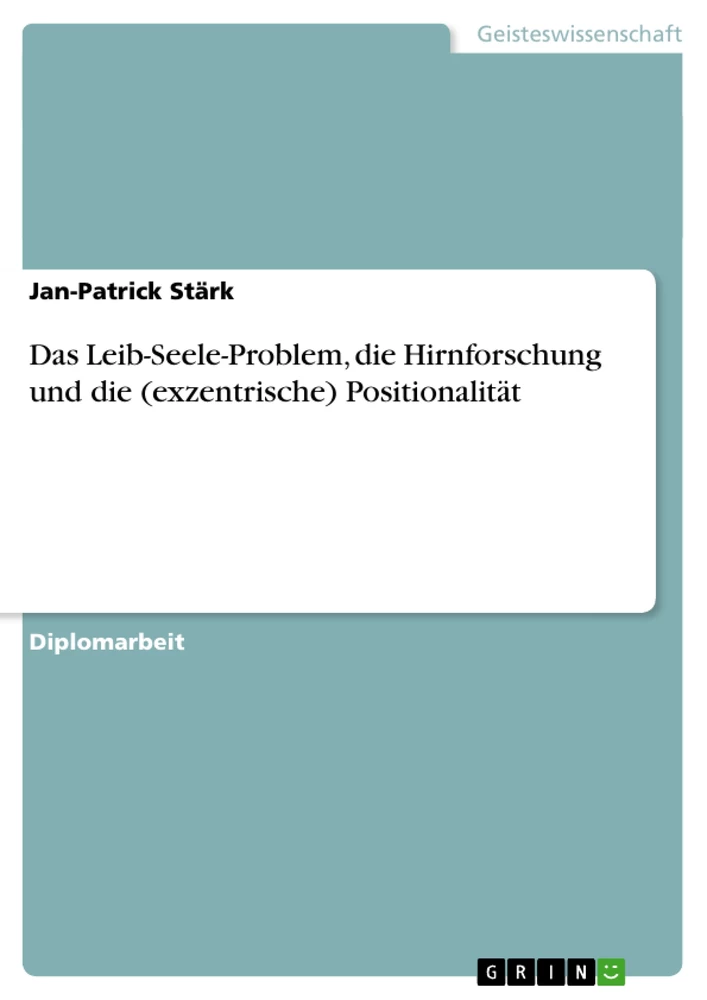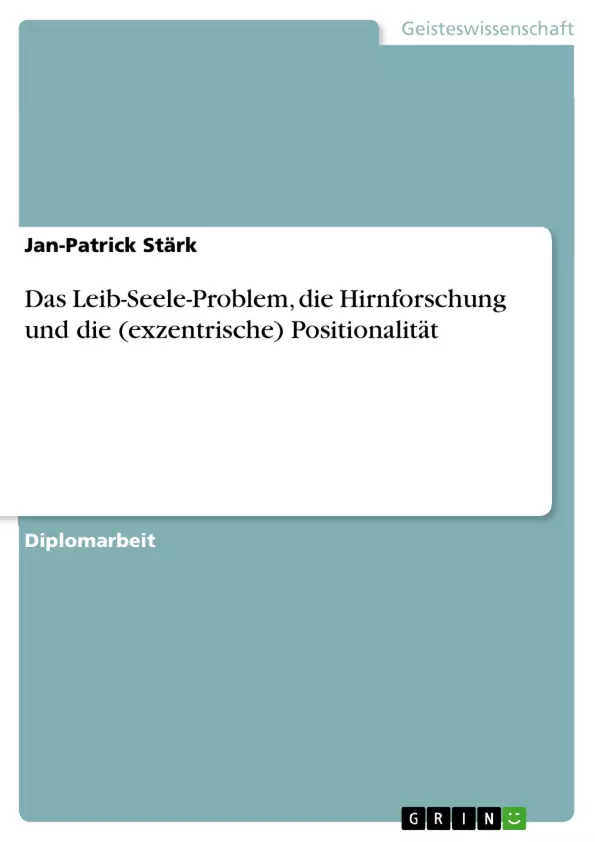Diese Diplomarbeit stellt eine Abhandlung zum Leib-Seele-Problem dar, wobei es vordergründig darum geht die Lösungsschwierigkeiten der wichtigsten Ansätze herauszufiltern und diese in weiterer Folge der exzentrischen Positionalität von Plessner gegenüberzustellen. In einer historischen Dreiteilung wird dem Leib-Seele-Problem mit seinen Wurzeln in der Antike, in der klassischen Neuzeit und dem „modernen“ Geist-Gehirn-Problem Rechnung getragen. Der Materialismus, in welcher Ausprägung auch immer, stellt im aktuellen Diskurs die dominierende Lehrmeinung dar, weshalb diesem besonderes Augenmerk geschenkt wird. Auf Grund der regen Beteiligung der Hirnforschung an der Leib-Seele-Debatte, werden die Positionen von Wolf Singer und Gerhard Roth mit in die Ausarbeitung einbezogen. Es zeigt sich, dass sowohl die reduktiv, als auch die nicht reduktiv materialistischen Lösungsansätze mit schwer-wiegenden Einwänden konfrontiert sind. Scheitert der reduktive Materialismus spätestens an der Unerklärbarkeit der Qualia und dem Selbstbewusstsein, haben nichtreduktive Materialisten mit der Standhaftigkeit ihrer eigenen Position zu kämpfen. Denn entweder müssen sie den Rückzug in den Reduktionismus antreten oder sie verfallen in einen unheilvollen Dualismus. Konstatiert man einen Dualismus und hält an der Interaktion zwischen Körper und Geist fest, verletzt man die kausale Geschlossenheit der physikalischen Welt. Will man dem dualistischen Interaktionsproblem entkommen, bleibt einem nur übrig, zwei voneinander völlig getrennte und wesensverschiedene Bereiche bzw. Welten anzunehmen. Insofern scheint sich das Leib-Seele-Problem, ähnlich einem Teufelskreis, einer Lösung zu entziehen. Alternativ dazu entwickelte Plessner die Theorie der exzentrischen Positionalität, die den Menschen aus der organischen Natur heraus rekonstruiert. Der Mensch, als lebendiger Organismus, existiert nicht nur im Doppelaspekt von Seele und Körper, sondern auf Grund seiner exzentrischen Position auch jenseits des Doppelaspekts als denkendes Ich. Über das denkende Ich konstituiert sich die Sphäre des Geistes, die kein zusätzliches Substrat neben Körper und Seele darstellt, sondern als soziales Phänomen zu betrachten ist. Dank der Hirnforschung wissen wir heute, dass eine Steigerung der Selbstreferenz im Gehirn zu Metarepräsentationen führt, die das physische Pendant bzw. den physischen Aspekt zum exzentrischen, geistigen Ich darstellen könnten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangssituation und Problemstellung
- Zielsetzung und Aufbau
- Forschungsfrage
- Das Leib-Seele-Problem
- Das Leib-Seele-Problem in der Antike
- Das klassische Leib-Seele-Problem
- Kritische Würdigung
- Das moderne Leib-Seele-Problem
- Materialismus
- Reduktiver Materialismus
- Semantischer Physikalismus
- Identitätstheorie
- Nicht-reduktiver Materialismus
- Anomaler Monismus
- Supervenienz
- Eliminativer Materialismus
- Funktionalismus
- Eigenschaftsdualismus
- Emergenz
- Qualia und Erste-Person-Perspektive
- Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?
- Argument des unvollständigen Wissens
- Die explanatorische Lücke
- Das einfache und schwierige Problem des Bewusstseins
- Kritische Würdigung
- Hirnforschung
- Singers reduktionistische Emergenz
- Emergenz
- Das Bindungsproblem
- Bewusstsein
- Selbstbewusstsein
- Freie und unfreie Entscheidungen
- Von der Ersten- zur Dritten-Person-Perspektive
- Gerhard Roth und der menschliche Geist
- Kritische Würdigung
- Plessners Stufen des Organischen und der Mensch
- Doppelaspekt
- Grenze
- Leben
- Positionalität
- Dynamische Realisierung des Lebens
- Statische Realisierung des Lebens
- Organ und Positionsfeld
- Zentrische Positionalität
- Offene Organisationsform
- Geschlossene Organisationsform
- Exzentrische Positionalität
- Außenwelt, Innenwelt, Mitwelt
- Außenwelt
- Innenwelt
- Mitwelt
- Anthropologische Grundgesetze
- Kritische Würdigung
- Zusammenfassung und Beantwortung der Forschungsfrage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht das Leib-Seele-Problem im Kontext der Hirnforschung und Plessners Konzeption der exzentrischen Positionalität. Ziel ist es, verschiedene philosophische Positionen zum Leib-Seele-Problem zu analysieren und deren Relevanz für das Verständnis des menschlichen Bewusstseins und der menschlichen Handlungsfähigkeit zu erörtern. Die Arbeit beleuchtet den Zusammenhang zwischen Körper und Geist und untersucht, wie die Hirnforschung zu einer Klärung des Problems beitragen kann.
- Das Leib-Seele-Problem in der Geschichte der Philosophie
- Materialistische und dualistische Positionen zum Leib-Seele-Problem
- Die Rolle der Hirnforschung im Verständnis des Bewusstseins
- Plessners Konzept der exzentrischen Positionalität und seine Bedeutung für das Leib-Seele-Problem
- Die Frage nach freiem Willen und Handlungsfähigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt das Leib-Seele-Problem als Ausgangspunkt der Arbeit vor. Sie beschreibt das traditionelle dualistische Verständnis des Menschen als ein Wesen mit einem Körper und einer unabhängigen Seele, welches in der westlichen Tradition verwurzelt ist. Die Arbeit fokussiert sich auf die Problematik dieses Dualismus im Lichte moderner materialistischer Ansätze und der Erkenntnisse der Hirnforschung. Der westliche Blick auf Körper und Geist wird dabei kontrastiert mit anderen kulturellen Perspektiven. Die Forschungsfrage und der Aufbau der Arbeit werden skizziert.
Das Leib-Seele-Problem: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über das Leib-Seele-Problem in der Philosophiegeschichte, beginnend von der Antike bis zur Gegenwart. Es analysiert verschiedene klassische und moderne Positionen, darunter Materialismus in seinen verschiedenen Ausprägungen (reduktiv, nicht-reduktiv, eliminativ) sowie Dualismus und Funktionalismus. Die zentralen Argumente und Herausforderungen der jeweiligen Positionen werden beleuchtet, mit besonderem Fokus auf die Schwierigkeiten, mentale Zustände adäquat in physikalische Sprache zu übersetzen. Der Abschnitt über Qualia und die Erste-Person-Perspektive behandelt die subjektive Erlebnisqualität mentaler Zustände und deren Erklärungsproblematik.
Hirnforschung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Relevanz der Hirnforschung für das Leib-Seele-Problem. Es diskutiert reduktionistische Emergenztheorien im Kontext der Hirnforschung, insbesondere das Bindungsproblem und dessen Implikationen für ein Verständnis von Bewusstsein und Selbstbewusstsein. Die Arbeiten von Singer und Roth werden analysiert und kritisch gewürdigt. Der Zusammenhang zwischen Hirnprozessen und freien/unfreien Entscheidungen wird beleuchtet, ebenso wie die Perspektive der Hirnforschung auf das Verhältnis von subjektiven Erfahrungen (erste Person) und objektiven Beobachtungen (dritte Person).
Plessners Stufen des Organischen und der Mensch: Dieses Kapitel analysiert Plessners Philosophie des Organischen und seine Konzeption der exzentrischen Positionalität. Es beschreibt die verschiedenen Stufen des Organischen und erläutert Plessners Unterscheidung zwischen zentrischer und exzentrischer Positionalität. Die Bedeutung von Außen-, Innen- und Mitwelt für die menschliche Existenz wird untersucht. Dieses Kapitel stellt einen Gegenentwurf zu reduktionistischen Ansätzen dar und bietet ein alternatives Verständnis des Verhältnisses von Körper und Geist.
Schlüsselwörter
Leib-Seele-Problem, Hirnforschung, Materialismus, Dualismus, Bewusstsein, Selbstbewusstsein, exzentrische Positionalität, Plessner, Emergenz, Qualia, Handlungsfähigkeit, freier Wille.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Leib-Seele-Problem, Hirnforschung und exzentrische Positionalität
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht das Leib-Seele-Problem aus verschiedenen Perspektiven. Sie analysiert philosophische Positionen zum Leib-Seele-Problem, den Beitrag der Hirnforschung zu dessen Klärung und Plessners Konzept der exzentrischen Positionalität als alternatives Verständnis des Verhältnisses von Körper und Geist. Ein zentrales Thema ist der Zusammenhang zwischen Körper, Geist, Bewusstsein, Selbstbewusstsein und Handlungsfähigkeit, inklusive der Frage nach dem freien Willen.
Welche philosophischen Positionen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt sowohl klassische als auch moderne Positionen zum Leib-Seele-Problem. Dazu gehören verschiedene Formen des Materialismus (reduktiver, nicht-reduktiver, eliminativer Materialismus, Funktionalismus), Dualismus und der Eigenschaftsdualismus mit dem Konzept der Emergenz. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Problem der Qualia und der Ersten-Person-Perspektive gewidmet.
Welche Rolle spielt die Hirnforschung in der Arbeit?
Die Hirnforschung wird als wichtiger Beitrag zur Klärung des Leib-Seele-Problems betrachtet. Die Arbeit analysiert reduktionistische Emergenztheorien im Kontext der Hirnforschung, das Bindungsproblem, das Verhältnis von Hirnprozessen und Bewusstsein/Selbstbewusstsein sowie den Zusammenhang zwischen Hirnprozessen und freien/unfreien Entscheidungen. Die Arbeiten von Singer und Roth werden kritisch untersucht.
Welche Bedeutung hat Plessners Konzept der exzentrischen Positionalität?
Plessners Konzept der exzentrischen Positionalität bietet einen Gegenentwurf zu reduktionistischen Ansätzen. Die Arbeit analysiert Plessners Stufen des Organischen, die Unterscheidung zwischen zentrischer und exzentrischer Positionalität und die Bedeutung von Außen-, Innen- und Mitwelt für die menschliche Existenz. Dieses Konzept liefert ein alternatives Verständnis des Verhältnisses von Körper und Geist.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Leib-Seele-Problem (mit Unterkapiteln zu Materialismus, Dualismus, Qualia etc.), ein Kapitel zur Hirnforschung, ein Kapitel zu Plessners Philosophie und eine Zusammenfassung mit der Beantwortung der Forschungsfrage. Die Einleitung beinhaltet die Problemstellung, Zielsetzung, Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Leib-Seele-Problem, Hirnforschung, Materialismus, Dualismus, Bewusstsein, Selbstbewusstsein, exzentrische Positionalität, Plessner, Emergenz, Qualia, Handlungsfähigkeit, freier Wille.
Welche Forschungsfrage wird behandelt?
Die genaue Forschungsfrage wird in der Einleitung der Arbeit formuliert. Sie zielt darauf ab, das Leib-Seele-Problem im Kontext der Hirnforschung und Plessners Philosophie zu analysieren und verschiedene philosophische Positionen kritisch zu bewerten, um ein umfassenderes Verständnis des menschlichen Bewusstseins und der Handlungsfähigkeit zu erreichen.
- Quote paper
- Jan-Patrick Stärk (Author), 2012, Das Leib-Seele-Problem, die Hirnforschung und die (exzentrische) Positionalität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211032