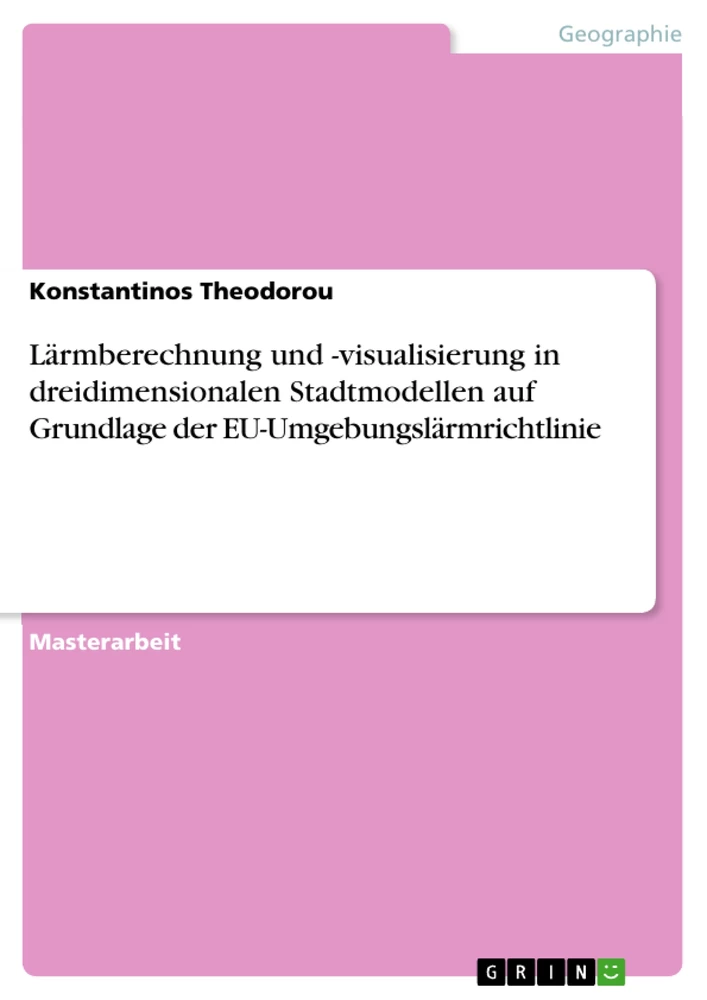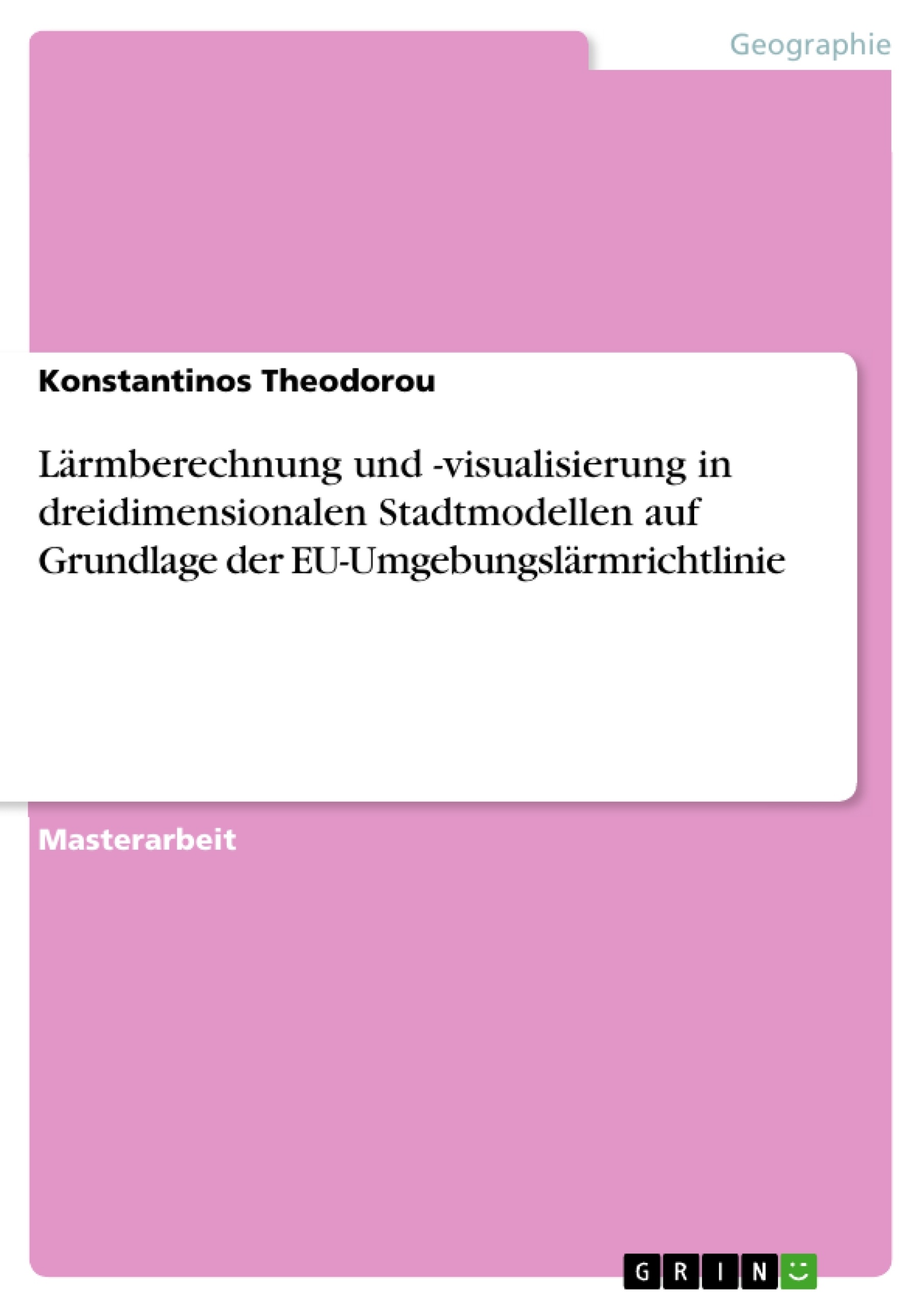Lärm, insbesondere Straßenverkehrslärm ist in Deutschland und in der gesamten Europäischen Union eines der vorangingen Umweltprobleme. Die Schaden erzeugende Wirkung von Lärm auf den Menschen ist in zahlreichen Studien untersucht worden und zumindest bei höheren Schallpegeln belegt. Neben diesem Aspekt fühlen sich laut einer Umfrage des Umweltbundesamtes mit rund 68.000 beteiligten Personen, 36 % hochgradig und 59 % der Befragten wesentlich vom Straßenverkehrslärm belästigt. Aufgrund dieser Problematik hat die Europäische Union am 25. Juni 2002 die Richtlinie 2002/49/EG des europäischen Parlaments und des Rates über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm (im Folgenden EU-Umgebungslärmrichtlinie genannt) erlassen. Darin wird unter anderem geregelt, dass von den zuständigen Behörden Lärmkarten und Aktionspläne erstellt werden sollen und die Anzahl der von einer bestimmten Lärmart belasteten Personen ermittelt werden müssen.
Diese Belastetenzahlen werden anhand von Fassadenpegeln an betroffenen Gebäuden berechnet und verlangen im günstigsten Fall ein 3D-Stadtmodell, zumindest jedoch Daten über die Gebäudehöhe. In der Richtlinie sollen diese Daten in der Tabellenform dargestellt werden. Aufgrund der technischen Rahmenbedingungen und der in der Richtlinie geforderten Öffentlichkeitsbeteiligung ist es aus meiner Sicht jedoch sinnvoll, diese Daten dreidimensional und vor allem interaktiv zu visualisieren. Auf diese Weise entsteht ein Informationssystem welches leicht verständlich, nachvollziehbar und für die Stadtverwaltung sowie für interessierte Bürgerinnen und Bürger nutzbar sein kann. Darüber hinaus sind die Fassadenpegel in den Ergebnissen genauer als zweidimensionale Lärmkarten, die zumeist in einem groben Raster gerechnet werden.
In dieser Master-Arbeit wird die Entstehung dieses Informationssystems beschrieben sowie die Möglichkeiten der Nutzung und dessen eventueller Mehrwert analysiert. Darüber hinaus wird ein Vergleich gezogen zwischen Berechnungsmethoden strikt nach EU-Vorgaben und einer optimierten Fassung. Es wird ferner untersucht, ob und inwiefern sich dabei die Anzahl der von Lärm betroffenen Personen ändert. Der Einsatz des Informationssystems beschränkt sich hier auf ein kleines Projektgebiet in Bochum Grumme, welches stellvertretend das gesamte Stadtgebiet repräsentieren soll.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
2 Schall und Lärm
2.1 Definition von Schall und Lärm
2.2 Berechnung und Bewertung von Schall
2.3 Mittelungs- und Beurteilungspegel
2.4 Auswirkungen auf den Menschen
3 Die Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm
3.1 Allgemeines
3.2 Hintergrund und Zielsetzung
3.3 Harmonisierte Indizes und Bewertungsmethoden
3.4 Ermittlung von Belastetenzahlen
3.5 Öffentlichkeitsbeteiligung
3.6 Umsetzung der Richtlinie in deutsches Recht
3.7 Kritik und Diskussion
4 Datengrundlagen und Lärmberechnung
4.1 3D-Stadtmodelle
4.1.1 Ableitung der Modelle aus Katasterdaten
4.1.2 Das Austauschformat CityGML
4.1.3 Das 3D-Stadtmodell der Stadt Bochum
4.2 Digitale Geländemodelle
4.3 Sonstige Daten
4.4 Verwendete Software
4.5 Das Projektgebiet
4.6 Berechnung der Fassadenpegel
5 Visualisierung der berechneten Ergebnisse
5.1 Umsetzung im CtyViewer...
5.1.1 nach EU-Vorschrift
5.1.2 als Informationssystem
5.1.3 Vergleich der unterschiedlichen Berechnungsmethoden
5.2 Evaluierung und Diskussion der Ergebnisse
5.2.1 Schwierigkeiten bezüglich der Gebäude- und Stockwerkshöhen
5.2.2 Möglichkeiten der Pegeldarstellung
5.1.3 Analyse der Belastetenzahlen
5.2.4 Zusammenfassung und Ausblick
6 Fazit
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der EU-Umgebungslärmrichtlinie?
Ziel ist die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm durch die Erstellung von Lärmkarten, Aktionsplänen und die Ermittlung betroffener Personenzahlen.
Warum ist eine 3D-Visualisierung von Lärm sinnvoll?
3D-Modelle ermöglichen eine interaktive, leicht verständliche Darstellung der Fassadenpegel, was die Öffentlichkeitsbeteiligung und Nachvollziehbarkeit verbessert.
Was sind Fassadenpegel?
Das sind Lärmwerte, die direkt an der Außenwand eines Gebäudes berechnet werden, um die tatsächliche Belastung der Bewohner präziser als in 2D-Rasterkarten zu bestimmen.
Welches Austauschformat wird für 3D-Stadtmodelle genutzt?
In der Arbeit wird CityGML als zentrales Austauschformat für die 3D-Stadtmodelle (hier am Beispiel Bochum) thematisiert.
Wie wirkt sich Lärm auf den Menschen aus?
Lärm gilt als vorrangiges Umweltproblem, das bei höheren Schallpegeln nachweislich gesundheitsschädlich wirkt und von einem Großteil der Bevölkerung als Belästigung empfunden wird.
Welches Projektgebiet wurde für die Untersuchung gewählt?
Die Untersuchung beschränkt sich beispielhaft auf ein Projektgebiet in Bochum Grumme.
- Quote paper
- M.Sc. Geographie Konstantinos Theodorou (Author), 2011, Lärmberechnung und -visualisierung in dreidimensionalen Stadtmodellen auf Grundlage der EU-Umgebungslärmrichtlinie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211044