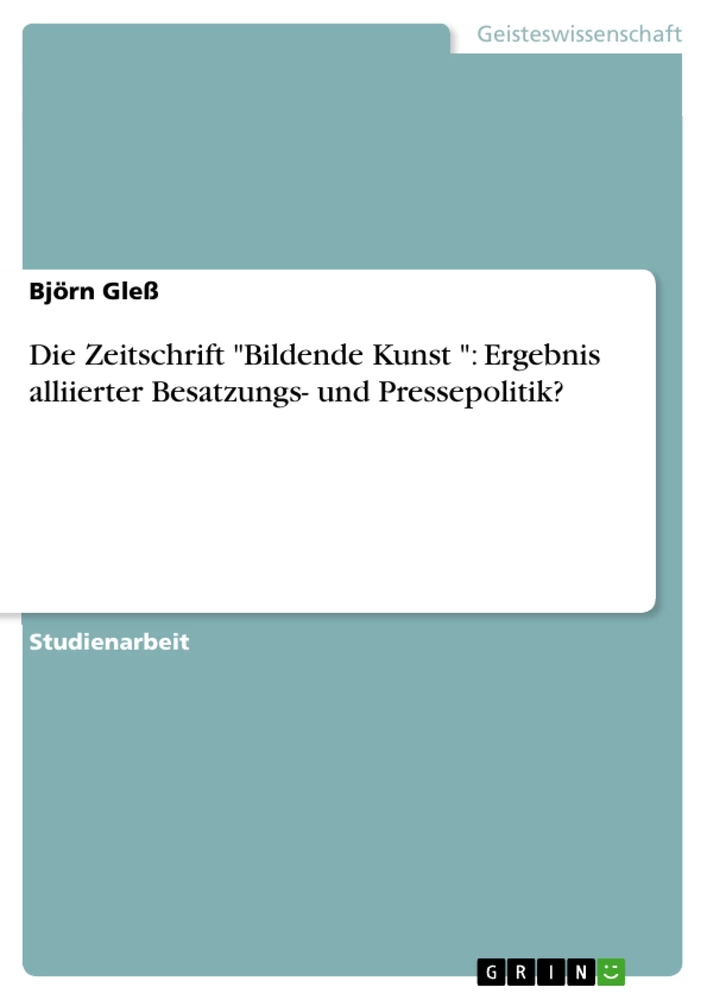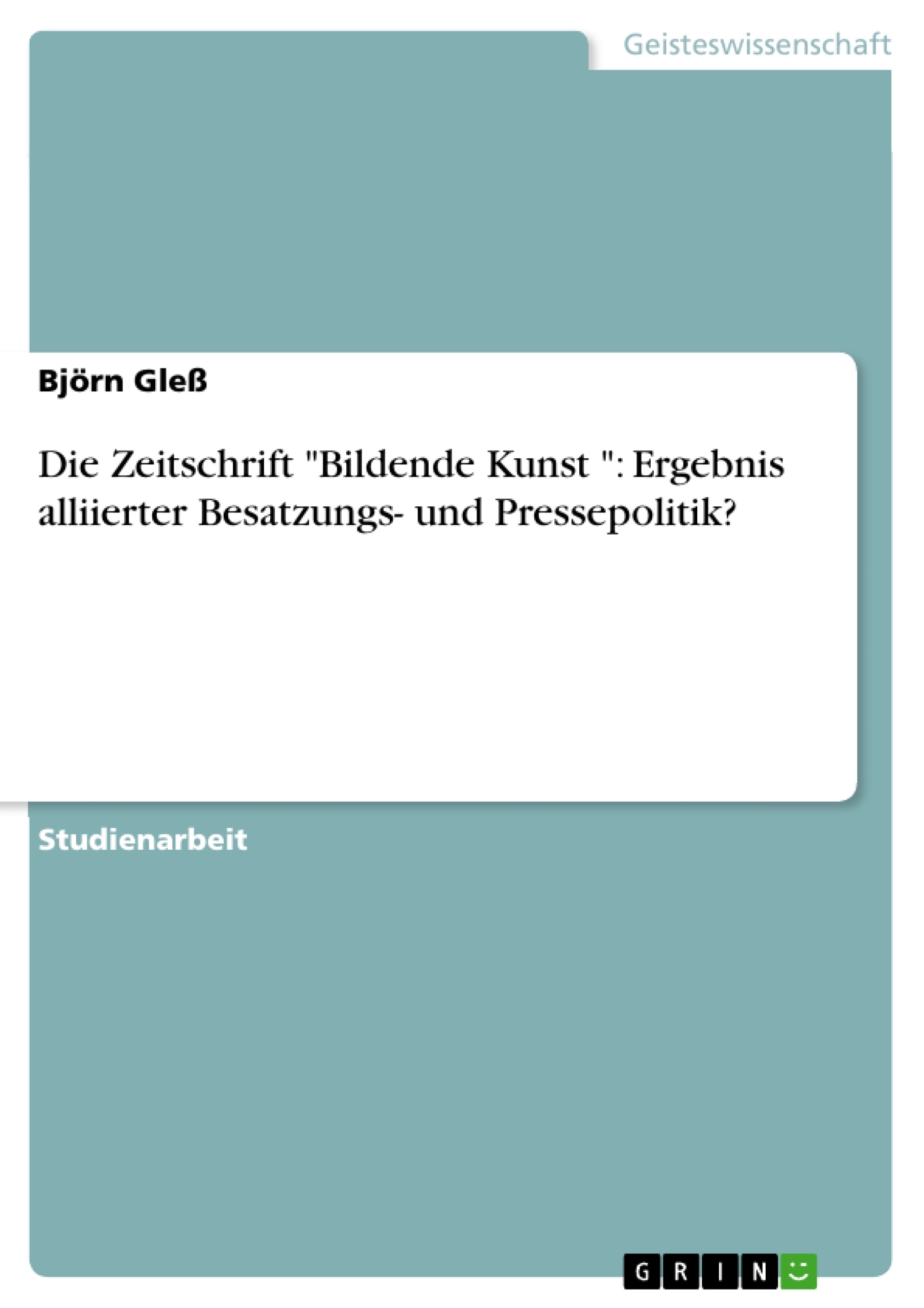"Nun aber haben wir es heute mit einer Menschheit zu tun, der nahezu alle Voraussetzungen für das Verstehen eines Kunstwerkes fehlen; dies wäre das Schlimmste nicht, man hätte es gewissermaßen mit jungfräulichem Boden zu tun, bereit zur Aufnahme der Saat. Ratlos zunächst aber stehen wir vor einem wüsten Feld, verfilzt von geistigem Unkraut, das tiefe Wurzeln geschlagen hat."1 Mit diesen Worten beschreibt Carl Hofer als Herausgeber der Zeitschrift bildende kunst die Probleme mit denen er die Rezeption seiner 1947 zum ersten Mal in der sowjetischen Besatzungszone erscheinenden Kunstzeitschrift konfrontiert sieht. In dieser wissenschaftlichen Arbeit soll der Versuch unternommen werden jenes von Carl Hofer in seinem Geleitwort erwähnte wüste Feld genauer zu untersuchen, um grundlegend die Situation der Presse nach dem Ende des 2. Weltkrieges im Osten wie im Westen Deutschlands darzustellen. Nur mit dem Verständnis für die Besonderheit dieser einerseits historischen Chance und andererseits schwerwiegenden Last, ist eine umfassende Charakteristik der ostdeutschen Kunstzeitschrift Bildende Kunst, die auf ihren kleingeschriebenen Vorgänger folgt, erst möglich. Während die Voraussetzungen in beiden Teilen Deutschlands mit dem Zusammenfall des Nazi-Regimes und der Übernahme durch die Alliierten annähernd gleich waren, so sollte sich doch ein schon in beiden Verfassungen unterschiedlich fest- und später auch ausgelegtes Pressewesen entwickeln. So gilt es zu klären, ob die DDR-Kunstzeitschrift, als offiziell zugelassenes Presseerzeugnis der DDR, durch die Sowjetische Einheitspartei in ihrer Berichterstattung beschränkt, kontrolliert oder sogar gelenkt und für eigene Propaganda missbraucht wurde, wie man es aufgrund der historischen Aufarbeitung Ostdeutschlands2 annehmen würde. Auch aus aktuellem Anlass (20-jähriges Jubiläum deutscher Einheit) scheint es interessant die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte dieser ostdeutschen Kunstzeitschrift, deren Einstellung wenige Monate nach der Wiedervereinigung erfolgte, zu beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Situation der Presse in der deutschen Nachkriegszeit
2.1 Pressepolitik der Besatzungszonen in Ost und West
2.2 Pressefreiheit und subkulturelle Zeitschriften in der DDR
3. Die Bildende Kunst als Verbandszeitschrift mit Bildungsauftrag
3.1 Entstehungsgeschichte
3.2 Charakteristik und Entwicklung bis zur Einstellung 1991
4. Fazit zum Wirken der Bildenden Kunst
5. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was war die Besonderheit der Zeitschrift „Bildende Kunst“ in der Nachkriegszeit?
Sie erschien ab 1947 in der sowjetischen Besatzungszone und musste sich im Spannungsfeld zwischen künstlerischem Bildungsauftrag und politischer Lenkung behaupten.
Wurde die Berichterstattung der Zeitschrift in der DDR kontrolliert?
Die Arbeit untersucht, ob und inwieweit das Presseerzeugnis durch die SED beschränkt, kontrolliert oder für Propagandazwecke instrumentalisiert wurde.
Wer war Carl Hofer und welche Rolle spielte er für die Zeitschrift?
Carl Hofer war der Herausgeber der Zeitschrift und thematisierte in seinem Geleitwort die Schwierigkeiten der Kunstrezeption nach dem Ende des Nazi-Regimes.
Wann wurde die Zeitschrift „Bildende Kunst“ eingestellt?
Die Einstellung der Zeitschrift erfolgte 1991, wenige Monate nach der deutschen Wiedervereinigung.
Wie unterschied sich das Pressewesen in Ost- und Westdeutschland nach 1945?
Trotz ähnlicher Ausgangslage entwickelten sich aufgrund der unterschiedlichen Besatzungspolitiken grundverschiedene Systeme der Pressefreiheit und staatlichen Lenkung.
- Quote paper
- Björn Gleß (Author), 2010, Die Zeitschrift "Bildende Kunst ": Ergebnis alliierter Besatzungs- und Pressepolitik?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211236