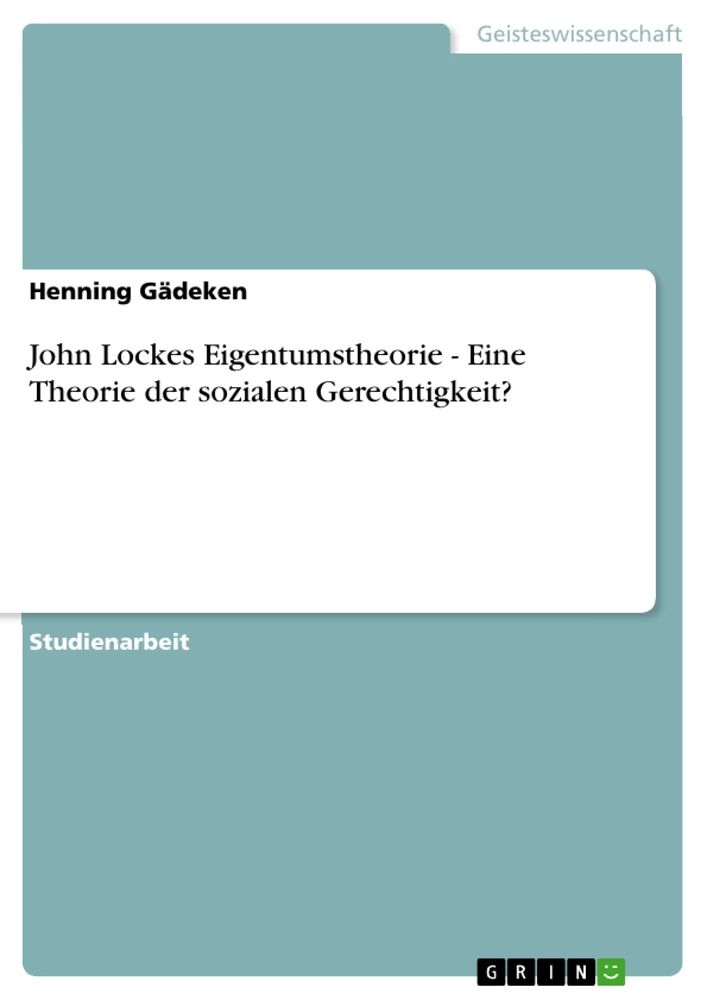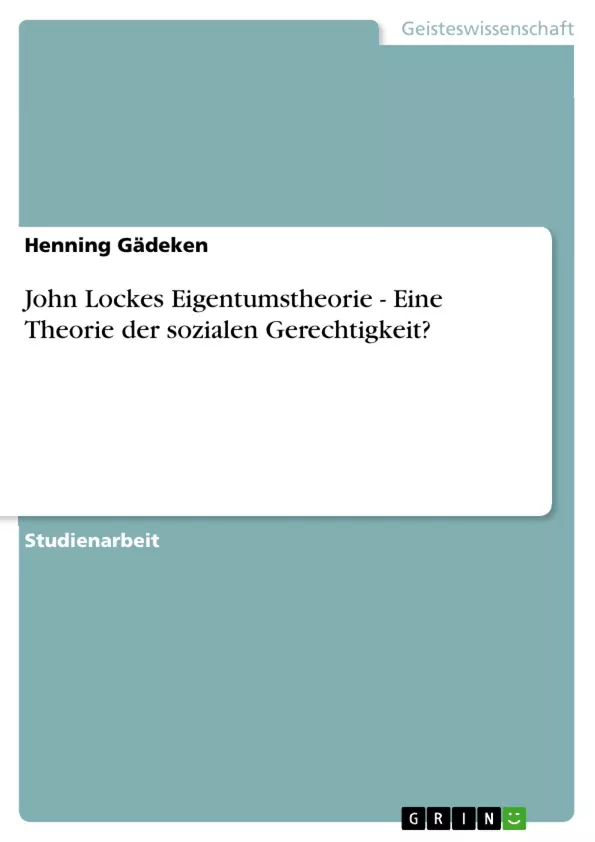Primärer Gegenstand der vorliegenden Hausarbeit ist die Eigentumstheorie des John
Locke aus seinem politischen Hauptwerk „Two Treatises of Government“. Diese soll
im Hinblick auf ihren sozialen Gerechtigkeitsanspruch analysiert werden. Die
Anregung zu diesem Thema ergab sich aus der Lektüre des Kurses
„Sozialphilosophie des 18. Jahrhunderts“ als Bestandteil des Moduls 3E „Diskursiver
Entwurf: Wissen, Aufklärung, Handeln“ des Studienganges „Europäische Moderne:
Geschichte und Literatur“. [...] Die deutsche Übersetzung „Zwei Abhandlungen über die Regierung“, die von Hans
Jörn Hoffmann übersetzt und von Walter Euchner herausgegeben wurde, wird als
Hauptquelle zur Lockeschen Eigentumstheorie genutzt und soll bei der Beantwortung
nachstehender Fragestellung helfen:
• Ist John Lockes Eigentumstheorie als Ausdruck sozialer Gerechtigkeit zu
verstehen?
Die Fragestellung zielt auf die „Soziale Frage“ ab. Untersucht werden soll, ob Locke
in seiner Lehre vom Eigentum im Naturzustand und nach Einführung des Geldes
sowohl für die besitzende als auch für die nicht-besitzende Bevölkerung
argumentierte oder aber mit seinen Aussagen nur für eine der beiden Seiten eintrat.
Zum Verständnis der Thematik werden in Kapitel 2 Gründe für die Entstehung von
Lockes Eigentumstheorie aufgezeigt, die sich aus seiner kritischen
Auseinandersetzung mit der politischen Theorie des Sir Robert Filmers ergab.
Im dritten theoretischen Kapitel dieser Arbeit soll die Eigentumstheorie von John
Locke vor und nach der Einführung der Geldwirtschaft thematisiert sowie staatliche
Eingriffe zur Sicherung des Eigentums aufgezeigt werden.
Kapitel 4 zielt darauf ab, Lockes Eigentumstheorie vor dem Hintergrund der sozialen
Gerechtigkeit zu beleuchten und schließlich die zentrale Fragestellung dieser
Hausarbeit zu beantworten.
In der Schlussbetrachtung wird ein Fazit der Lockeschen Eigentumstheorie gezogen
und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft im England des 17. Jahrhunderts
aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Zur Entstehung von Lockes Eigentumstheorie
3. Eigentumstheorie nach John Locke
3.1 Eigentum im Naturzustand
3.2 Eigentum nach Einführung der Geldwirtschaft
3.3 Staatliche Eingriffe zur Sicherung des Eigentums
4. Wirkung von Lockes Eigentumstheorie auf die Soziale Frage
5. Schlussbetrachtung: Auswirkungen von Lockes Eigentumstheorie auf die englische Gesellschaft des 17. Jahrhunderts
6. Quellen- und Literaturverzeichnis
- Quote paper
- Henning Gädeken (Author), 2013, John Lockes Eigentumstheorie - Eine Theorie der sozialen Gerechtigkeit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211248