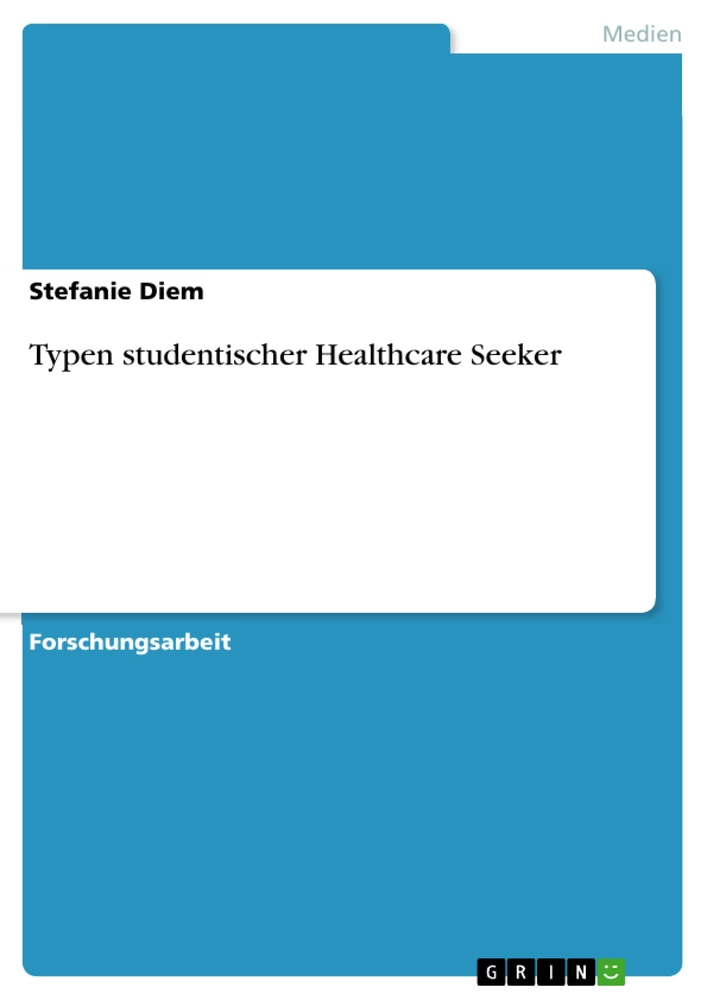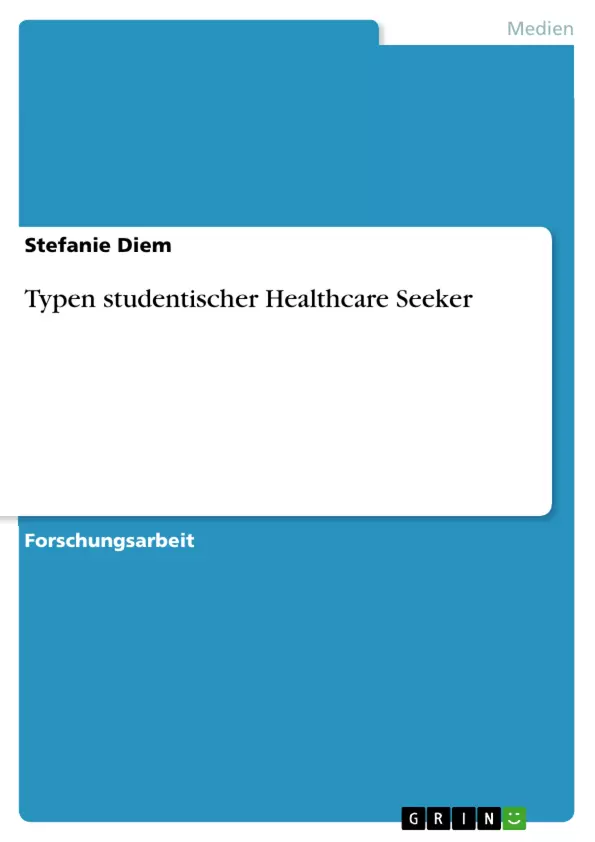Die vorliegende Forschungsarbeit befasst sich mit dem Metathema Gesundheitskommunikation. Dabei widmet sie sich dem immer wichtiger werdenden Thema der Gesundheitskommunikation im Netz. Die Gewichtung neuer Medien in der allgemeinen Kommunikation und somit ebenfalls in der Gesundheitskommunikation ist in dem letzten Jahrzehnt rapide gestiegen. Dies soll im Theorieteil aufgearbeitet werden. Im Rahmen des praktischen Teils werden Ergebnisse aus qualitativen Leitfadeninterviews präsentiert, die mit Studierenden durchgeführt wurden. Studierende sind für das Forschungsvorhaben die geeignete Zielgruppe, denn sie sind bestens vertraut mit dem Medium Internet, besitzen einen hohen Bildungsstand und sind Hauptnachfrager von digitalen Gesundheitsinformationen. Außerdem existiert der Kaiser Family Foundation Studie (2001) zufolge, unter jungen Erwachsenen bis 24 Jahren ein gesteigertes Interesse, Gesundheitsinformationen aus dem Internet zu recherchieren.
Das Forschungsinteresse besteht darin herauszufinden, ob verschiedene Typen an studentischen Healthcare Seekers unterschieden werden können, ob es einen Zusammenhang mit der Internetnutzung für gesundheitsbezogene Themen gibt. Die Bildung solcher Typen dient zur Kategorisierung des Forschungsfeldes und kann später als Grundlage für quantitative Befragungen herangezogen werden.
Im nachfolgenden ersten Kapitel soll zunächst einmal auf theoretischer Ebene auf die Massenmedien im Allgemein und das Internet im Speziellen eingegangen werden.
Inhalt
Einleitung
1 Das Medium Internet
2 Was ist Gesundheitskommunikation?
3 (Gesundheitsbezogene) Internetnutzung
4 Die Tücken der eHealth Kommunikation
5 Verschiedene Typen (Online) Healthcare Seekers
6 Forschungsfragen
7 Operationalisierung
8 Methodendesign
9 Ergebnisse und Ausblick
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Anhang
Häufig gestellte Fragen
Wer sind „Online Healthcare Seeker“?
Personen, die das Internet aktiv nutzen, um nach gesundheitsbezogenen Informationen, Diagnosen oder Behandlungsmöglichkeiten zu suchen.
Warum wurden Studierende als Zielgruppe für diese Forschung gewählt?
Studierende sind internetaffin, besitzen einen hohen Bildungsstand und gehören laut Studien zu den Hauptnachfragern digitaler Gesundheitsinformationen.
Welche Rolle spielt die Gesundheitskommunikation im Netz heute?
Die Bedeutung neuer Medien ist rapide gestiegen, da sie schnellen Zugang zu Informationen bieten, aber auch Herausforderungen hinsichtlich der Qualität und Verlässlichkeit (eHealth) mit sich bringen.
Was ist das Ziel der Typenbildung bei Healthcare Seekern?
Die Kategorisierung dient dazu, das Forschungsfeld zu strukturieren und eine Grundlage für spätere quantitative Befragungen zu schaffen.
Welche Methode wurde in der praktischen Untersuchung angewendet?
Es wurden qualitative Leitfadeninterviews mit Studierenden durchgeführt, um deren individuelles Nutzungsverhalten zu explorieren.
- Arbeit zitieren
- Stefanie Diem (Autor:in), 2011, Typen studentischer Healthcare Seeker, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211260