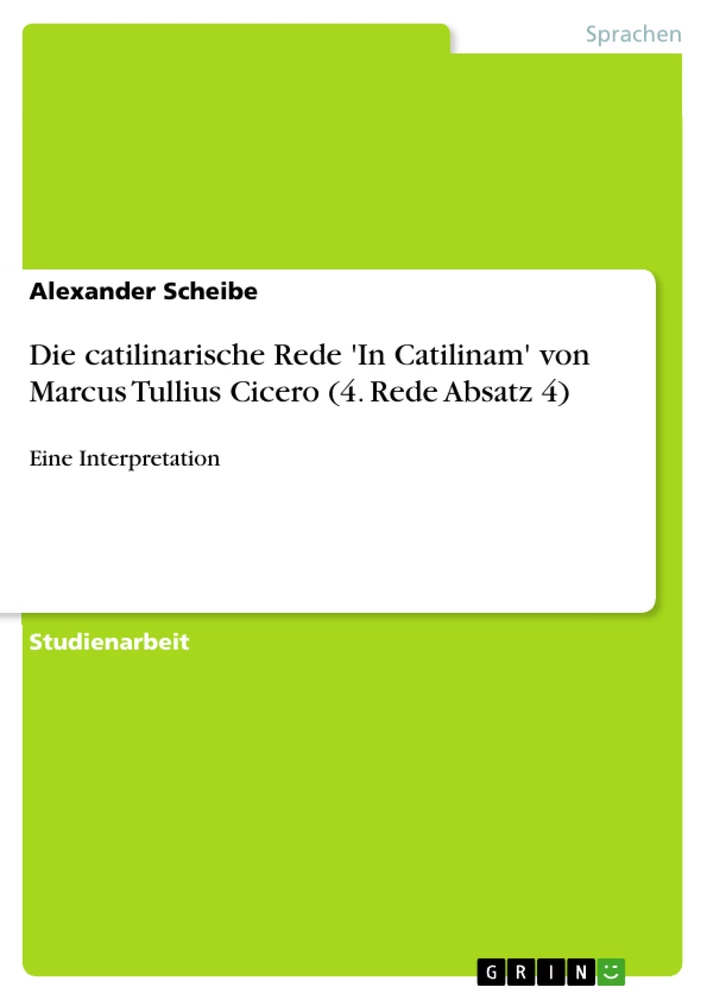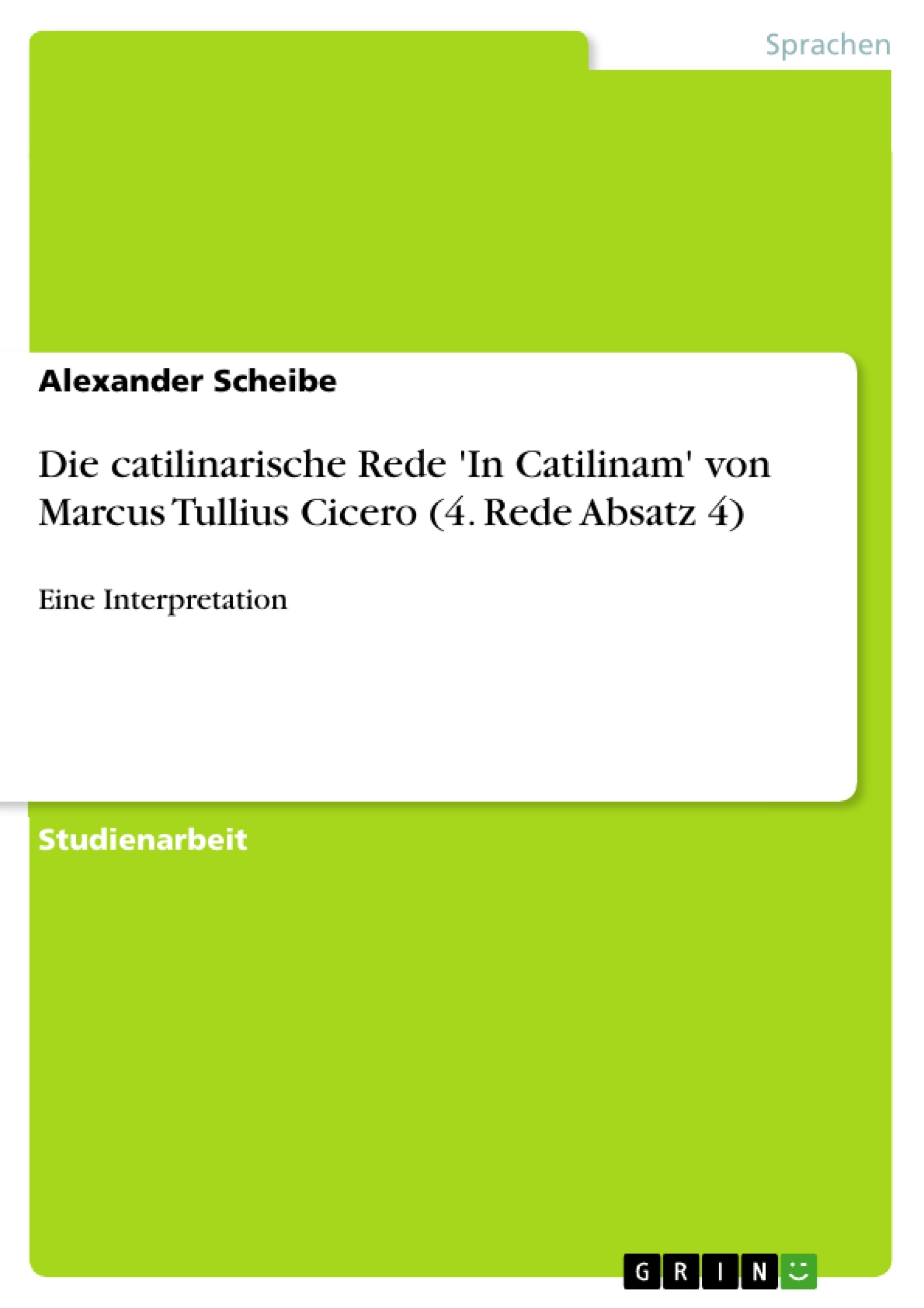In der Hausarbeit beschäftige ich mich mit einem Ausschnitt der letzten Rede Ciceros gegen Catilina.
Inhaltsverzeichnis
1. Originaltext
2. Übersetzung
3. Interpretation
3.1. Einleitung und Inhalt
3.2. Textgliederung
3.3. Sprache, Stil und Form
3.4. Gattung und geschichtlicher Hintergrund
3.5. Fazit
4. Literaturverzeichnis
Excerpt out of 11 pages
- scroll top
- Quote paper
- Alexander Scheibe (Author), 2010, Die catilinarische Rede 'In Catilinam' von Marcus Tullius Cicero (4. Rede Absatz 4), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211364
Look inside the ebook