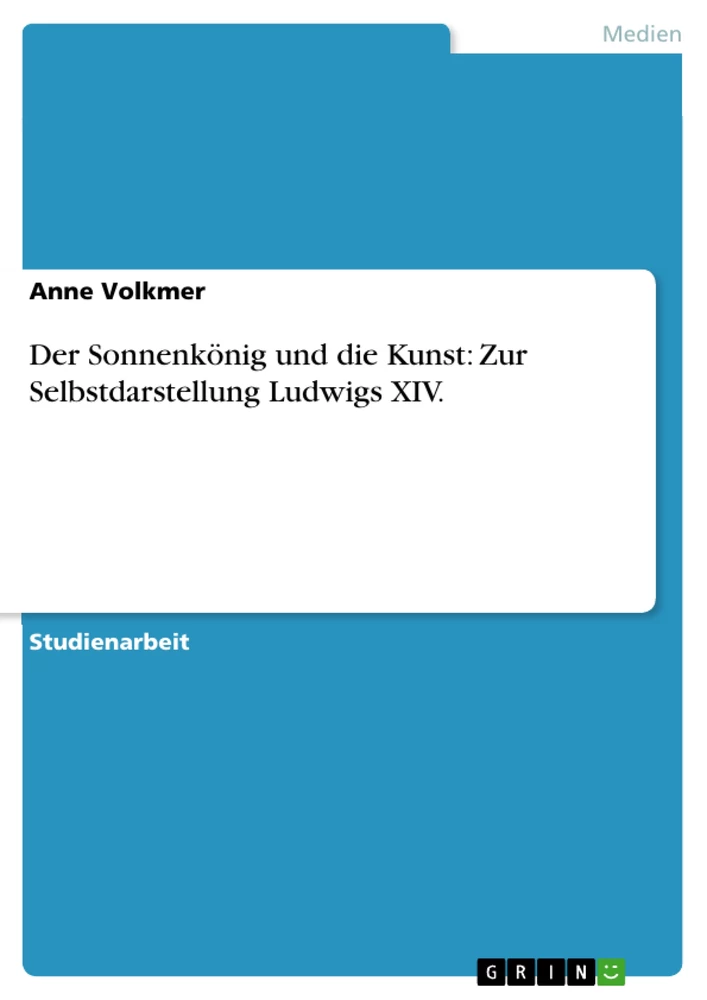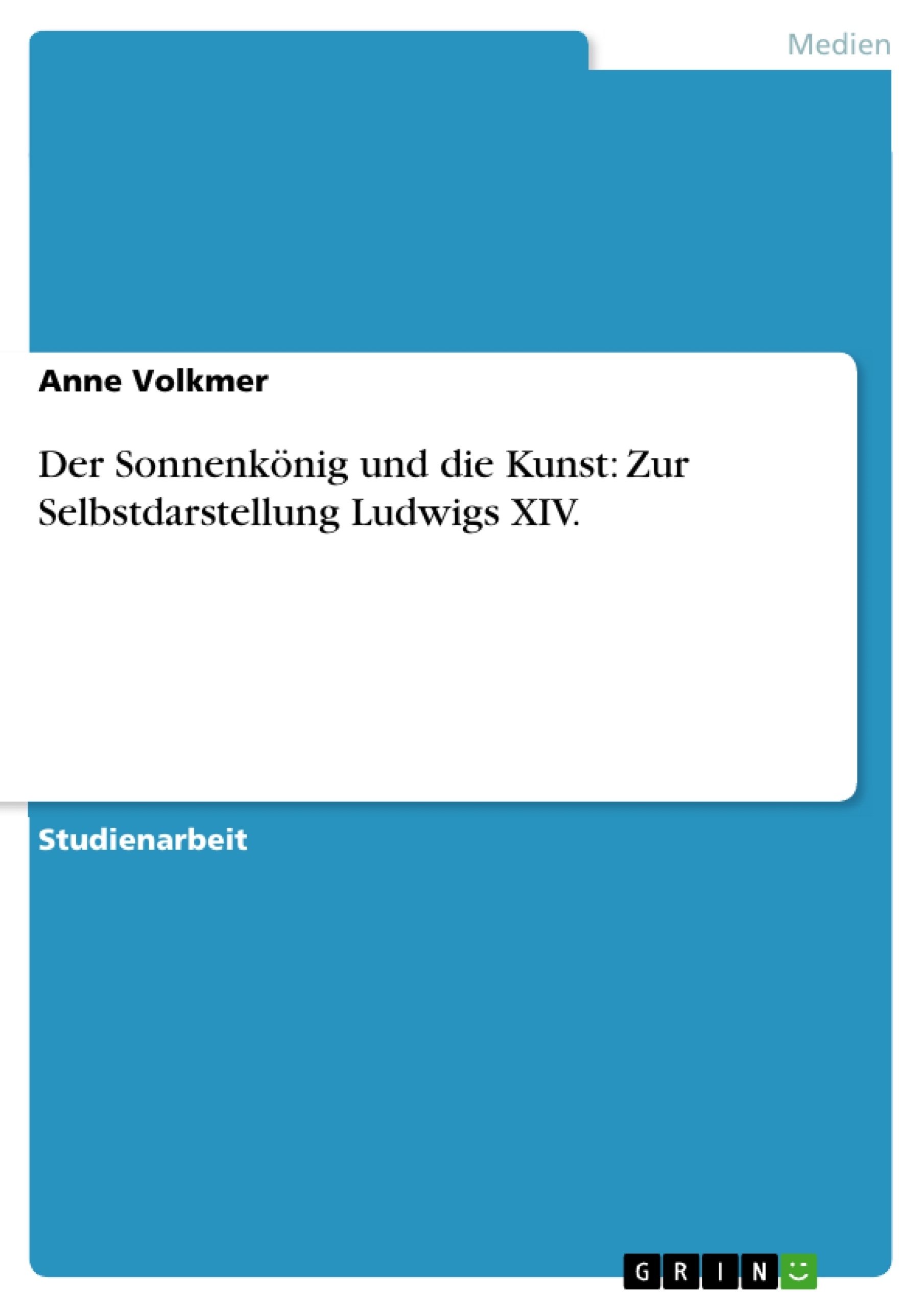Ludwig XIV., auch bekannt als „der Sonnenkönig“, gilt als einer der außergewöhnlichsten und herausragenden Monarchen der Geschichte. Seine Herrschaft repräsentiert den Höhepunkt der absolutistischen Monarchie in Europa. Im Jahre 1643 folgte er im Alter von vier Jahren seinem Vater, dem unumschränkten Alleinherrscher Ludwig XIII. auf den Thron, den er 72 Jahre lang innehatte. Zunächst führte Kardinal Mazarin als Leitender Minister die Staatsgeschäfte, nach dessen Tod übte Ludwig XIV. die Regierungsgeschäfte selbstständig aus, was den Beginn seiner Alleinherrschaft einleitete. Unter der Regentschaft Ludwigs XIV. erlebte Frankreich einen einschneidenden und folgenreichen Wandel, der sowohl politische als auch kulturelle und wirtschaftliche Maßstäbe setzte. Auch die Kunst war von diesem Wandel betroffen: In nie zuvor dagewesener Weise zentralisierte Ludwig XIV. die Künste im absolutistischen Frankreich und stellte sie in die Dienste des Hofes und der Verherrlichung seiner Person.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die bildenden Künste unter Ludwig XIV.
3. Die Selbstdarstellung Ludwigs XIV. mit den Mitteln der Kunst
4. Das Staatsportrait von Hyacinthe Rigaud
5. Der Gemäldezyklus im Spiegelsaal von Schloss Versailles
6. Fazit
7. Literaturverzeichnis
- Citation du texte
- Anne Volkmer (Auteur), 2012, Der Sonnenkönig und die Kunst: Zur Selbstdarstellung Ludwigs XIV., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211558