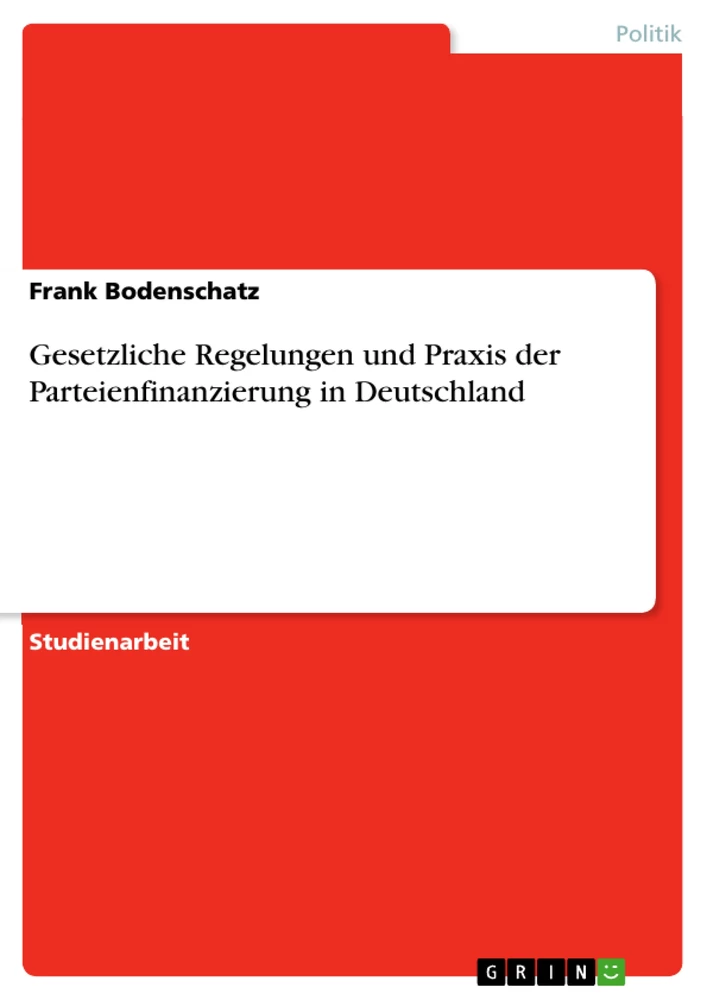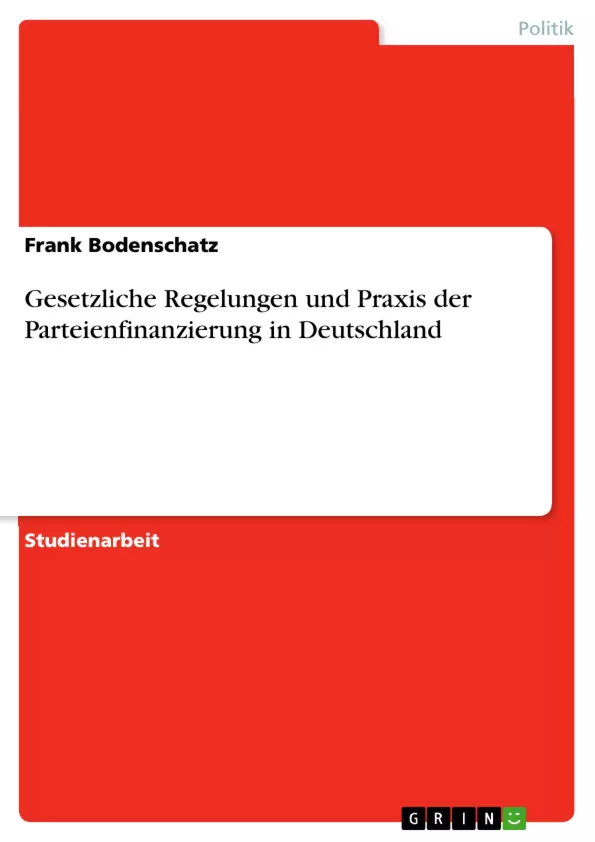Parteien sind in einer parlamentarischen Demokratie die wichtigste Organisationsform der politischen Interessenvertretung. Doch woher nehmen sie die finanziellen Mittel für die Bezahlung ihrer Funktionäre, die Kosten ihrer eigenen Verwaltung, die Arbeit in den Gremien sowie teils aufwendige und teure Wahlkämpfe? Die Finanzierung politischer Parteien in der Bundesrepublik Deutschland ist ein weit gefächertes Thema, welches medial in der Regel nur Platz für Randnotizen eingeräumt bekommt. Es rückt meist erst dann in den Blickpunkt der breiten Öffentlichkeit, wenn zum wiederholten Male eine Parteispendenaffäre die politische Landschaft – und mit ihr das Vertrauen der Bevölkerung in die Demokratie – erschüttert. Ich möchte mit dieser Arbeit folgende Punkte untersuchen: Welche Möglichkeiten gibt es in Deutschland, um das Wirken der Parteien zu finanzieren? Welche Vor- und Nachteile haben diese? Und welche Einzelaspekte sind in Hinblick auf die Rolle von Parteien im demokratischen System als fragwürdig anzusehen? Gegenstand meiner Betrachtungen wird das System in der heute existierenden Form sein.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Aufbau
2 Arten der Parteienfinanzierung: Gesetzliche Regelungen, parteiliche Praxis
2.1 Einführung
2.2 Staatliche Mittel
2.3 Mitglieds- und Mandatsträgerbeiträge
2.4 Spenden von natürlichen und juristischen Personen
2.5 Wirtschaftliche Betätigung
3 Kritische Betrachtung von bestehenden Regelungen und Parteipraxis
4 Schlusswort
5 Bibliografie
1 Einleitung
1.2 Problemstellung
Parteien sind in einer parlamentarischen Demokratie die wichtigste Organisationsform der politischen Interessenvertretung. Doch woher nehmen sie die finanziellen Mittel für die Bezahlung ihrer Funktionäre, die Kosten ihrer eigenen Verwaltung, die Arbeit in den Gremien sowie teils aufwendige und teure Wahlkämpfe?
Die Finanzierung politischer Parteien in der Bundesrepublik Deutschland ist ein weit gefächertes Thema, welches medial in der Regel nur Platz für Randnotizen eingeräumt bekommt. Es rückt meist erst dann in den Blickpunkt der breiten Öffentlichkeit, wenn zum wiederholten Male eine Parteispendenaffäre die politische Landschaft - und mit ihr das Vertrauen der Bevölkerung in die Demokratie - erschüttert.[1]
Ich möchte mit dieser Arbeit folgende Punkte untersuchen: Welche Möglichkeiten gibt es in Deutschland, um das Wirken der Parteien zu finanzieren? Welche Vor- und Nachteile haben diese? Und welche Einzelaspekte sind in Hinblick auf die Rolle von Parteien im demokratischen System als fragwürdig anzusehen? Gegenstand meiner Betrachtungen wird das System in der heute existierenden Form sein.
1.2 Aufbau
Zunächst werde ich in Kapitel 2 nach einer allgemein gehaltenen Einleitung auf die bedeutendsten Finanzierungsarten mithilfe einführender Unterkapitel eingehen, und die ihnen obliegenden gesetzlichen beziehungsweise innerparteilichen Regelungen darlegen. Dabei werden sowohl staatliche Teilfinanzierung und Mitgliederbeiträge als auch Spenden und eigene wirtschaftliche Tätigkeiten der Parteien thematisiert.
Im Anschluss daran folgt mit Kapitel 3 die kritische Betrachtung der bestehenden Re- gelungen und deren praktischer Anwendung. Dieser Punkt stellt zugleich auch das zentrale Anliegen meiner Arbeit dar und wird aus diesem Grund den größten Raum einnehmen.
Kapitel 4 wird eine Schlussbetrachtung enthalten, in der ich ein Fazit ziehen und auf weiterführende Fragen eingehen werde, die im Rahmen der Recherche aufkamen, um mit einem Ausblick auf die künftige Relevanz des Themas Parteienfinanzierung in Politik und öffentlicher Diskussion zu schließen.
2 Arten der Parteienfinanzierung: Gesetzliche Regelungen, parteiliche Praxis
2.1 Einführung
Dass Parteien im demokratischen System der Bundesrepublik Deutschland eine verfassungstragende Rolle spielen wird allein schon daran deutlich, dass ihnen - im Gegensatz etwa zu Interessenverbänden und Vereinen - mit Artikel 21 ein eigener Abschnitt im Grundgesetz (GG) gewidmet ist. Heiner Geißler (CDU) erklärte dazu: „Wir müssen in Deutschland immer wieder klar sagen, daß es ohne politische Parteien keine Demokratie gibt. (...) Die Vorstellungen von Basisdemokratie oder von einer Führergestalt, die den Kurs bestimmt, sind romantische und elitäre Mißverständnisse. Eine wirklich lebendige und funktionierende Demokratie kann es ohne politische Parteien nicht geben “[2].
Neben grundsätzlichen Aufgaben (Mitwirkung an der politischen Willensbildung) und Formalia (freie Gründung und innerparteiliche Demokratie, Systemkonformität)[3] kann man bereits im ersten Absatz einen wichtigen Hinweis finden, der die Parteienfinanzierung direkt betrifft: Parteien „müssen über die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Ver- mögen öffentlich Rechenschaft geben“[4]. Weiter heißt es: „Das Nähere regeln Bundesgeset- ze“[5], maßgeblich dabei ist insbesondere das Gesetz über die politischen Parteien (PartG). Selbiges behandelt im vierten bis sechsten Abschnitt sowohl die staatliche Finanzierung als auch die Rechenschaftslegung, welche neben den Ausgabepositionen sämtliche Einnahme- quellen im Detail offenbart. Nachfolgend werden die wichtigsten vorgestellt.
2.2 Staatliche Mittel
Die Höhe der staatlichen Parteienfinanzierung sowie deren Grundsätze sind in Paragraf 18 PartG dargelegt. Danach handelt es sich um eine Teilfinanzierung, deren Höchstgrenze derzeit bei 133 Millionen Euro im Jahr für alle Parteien liegt (absolute Obergrenze). Für einzelne Parteien darf deren Anteil die Summe ihrer Einnahmen nicht überschreiten (relative Obergrenze). Nach Veröffentlichung der Rechenschaftsberichte hat der Bundestag die Möglichkeit, die absolute Obergrenze nach statistischen Gesichtspunkten (Preisindex) anzupassen.[6] Außerdem kann der Bundespräsident „eine Kommission unabhängiger Sachverständiger zu Fragen der Parteienfinanzierung berufen“[7].
Grundlage für die Verteilung der staatlichen Mittel unter den Parteien sind deren Wahlergebnisse bei Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen. Für jede gültige Stimme, die eine zugelassene Liste erhält, werden 0,70 Euro an die jeweilige Partei ausgezahlt, bis maximal vier Millionen Stimmen sind es sogar 0,85 Euro. Voraussetzung ist, dass die Partei- en mindestens 0,5 Prozent der gültigen Stimmen bei Europa- oder Bundestagswahlen, be- ziehungsweise ein Prozent der gültigen Stimmen bei Landtagswahlen erreichen. Für Partei- en ohne zugelassene Landesliste sind 10 Prozent der gültigen Stimmen in einem Wahlkreis vonnöten um in den Genuss staatlicher Teilfinanzierung zu kommen. Parteien nationaler Minderheiten sind nicht von derartigen Regelungen betroffen. Neben der Würdigung von Stimmenanteilen spielen auch Zuwendungen in Form von Mitglieds-, Mandatsträger- oder Spendenbeiträgen eine wichtige Rolle: Für jeden so eingenommenen Euro erhalten die Par- teien weitere 0,38 Euro an staatlichen Mitteln, allerdings werden dabei nur Zahlungen von höchstens 3.300 Euro je natürliche Person und Jahr bezuschusst.[8] Bei Verbot oder Auflö- sung einer Partei fällt diese ab dem Zeitpunkt der Auflösung aus der staatlichen Teilfinanzie- rung heraus.[9]
Die staatliche Parteienfinanzierung macht im Schnitt circa ein Drittel der Gesamteinnahmen der Parteien aus, wobei sich eine klare Tendenz dahingehend erkennen lässt, dass kleine Parteien stärker von einer staatlichen Finanzierungshilfe abhängig sind.[10]
2.3 Mitglieds- und Mandatsträgerbeiträge
Bis auf die Pflicht zur Veröffentlichung im Rechenschaftsbericht gibt es für Parteien hinsichtlich der Finanzierung durch Mitglieds- und Mandatsträgerbeiträge keine besonderen gesetzlichen Bestimmungen. In Paragraf 27 Absatz 1 PartG werden Mitgliedsbeiträge als regelmäßige „Geldleistungen, die ein Mitglied auf Grund satzungsrechtlicher Vorschriften entrichtet“ und Mandatsträgerbeiträge als „regelmäßige Geldleistungen, die ein Inhaber eines öffentlichen Wahlamtes (Mandatsträger) über seinen Mitgliedsbeitrag hinaus leistet“ definiert. Über die Höhe dieser Beiträge können die Parteien selbst entscheiden.
Mitgliedsbeiträge orientieren sich in der Regel am monatlichen Brutto- oder Nettoein- kommen[11] der Mitglieder, die sich - oft nicht zur Zufriedenheit der Schatzmeister - anhand einer Beitragsstaffel selbst einschätzen.[12] Folglich hängen die Gesamteinnahmen in diesem Bereich unmittelbar von der Gesamtzahl der Mitglieder und deren (angegebenem) Einkom- men ab. Über Höhe und Ausgestaltung der allen Parteigliederungen zugute kommenden,
[...]
[1] Besonders bekannt ist die sogenannte und - bis auf die Grünen - alle damals im Bundestag vertretenen Parteien betreffende „Flick-Affäre“ in den 1980er Jahren. Auch die CDU-Spendenaffäre gut eine Dekade später blieb vielen Menschen nachhaltig in Erinnerung. Aktuell wird diskutiert, inwiefern Unternehmensspenden in der jüngsten Vergangenheit die Parteipolitik und Regierungsarbeit der FDP beeinflusst haben könnten.
[2] Geißler, Heiner: Statement. In: Tsatsos, Dimitris Th. (Hrsg.): Politikfinanzierung in Deutschland und in Europa. Aspekte aus Wissenschaft und Politik, Baden-Baden 1997, S. 21.
[3] Vgl. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Art. 21 (1) und (2), unter: http://www.gesetze-im- internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf (abgerufen am 22.02.2010).
[4] Ebd., Art. 21 (1).
[5] Ebd., Art. 21 (3).
[6] Vgl. Gesetz über die politischen Parteien, §18 (2), (5) und (6), unter: http://www.gesetze-im- internet.de/bundesrecht/partg/gesamt.pdf (abgerufen am 23.02.2010).
[7] Ebd., §18 (7).
[8] Vgl. Gesetz über die politischen Parteien, §18 (3) und (4), unter: http://www.gesetze-im- internet.de/bundesrecht/partg/gesamt.pdf (abgerufen am 23.02.2010).
[9] Vgl. ebd., §18 (8).
[10] Vgl. Deutscher Bundestag: Bekanntmachung von Rechenschaftsberichten politischer Parteien für das Kalenderjahr 2008 (1. Teil - Bundestagsparteien), Drucksache 17/630 vom 02.02.2010, unter: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/006/1700630.pdf (abgerufen am 26.02.2010).
[11] Vgl. dazu die Mitgliedschaftsanträge von CDU, unter: http://www.mitglied-werden.cdu.de/doc/081023-mitgliedsantrag- online.pdf, bzw. SPD, unter: http://www.spd.de/de/pdf/mitglieder/230206_beitrittserklaerung.pdf (beide abgerufen am 26.02.2010).
[12] Vgl. Adams, Karl-Heinz: Parteienfinanzierung in Deutschland. Entwicklung der Einnahmestrukturen politischer Parteien oder eine Sittengeschichte über Parteien, Geld und Macht, Marburg 2005, S. 251.
Häufig gestellte Fragen
Wie finanzieren sich politische Parteien in Deutschland?
Die Finanzierung setzt sich aus staatlichen Mitteln, Mitgliedsbeiträgen, Mandatsträgerbeiträgen, Spenden und eigener wirtschaftlicher Betätigung zusammen.
Was besagt die "absolute Obergrenze" bei der staatlichen Finanzierung?
Es ist der gesetzlich festgelegte Gesamtbetrag (derzeit ca. 133 Mio. Euro), den der Staat jährlich maximal an alle Parteien insgesamt ausschütten darf.
Wie werden die staatlichen Mittel auf die Parteien verteilt?
Die Verteilung basiert primär auf den Wahlergebnissen (Stimmenanteile) bei Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen sowie auf der Höhe der gesammelten Spenden und Beiträge.
Sind Parteien zur Offenlegung ihrer Finanzen verpflichtet?
Ja, gemäß Art. 21 Grundgesetz müssen Parteien über die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft ablegen.
Was sind Mandatsträgerbeiträge?
Das sind regelmäßige Geldleistungen, die Inhaber öffentlicher Wahlämter (z.B. Abgeordnete) zusätzlich zu ihrem normalen Mitgliedsbeitrag an ihre Partei leisten.
- Quote paper
- Frank Bodenschatz (Author), 2010, Gesetzliche Regelungen und Praxis der Parteienfinanzierung in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211612