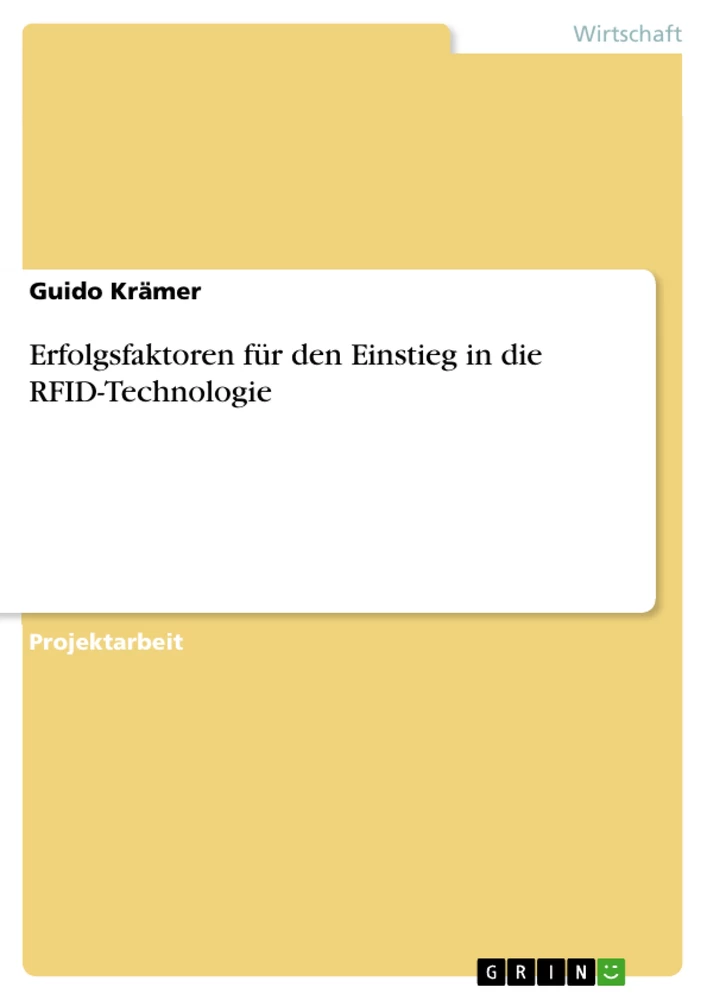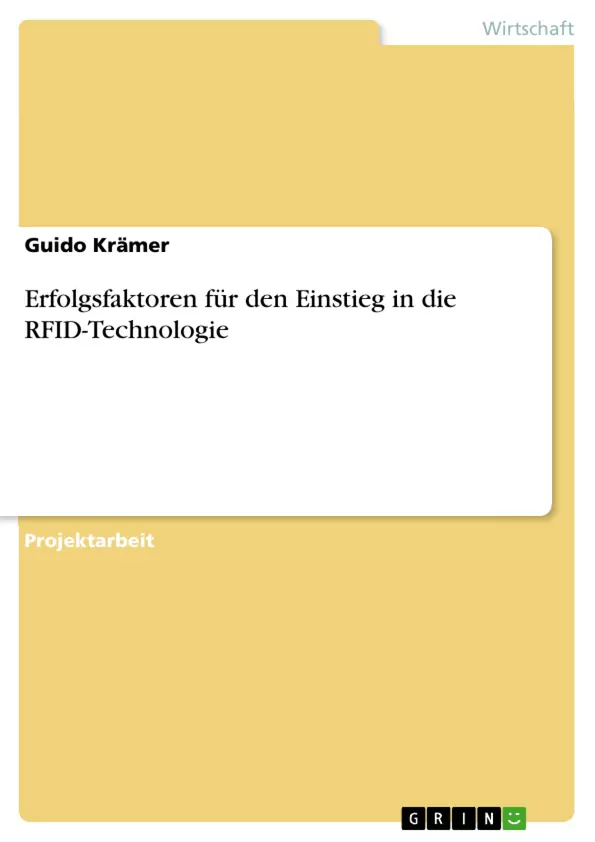Die RFID-Technologie ist derzeit in der Wirtschaft als Top IT-Thema heftig in der Diskussion und wird oftmals als revolutionäre Entwicklung für die Logistik und für andere Branchen bezeichnet. Die Technologie zur automatisierten kontaktlosen Datenerfassung wird in der Literatur und der Forschung als Schlüssel für die Echtzeiterfassung von Warenströmen, Produkten und bis hin zum kompletten Echtzeitunternehmen benannt. Häufig fällt in diesem Zusammenhang auch die Bezeichnung „Internet der Dinge“. Dies steht für die Vision, dass das Internet ein Teil der physikalischen Welt wird und dass jeder Gegenstand in der realen Welt auch umgekehrt zum Teil des Internets werden kann. Hierdurch entstehen ungeahnte Möglichkeiten für die Wirtschaft, als auch für jedes einzelne Individuum. Dabei ist diese Technologie schon über 60 Jahre alt. Am Ende des zweiten Weltkriegs entwickelte das US-Militär ein Sekundärradar-System namens „Identification Friend or Foe“. Dies sollte durch an Fahr- und Flugzeugen angebrachten Transpondern die Identifizierung auf Freund und Feind ermöglichen. Das US-Militär hatte so die Vorstellung Eigenbeschuss vermeiden zu können. 1948 wurde die RFID-Technologie das erste Mal erwähnt, aber traf zu dieser Zeit noch nicht die Aufmerksamkeit der Wirtschaft. Zu diesem Zeitpunkt verfasste Harry Stockman das Buch „Communication by Means of Reflected Power“ und hat damit den Grundstein für die RFID-Technologie mit gelegt. Bis zur kommerziellen Nutzung dauerte es rund zehn Jahre, erstmals als Sicherung von Bekleidungsartikeln (EAS). Mit der Entwicklung von Miniaturchips und damit einhergehenden Massenherstellungen, haben sich die Einsatzmöglichkeiten vervielfältigt, wie der Einsatz bei der Wildtieridentifikation, elektronischen Ausweisdokumenten oder RFID-Mautsystemen in den USA zeigte. Die öffentliche Thematisierung der RFID-Technologie und den großangelegten Probeeinsätzen in Handelsunternehmen, wie Wal-Mart, Metro und Tesco, verschaffte dieser Technologie zunehmende Bedeutung und trieb die Entwicklung massiv voran. Mittlerweile profitieren nicht nur der Handel von der Technologie, sondern auch die Logistik, die Produktion und andere Bereiche. Obwohl sich die RFID-Technologie in den letzten Jahren rapide weiter entwickelt hat, lohnt sich der Einsatz noch nicht für jeden. Anhand dieser Arbeit soll geklärt werden, welches die Erfolgsfaktoren für den Einstieg in die RFID-Technologie sind.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Einführung in das Thema
1.2 Gang der Untersuchung
2 Technischer Aufbau von RFID-Systemen
2.1 Einordnung in die Auto-ID Systeme
2.2 Begriffserklärung und Funktionsweise von RFID-Systemen
2.3 Zusammensetzung eines RFID-Systems
2.4 Funktionsweise
2.4.1 Frequenzen
2.4.2 Reichweiten
2.4.3 Datenübertragung
3 Anwendungsbereiche RFID
4 Erfolgsfaktoren
4.1 Vorteile der RFID-Technologie
4.2 Grenzen der RFID-Technologie
4.3 Für wen lohnt der Einstieg in die RFID-Technologie
5 Resümee und Ausblick
6 Glossar
7 Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist RFID-Technologie?
RFID steht für „Radio Frequency Identification“ und bezeichnet ein System zur automatisierten, kontaktlosen Identifizierung und Datenerfassung mittels Radiowellen.
Aus welchen Komponenten besteht ein RFID-System?
Ein System besteht im Wesentlichen aus einem Transponder (Tag), der die Daten speichert, und einem Lesegerät (Reader), das die Daten empfängt und verarbeitet.
In welchen Bereichen wird RFID eingesetzt?
Typische Einsatzgebiete sind die Logistik (Warenverfolgung), der Handel, die Produktion, Mautsysteme und elektronische Ausweisdokumente.
Was sind die Vorteile von RFID gegenüber dem Barcode?
RFID ermöglicht das Auslesen ohne direkten Sichtkontakt, die gleichzeitige Erfassung mehrerer Tags (Pulklesung) und das Überschreiben von Daten auf dem Transponder.
Wann lohnt sich der Einstieg in die RFID-Technologie für ein Unternehmen?
Der Einstieg lohnt sich, wenn die Prozessvorteile (z.B. Echtzeit-Transparenz, Fehlerreduktion) die Kosten für Hardware, Software und Transponder übersteigen.
- Quote paper
- Guido Krämer (Author), 2012, Erfolgsfaktoren für den Einstieg in die RFID-Technologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211896