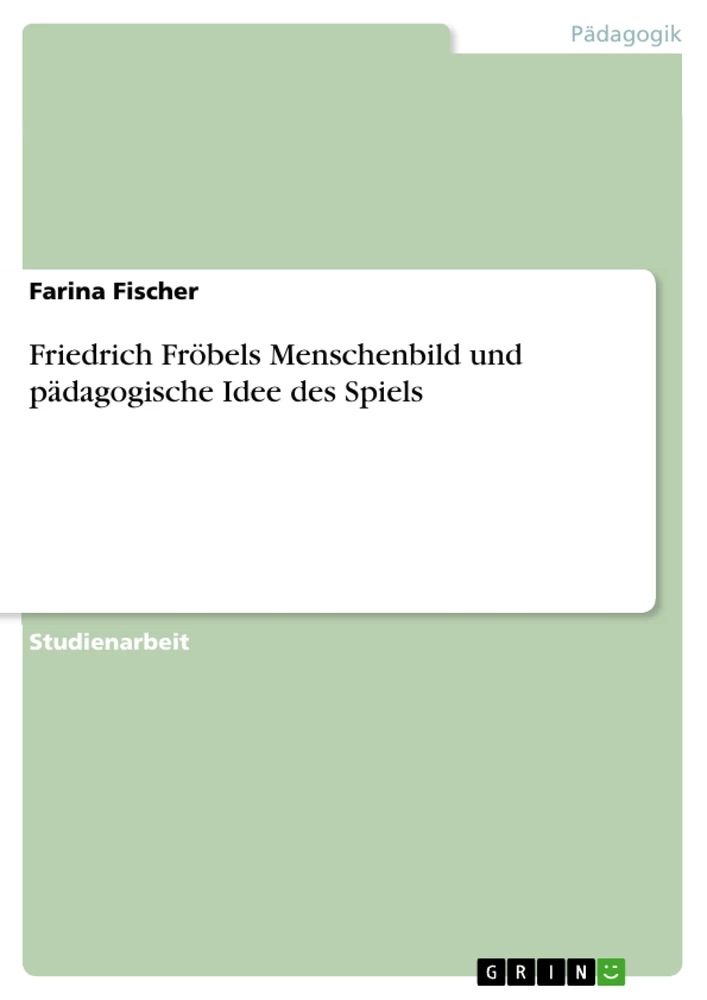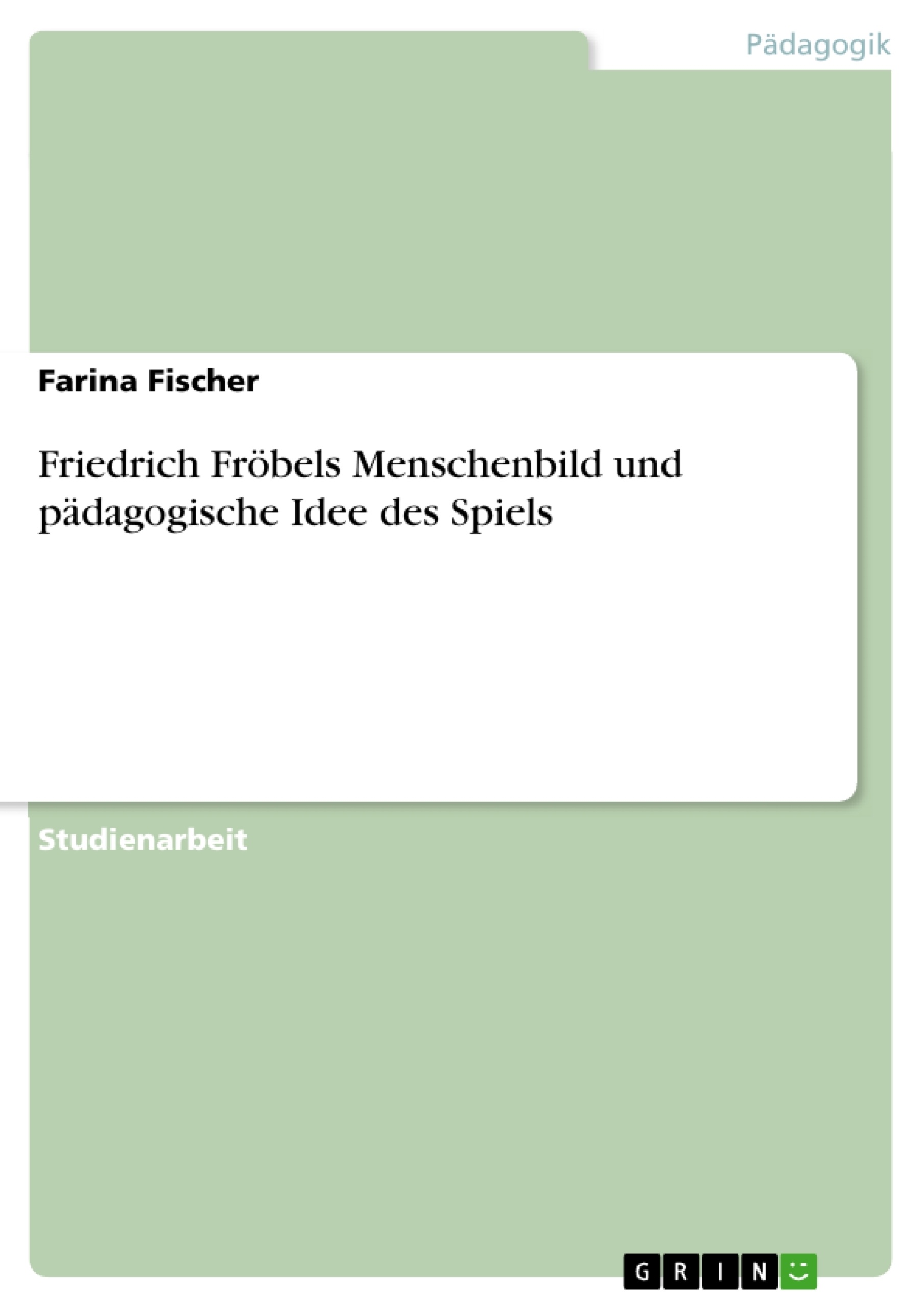Ich werde in dieser Arbeit das Lebenswerk Friedrich Fröbels wiedergeben und Teile seiner Texte, Methoden und Vorgehensweisen analysieren. Ich habe mich entschieden über Fröbel zu schreiben, da er nicht nur der eigentliche Urheber des Kindergartens, einer für die Gesellschaft unerlässliche Einrichtung, sondern da auch seine Praktiken dort von solch einer Qualität waren, dass sich seine Idee dieser Einrichtung schnell verbreitete und sich in der Gesellschaft etablierte, sodass sie heute ein essenzieller Bestandteil von Bildung und Erziehung ist.
Ich beginne diese Arbeit mir der Erläuterung der Motive Fröbels. Um seine Intention und seinen Ansporn nachvollziehen zu können, muss man seinen Lebensweg und ganz explizit seine Kindheit kennen. Aus diesem Grund befasse ich mich im ersten Kapitel ausgiebig mit dem Leben Fröbels, da dieses Wissen zum Verständnis seiner Praktiken erheblich beiträgt.
Im folgenden Teil werde ich das Menschenbild Fröbels, wie auch das, das er vom Kinde hatte, beschreiben, denn genau dieses Menschenbild war es, das Fröbel zur Gründung des Kindergartens bewegte, denn er hatte von diesem die Aufgabe abgeleitet den Menschen in den frühen Phasen seines Lebens angemessen zu erziehen und zu fördern. Diese Erkenntnis ist für das Verstehen seiner Verfahrensweise von fundamentaler Bedeutung, da ganz besonders seine Unterteilung der Kindheit in Phasen auch seine phasenspezifische Handlungsweise erklärt, daher werde ich auch diese ausreichend erläutern.
Im weiteren Verlauf meiner Arbeit durchleuchte ich den Prozess, beziehungsweise seine Methodik an sich, die sogenannte Spieltheorie Fröbels. Die Spieltheorie werde auf detaillierte Art und Weise analysieren und präzise in Prozessabschnitte gliedern, sodass die Absicht jeder einzelnen Handlung sichtbar und nachvollziehbar wird. Nach Beschreibung dieses Ablaufes stelle ich dann die Umweltbedingungen, unter denen dies zur Anwendung kommt, dar. Mit Umweltbedingungen meine ich nicht nur das Umfeld des Kindes, sondern auch das Verständnis, das Fröbel von einem Kindergarten hatte und seine Prämissen für die korrekte Anwendung der Spieltheorie. Abschließen werde ich diese Arbeit mit einem Aktualitätsbezug.
Inhaltverzeichnis
1. Einleitung
2. Fröbels Leben
3. Fröbels Menschenbild
3.1 Fröbels Menschenbild des Kindes
3.1.1 Das Säuglingsalter
3.1.2 Das Kindesalter
3.1.3 Das Knabenalter
4. Fröbels Spieltheorie
4.1 Die erste Gabe
4.2 Die zweite Gabe
4.3 Die dritte und vierte Gabe
4.4 Die fünfte und sechste Gabe
4.5 Weitere Spiele
4.6 Mutter- und Koselieder
5. Der Kindergarten
6. Aktualität
7. Fazit
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hat Friedrich Fröbel für das heutige Bildungssystem?
Friedrich Fröbel ist der Urheber des Kindergartens. Seine pädagogischen Ideen und Methoden haben sich weltweit etabliert und sind heute ein essenzieller Bestandteil der frühkindlichen Bildung und Erziehung.
Was versteht Fröbel unter seiner "Spieltheorie"?
Fröbel sah das Spiel als die höchste Stufe der Kindesentwicklung an. Durch das Spiel setzt sich das Kind aktiv mit der Welt auseinander. Zur Unterstützung entwickelte er die sogenannten „Spielgaben“.
Was sind die Fröbelschen "Gaben"?
Die Gaben sind spezifische Spielmaterialien (z. B. Bälle, Würfel, Zylinder), die aufeinander aufbauen und dem Kind helfen, geometrische Formen, Strukturen und Zusammenhänge in der Umwelt zu begreifen.
Wie unterteilte Fröbel die Phasen der Kindheit?
Fröbel unterschied zwischen dem Säuglingsalter, dem Kindesalter und dem Knabenalter. Jede Phase erfordert laut ihm eine spezifische Förderung und pädagogische Herangehensweise.
Welches Menschenbild vertrat Friedrich Fröbel?
Sein Menschenbild war geprägt von der Überzeugung, dass der Mensch von Natur aus gut ist und ein göttliches Prinzip in sich trägt, das durch Erziehung und Spiel zur Entfaltung gebracht werden muss.
- Quote paper
- Farina Fischer (Author), 2011, Friedrich Fröbels Menschenbild und pädagogische Idee des Spiels, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211990