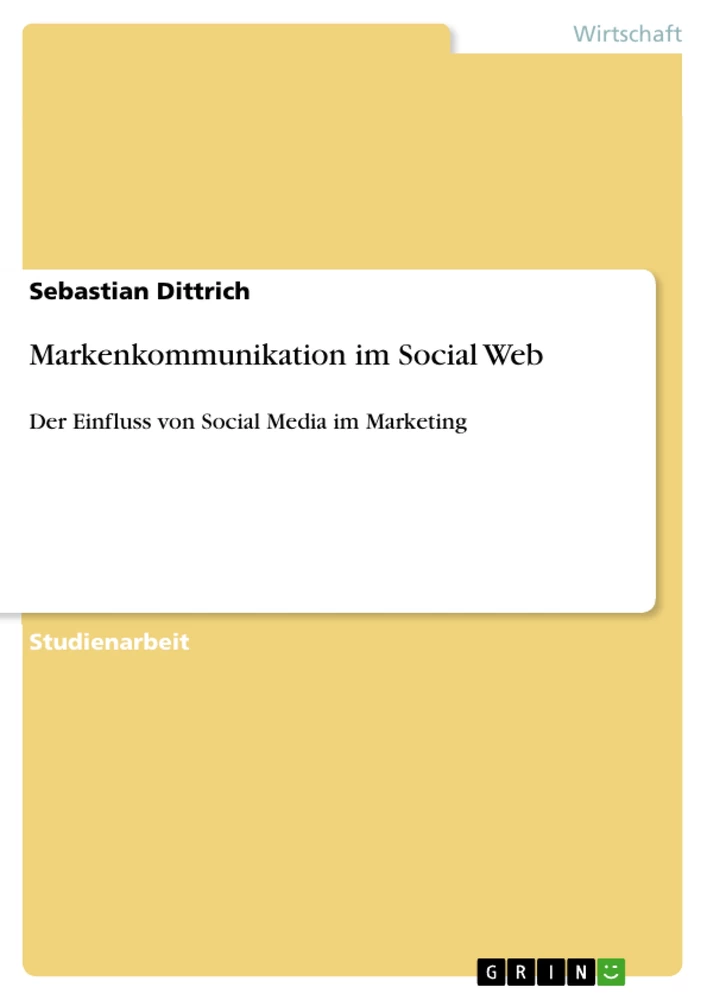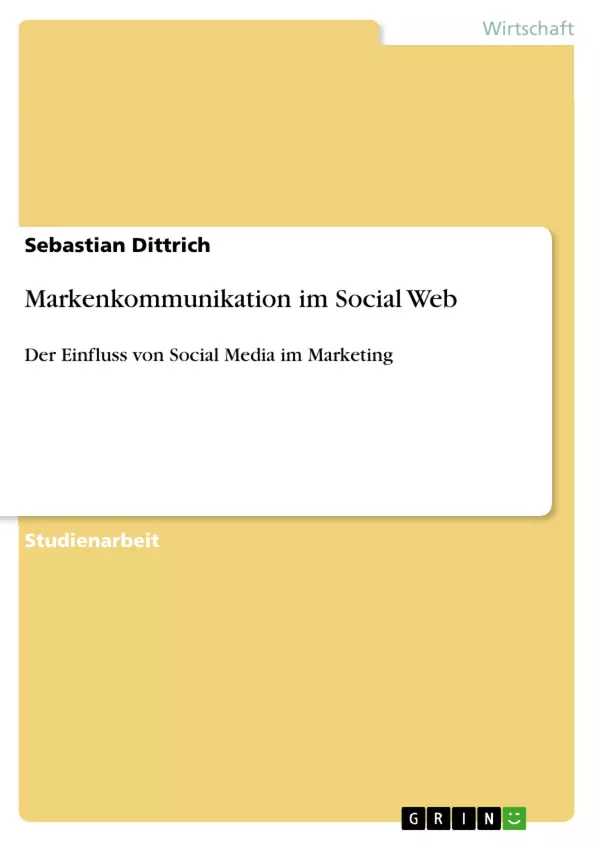Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis III
1. Einleitung 1
1.1 Problemstellung 1
1.2 Zielsetzung 2
2. Theoretische Grundlagen 3
2.1 Konzeptionelle Grundlagen von Social Web 3
2.1.1 Web 2.0 3
2.1.2 Social Software 4
2.1.3 Social Media 4
2.1.4 Social Web 5
2.2 Konzeptionelle Grundlagen der Markenkommunikation 6
2.2.1 Definition 6
2.2.2 Marke 6
2.2.2.1 Bedeutung von Marken 7
2.2.3 Markenimage und Markenidentität 7
2.2.4 Kommunikation aus Sicht des Marketing 8
3. Herausforderung Social Web 9
3.1 Veränderung der Markenkommunikation durch Social Web 9
3.2 Bedeutung von Word of Mouth 10
3.3 Chancen und Risiken für Unternehmen 10
4.Implikationen für die Markenkommunikation im Social Web 11
4.1 Unternehmenspositionierung 11
4.2 Viral Marketing 13
5. Fazit 14
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Problemstellung
Das Internet ist in Deutschland das drittwichtigste Medium nach TV und Radio mit Tendenz steigend. Inzwischen sind 46,3 Millionen Deutsche ab 14 Jahren im Internet anzutreffen, das bedeutet umgerechnet 69,1 Prozent der deutschen Wohnbevölkerung sind in den letzen 12 Monaten zumindest gelegentlich online gegangen. Auch die Verbreitung schneller Zugänge wächst - in 2009 nutzen 67 Prozent der Onliner einen Breitbandanschluss.
Die großflächige Verbreitung von schnellen Internetzugängen, die vereinfachte Technik der Publikationen und des Austausches im Netz, die zunehmende Medienkompetenz der Nutzer sowie die offene Haltung gegenüber neuen multimedialen Anwendungen führen zu einer rasanten Expansion des Internets in nahezu allen Lebensbereichen.
Im Internet wird recherchiert, kommuniziert, geflirtet, gespielt und vieles mehr. Das Internet bedeutet die Auflösung des Kriteriums Raum - eine Entgrenzung des Interaktionsraums, des Kommunikationsraums sowie des kulturellen Raums Es scheint fester Bestandteil des täglichen Lebens, beruflich und privat, geworden zu sein und aus der heutigen Welt kaum noch wegzudenken.
Dabei werden verstärkt Begriffe wie Social Media, Interaktivität, Web 2.0 und neuerdings auch der Begriff Viral Marketing genannt. Doch was hat es mit diesen Begriffen auf sich? Wie hängen diese zusammen und welche Auswirkung hat das auf das Internet? Welcher Zusammenhang besteht mit der Markenkommunikation?
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Zielsetzung
2. Theoretische Grundlagen
2.1 Konzeptionelle Grundlagen von Social Web
2.1.1 Web 2.0
2.1.2 Social Software
2.1.3 Social Media
2.1.4 Social Web
2.2 Konzeptionelle Grundlagen der Markenkommunikation
2.2.1 Definition
2.2.2 Marke
2.2.2.1 Bedeutung von Marken
2.2.3 Markenimage und Markenidentität
2.2.4 Kommunikation aus Sicht des Marketing
3. Herausforderung Social Web
3.1 Veränderung der Markenkommunikation durch Social Web
3.2 Bedeutung von Word of Mouth
3.3 Chancen und Risiken für Unternehmen
4.Implikationen für die Markenkommunikation im Social Web
4.1 Unternehmenspositionierung
4.2 Viral Marketing
5. Fazit
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Wie verändert das Social Web die Markenkommunikation?
Die Kommunikation wandelt sich von einer Einweg-Botschaft hin zu einem interaktiven Dialog, bei dem Nutzer aktiv Markenimages mitgestalten können.
Was ist Viral Marketing?
Viral Marketing nutzt soziale Netzwerke, um Werbebotschaften durch Mundpropaganda (Word of Mouth) schnell und exponentiell zu verbreiten.
Was versteht man unter Markenidentität und Markenimage?
Markenidentität ist das Selbstbild des Unternehmens, während das Markenimage das Fremdbild in den Köpfen der Konsumenten darstellt.
Welche Chancen bietet Social Media für Unternehmen?
Chancen liegen in der direkten Kundenbindung, schnellem Feedback, erhöhter Reichweite und der Möglichkeit zur kostengünstigen Markenpositionierung.
Was ist Social Software?
Social Software umfasst Anwendungen, die die menschliche Kommunikation und Zusammenarbeit im Internet unterstützen (z.B. Blogs, Wikis, soziale Netzwerke).
- Quote paper
- Sebastian Dittrich (Author), 2012, Markenkommunikation im Social Web, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212198