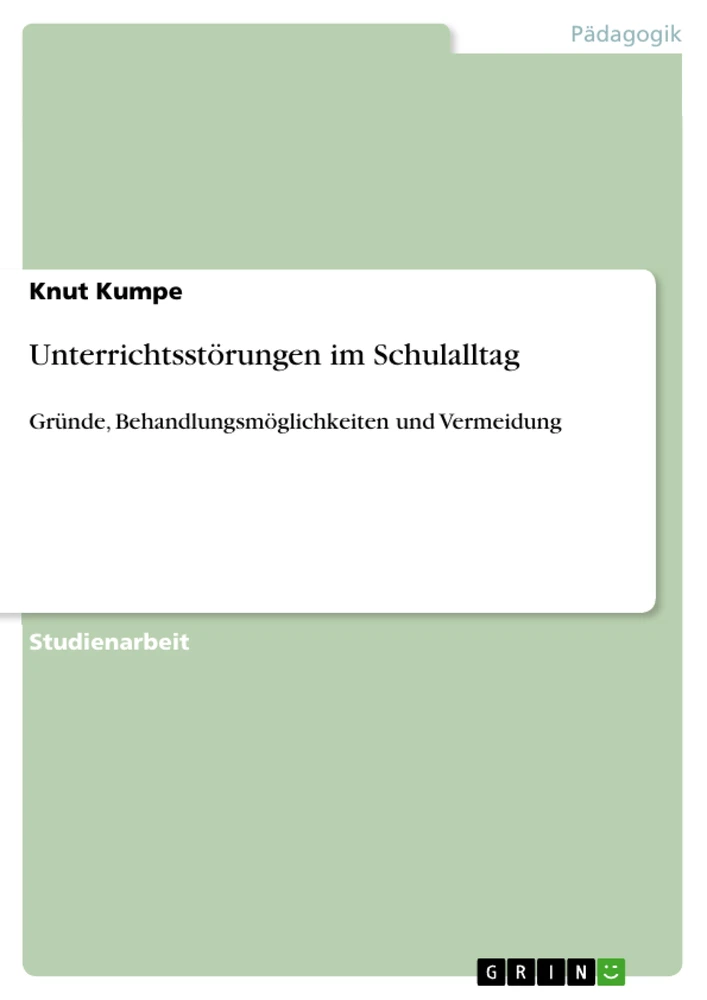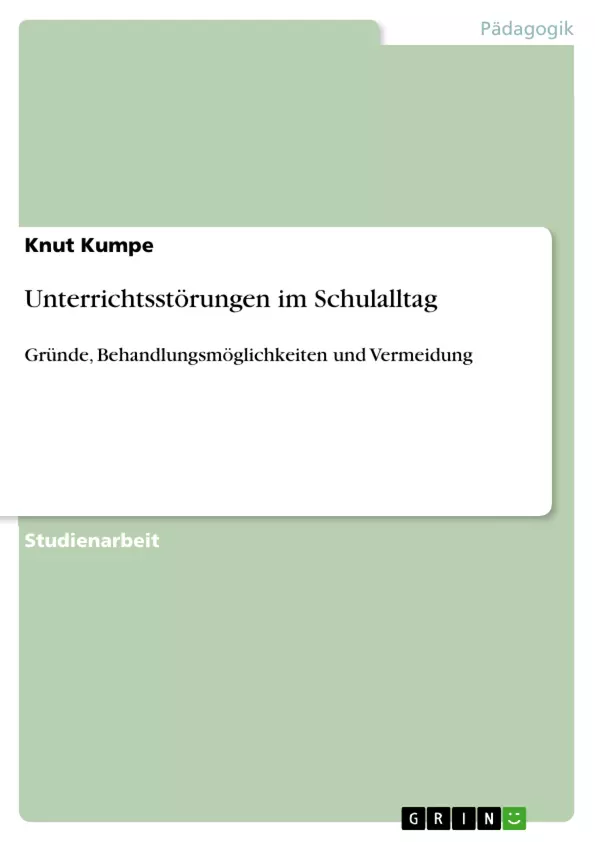Was als Störung wahrgenommen und in der Schulwelt als „Störung“ bezeichnet wird, entscheidet jeder Betrachter für sich selbst. Dazu zeige ich in meiner Arbeit auf, wie Experten die Situation einschätzen und wie man Störungen als LehrerIn bewältigen kann. Dabei liegt in diesem Abschnitt der Fokus darauf, zu erklären, wie überhaupt Störungen im Unterrichtsgeschehen entstehen.
Ich werde danach darauf eingehen, ob es möglich ist, jegliche Störung im und neben dem Unterricht generell zu vermeiden. Überdies werde ich Verhaltensweisen und Attribute eines guten Lehrers vorstellen, die ich für wertvoll und nützlich halte, um in der Lage zu sein, Störungen einzuschränken.
Ebenso stelle ich diverse Programme unterschiedlicher Institutionen vor, mit denen man als LehrerIn im Schulalltag Störungen entgegenwirken kann. Dabei kommt es mir darauf an, die Geschichte und Entwicklung der Programme vorzustellen, sowie die Abläufe und Regeln ebendieser aufzuzeigen. Diese Programme reichen von rechtlichen (z. B. Ordnungsmaßnahmen) bis hin zu pädagogischen Maßnahmen (z. B. das Trainingsraumprinzip oder schlechte Notengebung). Zudem wird in einem Kapitel dargestellt, wie Studienseminarleiter (hier exemplarisch das Studienseminar in Trier) das Problem bekämpfen. Diese Leiter geben in ihrem Bericht kostbare Hinweise für das Lehrerverhalten während und nach dem Unterricht.
Abschließend wird in dieser Arbeit ein endgültiges Fazit gegeben, um einen störungsarmen Unterricht zu gestalten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was sind Unterrichtsstörungen?
- Definitionen aus der Schulwelt
- Wie entstehen Störungen und was wird als solche empfunden?
- Wie kann ich als LehrerIn Störungen vermeiden?
- Lehrerverhalten im Unterricht
- Handlungsspektrum des Lehrers
- Charaktereigenschaften des Lehrers
- Was kann ich als LehrerIn bei Störungen tun?
- Rechtlicher Rahmen bzw. Ordnungsmaßnahmen
- Pädagogische Maßnahmen
- Schlechte Notengebung
- Pädagogische Inseln (Beispiel Matthias-Claudius-Förderschule, Kiel)
- Wie entstand der Begriff „Pädagogische Insel“?
- Entstehung der „Insel“ an der Matthias-Claudius-Förderschule, Kiel
- Allgemeine Gründe für den Verweis in die Insel
- Ablauf des Inselstunden
- Trainingsraumprinzip (alle Klassenstufen)
- Geschichte des Prinzips
- Ziele und Ablauf des Programms (Beispiel „Hauptschule an der Cincinnatistraße“, München)
- Welche Störungen sind für diese Methode geeignet?
- Ablauf des Programms
- Außerunterrichtlicher Exkurs: Streitschlichter-Programm (Beispiel Grundschule Lauenhagen)
- Begriffserklärung
- Ablauf der Streitschlichtung
- Meinungen aus der Schulwelt
- Empfehlungen der Leiter eines Studienseminars (hier: Trier)
- Empfehlungen im Umgang mit Unterrichtsstörungen
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen von Unterrichtsstörungen im Schulalltag und betrachtet die verschiedenen Aspekte von Entstehung, Behandlung und Vermeidung. Sie analysiert Ursachen und definiert Störungen aus verschiedenen Blickwinkeln, beleuchtet das Lehrerverhalten als präventives Mittel und stellt verschiedene Programme zur Bewältigung von Störungen vor.
- Definition und Entstehung von Unterrichtsstörungen
- Verhaltensweisen und Attribute eines guten Lehrers
- Pädagogische und rechtliche Maßnahmen zur Behandlung von Störungen
- Empfehlungen zum Umgang mit Unterrichtsstörungen aus verschiedenen Perspektiven
- Zusammenfassende Schlussfolgerungen zur Gestaltung eines störungsfreien Unterrichts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema Unterrichtsstörungen einführt und die verschiedenen Aspekte, die in den folgenden Kapiteln beleuchtet werden, vorstellt. Im zweiten Kapitel werden verschiedene Definitionen von Unterrichtsstörungen aus der Schulwelt erörtert, wobei die unterschiedlichen Perspektiven und Ansätze von Experten wie Gert Lohmann, Thomas Gordon, Rainer Winkel und Reinhold Ortner beleuchtet werden. Des Weiteren wird untersucht, wie Störungen im Unterricht entstehen und was von Lehrkräften als Störung wahrgenommen wird, wobei auch die Studie von Jacob S. Kounin aus dem Jahr 1976 mit ihren Ergebnissen zur Wahrnehmung von Störungen durch LehrerInnen berücksichtigt wird.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Frage, wie LehrerInnen Störungen im Unterricht vermeiden können. Es werden verschiedene Handlungsmöglichkeiten und Charaktereigenschaften von Lehrkräften vorgestellt, die einen positiven Einfluss auf das Klassenklima und damit auch auf die Entstehung von Störungen haben können.
Das vierte Kapitel widmet sich der Behandlung von Störungen im Unterricht. Verschiedene rechtliche Rahmenbedingungen und Ordnungsmaßnahmen werden vorgestellt, sowie verschiedene pädagogische Interventionen, wie die Schlechte Notengebung, das Konzept der Pädagogischen Inseln, das Trainingsraumprinzip und das Streitschlichter-Programm. Jeder dieser Ansätze wird im Detail vorgestellt, einschließlich seiner Entstehung, Ziele, Abläufe und Anwendungsmöglichkeiten.
Im fünften Kapitel werden Empfehlungen von Studienseminarleitern zum Umgang mit Unterrichtsstörungen vorgestellt, wobei exemplarisch das Studienseminar in Trier beleuchtet wird.
Schlüsselwörter
Unterrichtsstörungen, Lehrerverhalten, Pädagogische Maßnahmen, Ordnungsmaßnahmen, Schulalltag, Streitschlichtung, Trainingsraumprinzip, Pädagogische Inseln, Studienseminar
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Unterrichtsstörungen?
Unterrichtsstörungen sind Ereignisse, die den Lehr-Lern-Prozess unterbrechen oder beeinträchtigen. Was als Störung wahrgenommen wird, hängt oft von der individuellen Einschätzung der Lehrkraft ab.
Wie können Lehrer Störungen im Unterricht vermeiden?
Präventiv wirken ein souveränes Lehrerverhalten, klare Regeln, eine gute Vorbereitung und der Aufbau einer positiven Beziehung zu den Schülern.
Was ist das Trainingsraumprinzip?
Es ist ein Programm zur Bewältigung von Störungen, bei dem Schüler, die den Unterricht wiederholt stören, in einen separaten Raum gehen, um über ihr Verhalten nachzudenken und einen Rückkehrplan zu erstellen.
Was sind "Pädagogische Inseln"?
Dies sind spezielle Rückzugsorte oder Maßnahmen innerhalb der Schule, um Schülern in schwierigen Situationen pädagogische Unterstützung außerhalb des regulären Klassenunterrichts zu bieten.
Welche rechtlichen Maßnahmen gibt es bei Schulstörungen?
Lehrkräfte können auf Ordnungsmaßnahmen zurückgreifen, die im jeweiligen Schulgesetz verankert sind, wenn pädagogische Mittel nicht mehr ausreichen.
Welche Rolle spielt die Streitschlichtung im Schulalltag?
Streitschlichter-Programme fördern die soziale Kompetenz, indem Schüler lernen, Konflikte unter Gleichaltrigen selbstständig und ohne Eingreifen von Lehrern zu lösen.
- Arbeit zitieren
- Knut Kumpe (Autor:in), 2012, Unterrichtsstörungen im Schulalltag, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212267