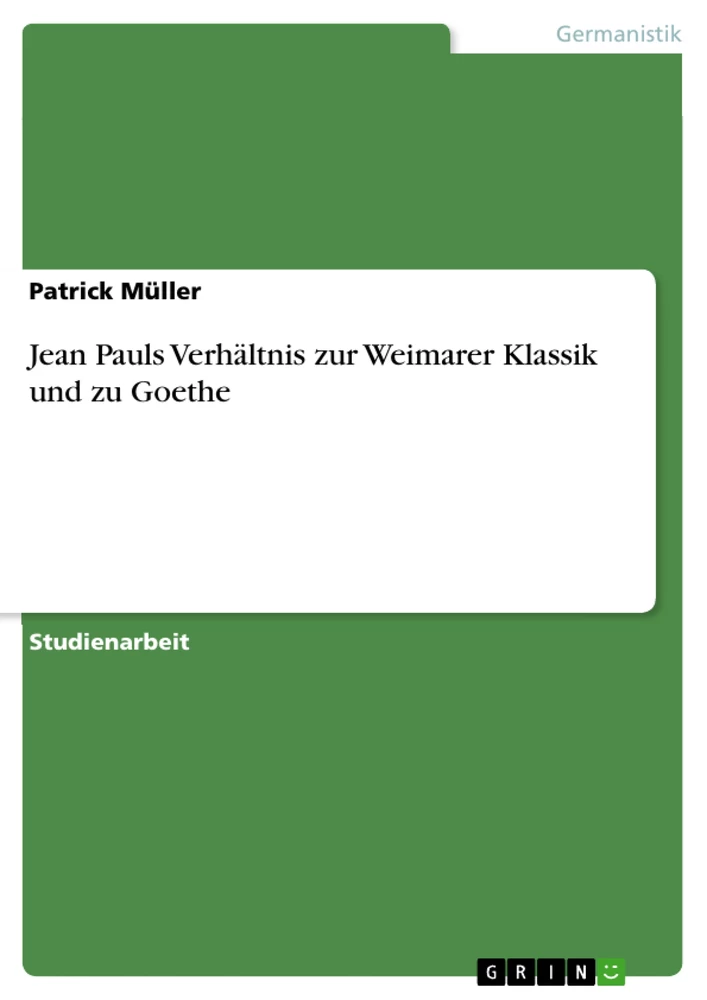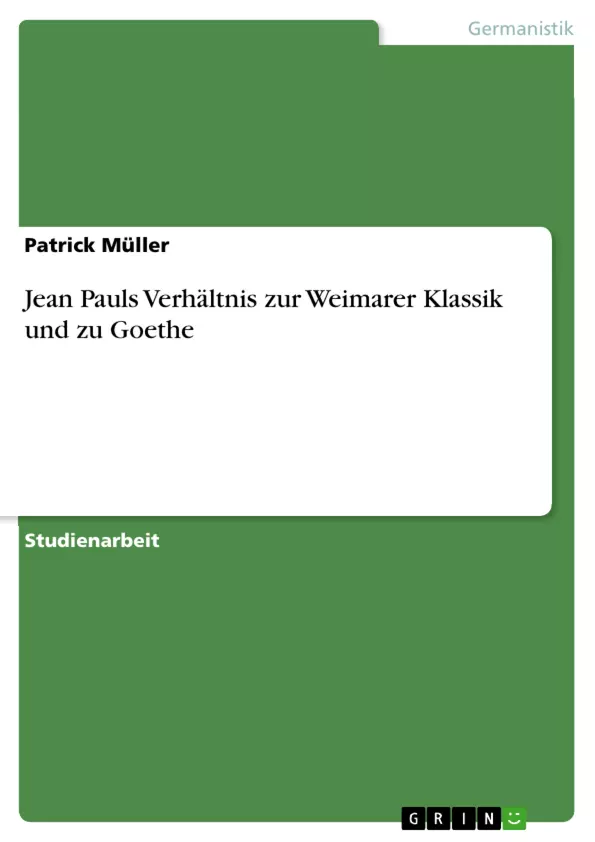Die deutsche Klassik – oder genauer gesagt: die Weimarer Klassik – ist gemeinhin mehr oder weniger ausschließlich mit den Namen der beiden großen Dioskuren der deutschen Literatur verbunden. Warum es für andere Dichter überaus schwierig war, in den klassischen Olymp aufgenommen zu werden, hat seinen Hauptgrund wohl darin, dass sich Goethe und Schiller zur Richtinstanz dessen stilisierten, was als klassische Dichtung zu gelten hatte, und was nicht. Ihre Urteile haben sich im kollektiven Gedächtnis der Germanistik nur schwer relativieren lassen. Vor allem traf dieses Schicksal diejenigen literarischen Phänomene, die sich so gar nicht einer der gängigen Strömungen zuordnen lassen wollten und wollen. Eines von ihnen ist Johann Paul Friedrich Richter.
Von etlichen Literaturgeschichten wird er in der Rubrik „zwischen Klassik und Romantik“ geführt oder auch als Gegenklassiker bezeichnet. Vor allem, ob und wieweit letztere Einschätzung eine tragfähige Argumentationsbasis aufweist, soll Reflexionsgegenstand dieser Arbeit sein. Es soll also darum gehen eine gewisse Polarität zwischen Jean Paul und der Weimarer Klassik – vor allem repräsentiert in der Person und im Werk Goethes – herauszuarbeiten. Da diese Polarität in erster Linie die Kunstauffassung betrifft, wird neben einer Darstellung wichtiger historisch-biographischer Begebenheiten, die das Verhältnis beider Dichter vergegenwärtigen können, vor allem auch die Konfrontation der beiden in ihren Texten ins Auge gefasst werden müssen.
Jean Paul empfand zweifellos große Bewunderung für Goethe, und die extreme Polarisierung der beiden ist sicherlich großenteils als Rezeptionsphänomen zu verstehen. Dennoch ist Goethe an dieser Einschätzung nicht unschuldig, finden sich doch bei ihm einige deutliche Seitenhiebe auf das dichterische Schaffen und die Person Richters. Für den umgekehrten Fall mag die Argumentationsbasis etwas wackliger sein, wo Jean Paul aber die literarischen und ästhetischen Hauptströmungen der Zeit aufgreift und angreift, trifft es – fast mit einer inneren Notwendigkeit – auch Goethe als Exponent der Weimarer Klassik. Insofern scheint es also gerechtfertigt, die dahingehend einschlägigen Texte beider zu analysieren, und aus den Ergebnissen die Unterschiede in den ästhetischen Auffassungen Goethes und Jean Pauls zu extrahieren.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Jean Paul als Dichter an der Nahtstelle zweier Jahrhunderte
2.1 Dichterexistenz als provinziale Existenz
3. Die Auseinandersetzung mit Goethe
3.1 Aus der ländlichen Provinz in die kosmopolitische Provinz
3.2 Jean Pauls Kontakt mit den literarischen Parteien Weimars
3.3 Goethes Urteil über Jean Paul
3.3.1 Der ChineseinRom
3.3.2 Vergleichung - Späte Revision eines klassischen (Vor-)Urteils?
3.4 Jean Pauls literarische Opposition gegen die Weimarer Klassik
3.4.1 Die Geschichte meiner Vorrede zur zweiten Auflage des Quintus Fixlein
3.4.2 Der Titan
4. Schlussbemerkungen
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Wie war das Verhältnis zwischen Jean Paul und Goethe?
Es war von einer starken Polarität geprägt. Während Jean Paul Bewunderung für Goethe empfand, reagierte Goethe oft mit Ablehnung oder "Seitenhieben" auf Jean Pauls eigenwilligen Stil.
Warum wird Jean Paul oft als „Gegenklassiker“ bezeichnet?
Weil sein Werk durch Abschweifungen, Humor und eine subjektive Erzählweise geprägt ist, was den strengen formalen und ästhetischen Idealen der Weimarer Klassik widersprach.
Was kritisierte Goethe an Jean Pauls Schreibstil?
Goethe störte sich an der mangelnden Formstrenge und dem „formlosen“ Genie Jean Pauls, was er unter anderem in seinen Xenien und kritischen Äußerungen deutlich machte.
Welche Rolle spielt das Werk „Titan“ in dieser Auseinandersetzung?
Der „Titan“ gilt als Jean Pauls Versuch, sich mit den ästhetischen Strömungen der Zeit, einschließlich der Klassik, auseinanderzusetzen und eine eigene, monumentale Antwort darauf zu geben.
Steht Jean Paul eher der Klassik oder der Romantik nahe?
Er wird oft als Dichter an der Nahtstelle gesehen. Er teilt mit der Romantik die Fantasie und Subjektivität, bleibt aber in seinem philosophischen Kern eigenständig und lässt sich kaum einer festen Schule zuordnen.
- Quote paper
- Patrick Müller (Author), 2003, Jean Pauls Verhältnis zur Weimarer Klassik und zu Goethe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212336