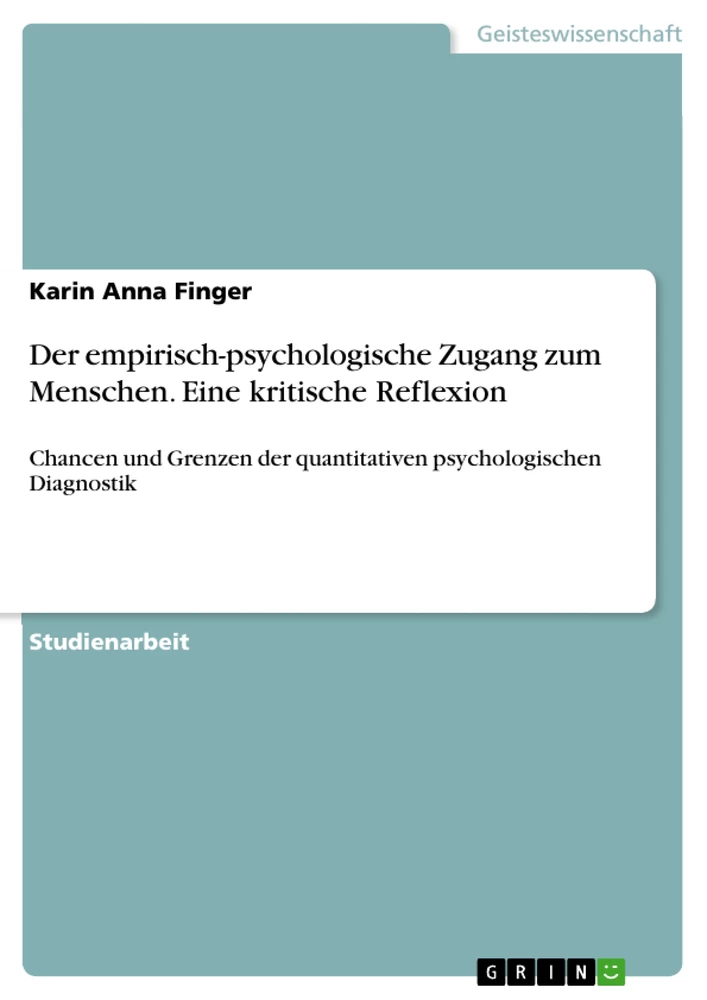1. Der Mensch befasst sich seit jeher mit sich selbst, er ist „ein Geist, der über sich selbst nachdenkt“. Die Fragen nach dem Bewusstsein, Ursachen des menschlichen Verhaltens und der seelischen Zustände sind erstmals im antiken Griechenland durch Aristoteles hinterfragt worden. Er hielt das Herz für den Ort von Geist und Seele.
Fast 2000 Jahre später, in der Neuzeit um 1637, untersuchte Descartes die Dualität von Körper und Geist. Er entwickelte die Stimmen von Sokrates und Platon weiter und begründete mit der Trennung von Körper und Seele die ersten Forschungen und Experimente über das Verhalten des Menschen, welche um 1883 durch erste Klassifikationen geistiger Störungen erfasst wurden. Heute befasst sich die Wissenschaft mit der quantenphysischen Psychologie und Klassifizierung von Verhalten und Störungen, und sucht neue Antworten auf die Fragen nach Zusammenhängen zwischen Wahrnehmung, Interpretation und Reiz. Welche Wahrnehmungsstärke bestimmt das Verhalten von Individuen? Welche Gesetzmässigkeiten oder Störvariablen lassen sich aus Experimenten ableiten? Aus diesen Erwägungen habe ich mir überlegt, ob es neue mathematische Formeln zu entwickeln gäbe, unter deren Anwendung sich Verhaltensströme und Zustände, wie zum Beispiel die Gesundheit der Welt, Kriege, Soziale Wohlfahrt oder Soziokulturelle Auseinandersetzungen (Kriege, Terror, Sozialer Unfrieden) vorausberechnen lassen, damit eine allgemein gültige Aussage gemacht werden kann. Welche Massnahmen könnten aufgrund der neusten Erkenntnisse der Hirnforschung über die Psychologie, im speziellen die Wirtschaftspsychologie, rechtzeitig und gewinnbringend, unter Einbezug sozialer und ökonomischer Tendenzen, eingeleitet werden? Welche Menschen wären dazu geeignet, solche Massnahmen umzusetzen, oder welche Bildungsmassnahmen müssten erarbeitet, geplant und umgesetzt werden? Solche Gedanken mögen aufzeigen, dass die diagnostische Arbeits- und Forschungsweise in der Psychologie alleine durch geschickte Manipulation, gesteuerte Interpretation und zuweilen wenig konkreter Fragestellung erschwert ist. Im Sinne der Transparenz von Forschungsergebnissen erfordert eine Fragestellung und die damit verbundene Auswertung konkrete, realistische Massvorgaben, nach welcher sich der Untersucher richten kann, da die Versuchsobjekte (Probanden, Gruppen, Individuen) und der Forscher stets einer gegenseitigen Beeinflussung ausgesetzt sind.
Inhalt
1. Einleitung
2. Ziele der psychologischen Diagnostik
3. Wissenschaftliche Strömungen
4. Quantitative vs. Qualitative Methoden in der empirischen Forschung
5. Vorteile, Chancen und Grenzen der quantitativen psychologischen Diagnostik
1. Einleitung
Der Mensch befasst sich seit jeher mit sich selbst, er ist „ein Geist, der über sich selbst nachdenkt“. Die Fragen nach dem Bewusstsein, Ursachen des menschlichen Verhaltens und der seelischen Zustände sind erstmals im antiken Griechenland durch Aristoteles hinterfragt worden. Er hielt das Herz für den Ort von Geist und Seele.
Fast 2000 Jahre später, in der Neuzeit um 1637, untersuchte Descartes die Dualität von Körper und Geist. Er entwickelte die Stimmen von Sokrates und Platon weiter und begründete mit der Trennung von Körper und Seele die ersten Forschungen und Experimente über das Verhalten des Menschen, welche um 1883 durch erste Klassifikationen geistiger Störungen erfasst wurden. Heute befasst sich die Wissenschaft mit der quantenphysischen Psychologie und Klassifizierung von Verhalten und Störungen, und sucht neue Antworten auf die Fragen nach Zusammenhängen zwischen Wahrnehmung, Interpretation und Reiz. Welche Wahrnehmungsstärke bestimmt das Verhalten von Individuen? Welche Gesetzmässigkeiten oder Störvariablen lassen sich aus Experimenten ableiten? Aus diesen Erwägungen habe ich mir überlegt, ob es neue mathematische Formeln zu entwickeln gäbe, unter deren Anwendung sich Verhaltensströme und Zustände, wie zum Beispiel die Gesundheit der Welt, Kriege, Soziale Wohlfahrt oder Soziokulturelle Auseinandersetzungen (Kriege, Terror, Sozialer Unfrieden) vorausberechnen lassen, damit eine allgemein gültige Aussage gemacht werden kann. Welche Massnahmen könnten aufgrund der neusten Erkenntnisse der Hirnforschung über die Psychologie, im speziellen die Wirtschaftspsychologie, rechtzeitig und gewinnbringend, unter Einbezug sozialer und ökonomischer Tendenzen, eingeleitet werden? Welche Menschen wären dazu geeignet, solche Massnahmen umzusetzen, oder welche Bildungsmassnahmen müssten erarbeitet, geplant und umgesetzt werden? Solche Gedanken mögen aufzeigen, dass die diagnostische Arbeits- und Forschungsweise in der Psychologie alleine durch geschickte Manipulation, gesteuerte Interpretation und zuweilen wenig konkreter Fragestellung erschwert ist. Im Sinne der Transparenz von Forschungsergebnissen erfordert eine Fragestellung und die damit verbundene Auswertung konkrete, realistische Massvorgaben, nach welcher sich der Untersucher richten kann, da die Versuchsobjekte (Probanden, Gruppen, Individuen) und der Forscher stets einer gegenseitigen Beeinflussung ausgesetzt sind.
Aus diesen Ueberlegungen lässt sich ableiten, dass im Grunde fast alle globalen Probleme der Menschheit wie Kriege, Armut, Epidemien, Hunger, Ueberbevölkerung, Umweltverschmutzung, soziale Konflikte und Arbeitslosigkeit u.a. auf psychische Faktoren zurückgeführt werden können (z. B. Angst, Aggression, Machtstreben, Unwissen, Vorurteile, Ideologien, Glaube und Ueberzeugung) und durch psychologische Massnahmen zumindest teilweise zu bewältigen sind. Fragen wie z. B. „wie werde ich glücklich“ oder „wem kann ich vertrauen“ zeigen auf, dass man Menschen nicht einfach in einen binären Code verwandeln kann, sondern dass Bedürfnisse und Motivation des Einzelnen in quantitativen Erhebungen berücksichtigt werden müssen, damit bei allen empirischen Verfahren die ethischen Ansprüche an die Würde des Menschen, des Einzelnen, nicht verloren gehen. Ein akutes Beispiel dafür sind die Entwicklungen in sozialen Online Netzwerken, die mit virtuellen Freundschaften locken, jedoch in Wahrheit das Sozialverhalten beeinträchtigen und damit Unsicherheit, Angst, Hilflosigkeit Depressionen und Suizidalität fördern. Im Rahmen einer Studie von Suchtbeauftragten der Bundesregierung (Quelle: Manfred Spitzer, „Digitale Demenz“, 2012) wurde publiziert, dass alleine in Deutschland 250'000 der 14- bis 24-Jährigen als internetabhängig, und 1,4 Mio. Jugendliche als problematische Internetnutzer gelten. Gedächtnis-, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen sowie emotionale Verflachung und allgemeine Abstumpfung nehmen zu. Diese Entwicklung der „Digitalen Demenz“ bereits im Jugendalter ist erst am Anfang und stellt die nächsten Generationen von Psychologen und Psychiatern vor neue Herausforderungen.
2. Ziele der psychologischen Diagnostik
Verhaltensdaten werden durch Beobachtung, Umfrage, Erfahrung und Analyse auf verschiedenen Ebenen erhoben. Dabei wird individuelles Verhalten durch z. B. Genetik, Motivation, Intelligenz, Selbstwertgefühl (organismische Variablen) und durch z. B. Umweltbedingungen zum Zeitpunkt der Erhebung (situative Variablen) beeinflusst.
Komplexes menschliches Verhalten lässt sich nicht alleine durch Analyse der individuellen Eigenschaften verständlich machen, menschliche Verhaltensweisen werden durch die Macht externer situativer Kräfte beeinflusst, geprägt und gesteuert. Wir müssen vielmehr danach fragen, wer oder was die Situation schafft im bestimmenden Verhaltenskontext. Im übertragenen Sinn ist es zwingend, nebst individuellen Dispositionen auch die systemischen Einflüsse zu kennen, die sozialen Umfelder, die wirtschaftlichen, historischen, politischen religiösen und legislativen Kräfte, die auf ein Verhalten einwirken oder Einfluss (Macht) auf eine Verhaltensveränderung haben, wenn wir eine Aussage machen über die Wahrscheinlichkeit mit der ein bestimmtes Verhalten auftritt, oder mit der ein bestimmter Zusammenhang besteht. Wir müssen nach dem Sinn und Unsinn des Verhaltens fragen, nach intrinsischer (Anerkennung durch die Ausübung einer Handlung, Geselligkeitsmotiv), oder extrinsischer (Sicherheit, Status) Motivation, die Menschen leitet. Der Mensch ist von Natur aus irrational, und unsere „Bias“ (Neigung, Vorurteil) steht im Vordergrund, wir sehen normalerweise nur uns selbst. Aufgrund dieser „Dramatik des Egoisten“ müssen wir uns ständig bemühen, vernünftig zu sein. Wenn wir dabei einen Sinn erkennen und daraus Ziele ableiten können, dann bleiben wir gesund. Nebst der Frage nach „sozialer Erwünschtheit“ oder nach „sozialen Tabus“ stellt sich genauso die Frage nach Glaubwürdigkeit, Irrtumswahrscheinlichkeit und persönlicher Disposition (Befangenheit) eines Betrachters. Im humanistisch übertragenen Sinn lässt sich dies als Beispiel auf die Führungskultur einer Firma übertragen: Das Thema „Fairness“ im Kontext „Arbeitsplatz“ diente als Studie, woraus Werte für die Führungsgrundsätze und Wohlfühlfaktoren für die Mitarbeiter generiert wurden. Es lassen sich daraus z. B. folgende Kernbotschaften ableiten: Aufrichtigkeit, Ressourcenschonend, Genderorientiert, Gewalt-und Diskriminierungsfrei.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus der kritischen Reflexion über den Menschen?
Die Arbeit hinterfragt den empirisch-psychologischen Zugang zum Menschen und diskutiert die Grenzen mathematischer Formeln zur Vorhersage von menschlichem Verhalten.
Was versteht der Autor unter "Digitaler Demenz"?
Unter Rückgriff auf Manfred Spitzer beschreibt der Text die negativen Folgen exzessiver Internetnutzung bei Jugendlichen, wie Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen sowie emotionale Abstumpfung.
Welche Rolle spielen situative Variablen für das Verhalten?
Menschliches Verhalten wird nicht nur durch Gene oder Intelligenz (organismische Variablen), sondern massiv durch externe situative Kräfte wie soziale, wirtschaftliche und politische Umfelder geprägt.
Können globale Probleme psychologisch gelöst werden?
Der Autor argumentiert, dass Probleme wie Kriege, Armut oder Umweltverschmutzung oft auf psychische Faktoren (Angst, Aggression, Machtstreben) zurückzuführen sind und psychologische Maßnahmen zur Bewältigung beitragen können.
Warum ist absolute Objektivität in der psychologischen Forschung schwierig?
Da Probanden und Forscher einer ständigen gegenseitigen Beeinflussung ausgesetzt sind, ist die Diagnostik oft durch Manipulation und gesteuerte Interpretation erschwert.
- Quote paper
- Betriebsökonomin FH Karin Anna Finger (Author), 2012, Der empirisch-psychologische Zugang zum Menschen. Eine kritische Reflexion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212365