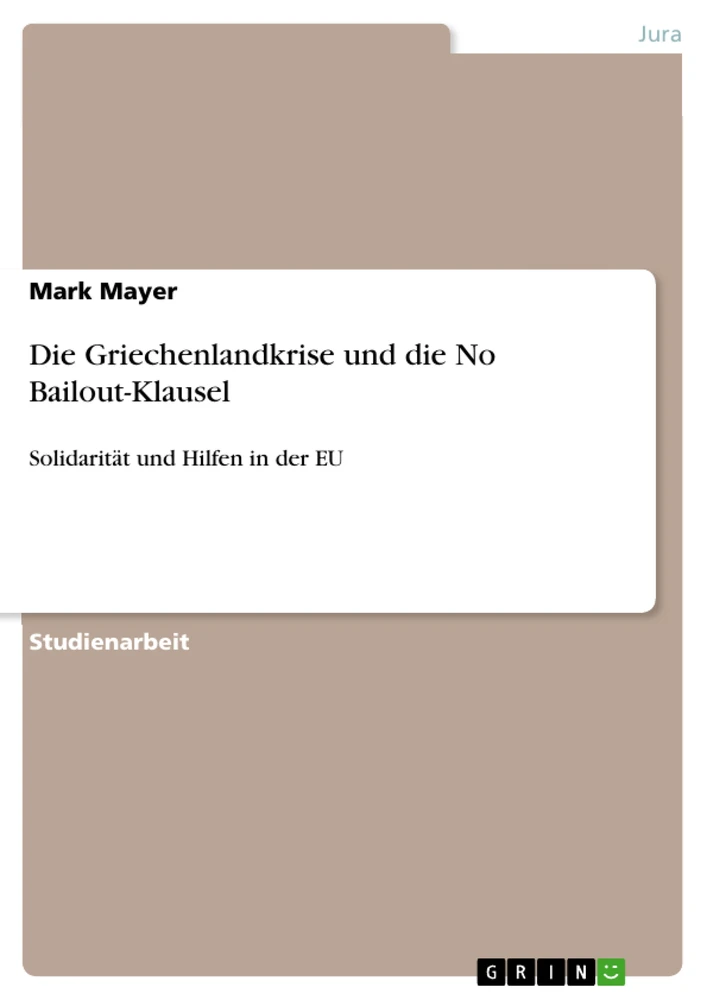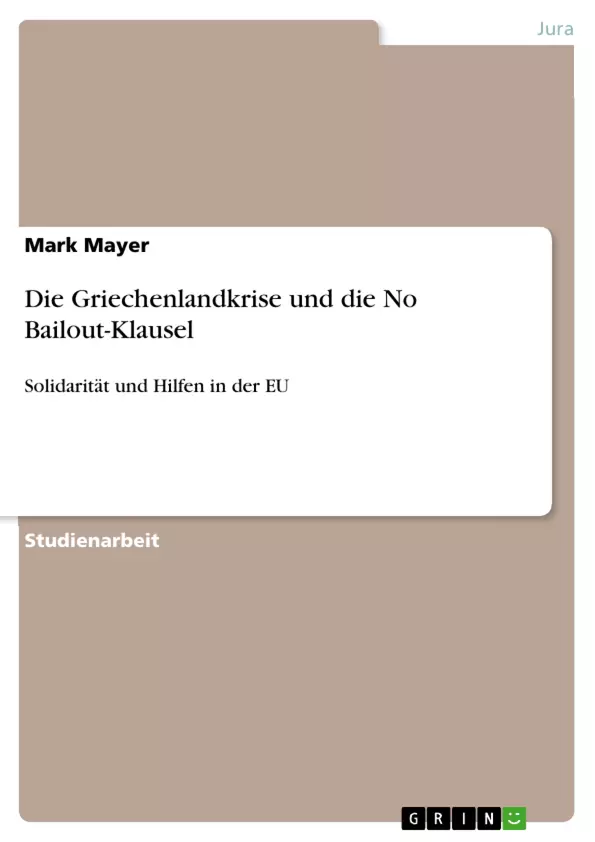Die europäische Union steht vor einer Herausforderung der ganz besonderen Art. Die „Griechenlandkrise“ bringt die Union und ihre Mitgliedsstaaten an die Grenze europäischer Solidarität. Die Bevölkerung der „Geberländer“ steht bisweilen nicht mehr voll und ganz hinter den Rettungsmaßnahmen. Umgekehrt hätte der Bankrott eines Staates innerhalb der Eurozone unabsehbare Konsequenzen auf den Bestand des Euro und damit auf den Bestand der gesamten europäischen Union.
Ziel dieser Arbeit ist es, zu prüfen, ob finanzielle Interventionen wie Sie derzeit in der „Griechenlandkrise“ aufgewandt werden, mit dem europäischen Recht und insbesondere der „No Bailout“-Klausel des Art. 125 AEUV vereinbar sind. Zudem soll untersucht werden, inwieweit diese Hilfen auf Solidarität zurückzuführen sind.
Um das Verständnis des heutigen, europäischen Regelwerks zu erleichtern wird dabei zunächst die gesellschaftliche, ökonomische und historische Entwicklung der europäischen Integration dargestellt.
[...]
Die Entstehung der Währungsunion ist als ein ambivalenter, ökonomischer Meilenstein zu betrachten. Denn einerseits birgt eine einheitliche Währung für die einzelnen Wirtschaftssubjekte ehebliche Vorteile, da eventuelle Transaktionskosten bei grenzüberschreitendem Handel fortan entfallen - auf der anderen Seite jedoch bringt eine gemeinsame Währung auch beträchtliche Gefahren für die einzelnen Mitgliedsstatten in der Eurozone mit sich. So wird ein Staat im Währungsverbund ohne Handlungskompetenz hinsichtlich der eigenen Geldpolitik seinen Staatshaushalt durch geldpolitische Maßnahmen nicht mehr selbst beeinflussen können.
Außerdem darf die Einführung der gemeinsamen Währung auch gesellschaftlich nicht unterschätzt werden. Es wäre wohl kaum möglich gewesen einen derartigen Integrationsschub mit anderen politischen Bemühungen zu erreichen. Dies mag insbesondere an der starken Symbolkraft einer gemeinsamen Währung für ein vereintes Europa liegen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung…..\n1
- B. Getrennte Zuständigkeiten auf Ebene der Währungs- und Wirtschaftspolitik und daraus resultierender Koordinationsbedarf..\n2
- a. Die Währungspolitik der Union und die Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten
- b. Wirtschaftspolitische Vorgaben des Vertrages von Lissabon an die Mitgliedstaaten der Eurozone...
- C. Die Rolle der Solidarität auf europäischer Ebene\n3
- a. Der solidarische Grundgedanke der europäischen Union
- b. Rechtlich angedachte Möglichkeiten, solidarische Finanzhilfen innerhalb der europäischen Union zu leisten......\n6
- C. Das Spannungsverhältnis zwischen dem finanziellem Beistand und der „No Bailout“-Klausel\n10
- D. Das aktuelle Problem: Sind die Hilfsleistungen im Kontext der „Griechenlandkrise“ zulässig?\n10
- a. Inhalt und Zustandekommen der bilateralen Kredite, dem ESFM, dem ESFS und dem ESM..\n11
- b. Vereinbarkeit der Hilfsleistungen mit europäischem Recht........\n12
- C. Das Urteil des EuGH zum ESM vom 27. November 2012.\n17
- E. Schlussteil..\n19
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Frage, ob und inwiefern die in der Finanzkrise gewährten Finanzhilfen an Griechenland mit dem europäischen Recht vereinbar sind. Dabei wird insbesondere das Spannungsverhältnis zwischen dem Solidaritätsprinzip der EU und der "No Bailout"-Klausel im Fokus stehen.
- Die Rolle der Solidarität im europäischen Kontext
- Die "No Bailout"-Klausel und ihre Bedeutung
- Die rechtliche Bewertung der Finanzhilfen an Griechenland
- Die Bedeutung des Solidaritätsprinzips für die Stabilität der Eurozone
- Die Auswirkungen der Finanzhilfen auf die europäische Integration
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel A: Einführung Dieser Abschnitt liefert eine kurze Einleitung in das Thema und stellt die Forschungsfrage dar. Die Bedeutung der "Griechenlandkrise" für die europäische Integration wird erläutert.
- Kapitel B: Getrennte Zuständigkeiten auf Ebene der Währungs- und Wirtschaftspolitik und daraus resultierender Koordinationsbedarf Dieses Kapitel befasst sich mit der Unterscheidung zwischen Währungspolitik der Union und Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und den daraus resultierenden Herausforderungen für die Koordinierung der beiden Politikfelder. Die Rolle des Vertrages von Lissabon und seine Vorgaben für die Wirtschaftspolitik der Eurozone werden erläutert.
- Kapitel C: Die Rolle der Solidarität auf europäischer Ebene Dieses Kapitel analysiert den solidarischen Grundgedanken der Europäischen Union und untersucht die rechtlichen Möglichkeiten, solidarische Finanzhilfen zu leisten. Die Bedeutung des Solidaritätsprinzips für die europäische Integration wird dargestellt.
- Kapitel D: Das Spannungsverhältnis zwischen dem finanziellem Beistand und der „No Bailout“-Klausel In diesem Kapitel wird das Spannungsverhältnis zwischen dem finanziellen Beistand der EU und der "No Bailout"-Klausel analysiert. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Finanzhilfen im Kontext der "Griechenlandkrise" werden untersucht.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit zentralen Begriffen und Konzepten des europäischen Rechts, insbesondere mit dem Solidaritätsprinzip, der "No Bailout"-Klausel, den Finanzhilfen im Kontext der "Griechenlandkrise" sowie den rechtlichen Rahmenbedingungen für die Stabilität der Eurozone.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die „No Bailout“-Klausel (Art. 125 AEUV)?
Die Klausel besagt, dass weder die EU noch die Mitgliedstaaten für die Verbindlichkeiten eines anderen Mitgliedstaates haften.
Sind die Finanzhilfen für Griechenland mit EU-Recht vereinbar?
Die Arbeit prüft die Vereinbarkeit bilateraler Kredite und Rettungsschirme wie ESM und EFSF mit dem AEUV und dem Urteil des EuGH von 2012.
Welche Rolle spielt die europäische Solidarität in der Krise?
Solidarität ist ein Grundgedanke der EU, gerät aber in Konflikt mit ökonomischen Regeln, wenn Geberländer Rettungsmaßnahmen kritisch sehen.
Was sind die Gefahren einer gemeinsamen Währung ohne gemeinsame Finanzpolitik?
Einzelne Staaten verlieren ihre geldpolitische Handlungskompetenz und können ihren Haushalt nicht mehr durch eigene Währungsabwertungen stabilisieren.
Was ist der ESM?
Der ESM (Europäischer Stabilitätsmechanismus) ist ein dauerhafter Rettungsschirm zur Sicherung der Finanzstabilität in der Eurozone.
- Quote paper
- Mark Mayer (Author), 2013, Die Griechenlandkrise und die No Bailout-Klausel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212387